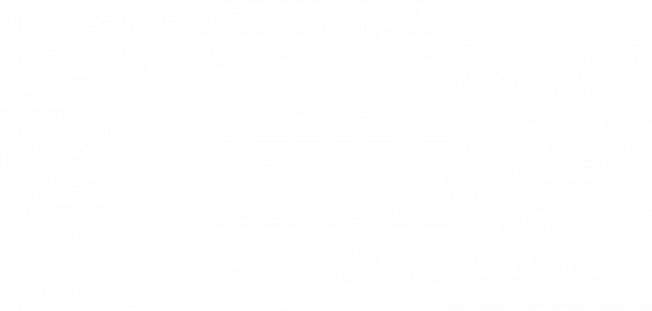„Die Mitgliedstaaten sind die Herren der Verträge. Sie können der EU Kompetenzen wieder wegnehmen“
5.1.2018 – Interview mit Roland Vaubel zu seinem jüngst erschienenen Buch „Das Ende der EUromantik: Neustart jetzt“.
*****
Sie stellen in Ihrem neuen Buch „Das Ende der EUromantik“ die Frage, ob der Euro wirklich der Preis für die Wiedervereinigung war. War er es?
Ja. Hans-Dietrich Genscher schreibt ja selbst in seinen Memoiren über die Einberufung der Regierungskonferenz, die die Währungsunion beschließen sollte: „Mir schien es daher dringlicher denn je, im Dezember 1989 über das Mandat für die Regierungskonferenz zu entscheiden …, denn wir würden unsere Partner in der Europäischen Gemeinschaft, allen voran Frankreich, brauchen, sobald es um die deutsche Vereinigung ging“. Horst Teltschik, Kohls europapolitischer Chefberater, sagte, wie er in seinen Memoiren erwähnt, im Dezember 1989 einem französischen Journalisten, „im Übrigen befinde sich die Bundesregierung jetzt in der Lage, praktisch jeder französischen Initiative für Europa zustimmen zu müssen“. Und Mitterand höchstpersönlich bemerkte in einem Fernseh-Interview: „Man spürte, dass Kohl Zugeständnisse machen würde. Die Deutschen wollten die Wiedervereinigung, und diesem Willen konnte sich niemand widersetzen. Wir konnten einfach nur darüber verhandeln, wie die Interessen aller gewahrt werden konnten“. Kohl und Genscher hatten den Euro ursprünglich als Preis für eine gemeinsame europäische Verteidigungs- und Außenpolitik vorgesehen – mit nuklearer Komponente, wie damals Schäuble meinte. Dazu kam es aber wegen des Mauerfalls nicht. Stattdessen wurde der Euro zum Preis für die Wiedervereinigung.
Einige Jahre vor der Veröffentlichung seiner Memoiren hat Genscher das noch als „Legende“ bezeichnet …
Ja, das war im Bundestag. So wahr können Legenden sein! Immerhin war Genscher in seinen Memoiren ehrlich. Kohl und Schäuble haben stets bestritten, dass der Verzicht auf die D-Mark der Preis für die Wiedervereinigung war. Bundespräsident von Weizsäcker war da offener.
Ihr Buch beinhaltet erwartungsgemäß viel Kritik. Sie sehen vermehrt Signale, dass die Europapolitiker nicht das machen, was die Bürger von ihnen erwarten, bezeichnen sie als „abgehoben“. Beschreiben Sie uns das bitte näher.
Der Beweis sind Parallelumfragen. Dabei werden den Bürgern und zum Beispiel den Europarlamentariern oder den leitenden Kommissionsbeamten zum selben Zeitpunkt dieselben Fragen gestellt. Alle diese Parallelumfragen sind natürlich nicht von Eurobarometer, dem Umfrageinstitut der EU-Kommission, sondern von unabhängigen Meinungsforschungsinstituten und Wissenschaftlern durchgeführt worden. Sie zeigen, dass die Eurokraten den EU-Institutionen viel mehr Kompetenzen übertragen wollen und auch viel bessere Noten geben als die Bürger. Ich habe die wichtigsten Ergebnisse in meinem Buch zusammengestellt.
Die Brexit-Entscheidung war letztlich auch eine Art „Umfrage“, allerdings mit bindender Wirkung. Wenn man die jüngsten Forderungen von Martin Schulz nach den Vereinigten Staaten von Europa hört, muss man feststellen, dass die EURomantiker, wie Sie sie nennen, den Schuss aber noch nicht gehört haben, oder?
Martin Schulz ist Sozialdemokrat. Er will mehr Regulierung und mehr Umverteilung. Je mehr die Politik auf EU-Ebene zentralisiert und „harmonisiert“ wird, desto mehr kann reguliert und umverteilt werden, weil es immer schwieriger wird, sich der Bevormundung und der hohen Besteuerung durch Abwanderung zu entziehen. Außerdem leidet die demokratische Kontrolle, weil die Bürger weniger Vergleichsmöglichkeiten haben. Wer zentralisiert, gibt dem Staat mehr Macht – und das will die SPD. Insofern ist Martin Schulz konsequent. Den Schuss noch nicht gehört hat Wolfgang Schäuble. Er versteht nicht, dass Zentralisierung zulasten der Freiheit geht. Bei Angela Merkel weiß ich nicht, was für Ziele sie verfolgt – außer dass sie Bundeskanzlerin bleiben möchte.
Sie üben auch harte Kritik an der Europäischen Zentralbank. Sie hat sich demnach zum Kumpanen der Politik gemacht…
Ja. Draghi nimmt regelmäßig an den Sitzungen der Finanzminister – der sogenannten Euro-Gruppe – teil. Zu Zeiten der Bundesbank wäre es völlig undenkbar gewesen, dass der Bundesbank-Präsident – außer bei der Verabschiedung des Jahreswirtschaftsberichts – an Sitzungen des Bundeskabinetts teilgenommen hätte. Im August 2012 besuchte Draghi sogar Finanzminister Schäuble auf Sylt, um mit ihm die Anleihekäufe der EZB zu besprechen. Indem die EZB Staatsanleihen kauft, hilft sie den Politikern aus der Klemme. Bis 2015 hat die EZB ihre Ankäufe davon abhängig gemacht, dass der betreffende Staat wirtschaftspolitische Auflagen des Europäischen Stabilitätsmechansimus (ESM) – also der anderen Finanzminister – akzeptiert hatte. Das war eigentlich verboten, denn die EZB darf nach Art. 130 des Vertrages von Maastricht keine „Weisungen von … anderen Stellen einholen oder entgegennehmen“. Sie darf sich nicht davon abhängig machen, was die Politiker entscheiden. Im April 2014 gab Draghi in einer Klausurtagung den Bundestagsabgeordneten der Regierungsparteien sogar Insider-Informationen über den zukünftigen Kurs der Geldpolitik. Das wurde in den Medien zu Recht scharf kritisiert. Draghi beteiligte sich auch 2015 am sogenannten Bericht der fünf Präsidenten, welcher zum Beispiel ein Euro-Schatzamt empfahl. Dazu ist die EZB nicht befugt.
Sie fordern – nicht zuletzt adressiert an die EZB – einen Neustart. Wo sehen Sie den dringlichsten Handlungsbedarf?
Die EZB sollte umgehend die Zinsen erhöhen und aufhören, Staatsanleihen zu kaufen. Die Geldmengenexpansion (M3) liegt seit März 2015 über der stabilitätsgemäßen „Referenzrate“ von 4,5 Prozent. Die EZB sollte zu ihrem ursprünglichen Ziel von 1,5 Prozent Preissteigerung zurückkehren. Der Präsident der EZB sollte nicht mehr an den Sitzungen der Finanzminister teilnehmen oder Politiker im Urlaub besuchen. Es steht einer Bürokratie wie der EZB auch nicht zu, den demokratisch gewählten Regierungen wirtschaftspolitische Bedingungen für die Notfall-Liquiditätshilfe und Anleihekäufe der Zentralbank zu stellen, wie wiederholt geschehen. Da die EZB für die Bankenaufsicht nicht geeignet ist und dafür auch keine tragfähige Rechtsgrundlage besitzt, sollte sie die Bankenaufsicht so weit wie möglich den nationalen Aufsichtsämtern überlassen.
Was halten Sie von einem Währungswettbewerb als Medikation für das staatliche Geldsystem?
Sehr viel. Potentieller Wettbewerb ist immer gut. Selbst wenn es wahr wäre, dass Geld ein natürliches Monopolgut ist, bräuchten wir den freien Marktzutritt, um dies zu beweisen. Währungsunionen sollten nicht dadurch entstehen, dass sich verschiedene Staaten auf ein gemeinsames Geldmonopol einigen, sondern dadurch, dass sich eine Währung gegenüber den anderen am Markt durchsetzt. Es gibt zwar beim Geld Netzwerkexternalitäten, aber diese rechtfertigen – wenn überhaupt – nur Subventionen, nicht Beschränkungen des Marktzutritts. Im ersten Schritt ist es notwendig, einen freien und unverzerrten Wettbewerb zwischen den staatlichen Notenbanken zuzulassen. Das bedeutet, dass jeder Staat zu dem am Markt geltenden Devisenkurs jede Währung akzeptiert und dass die Privaten ihre Forderungen und Verbindlichkeiten in jeder beliebigen Währung vereinbaren dürfen. Im zweiten Schritt müssen auch Private das Recht erhalten, ihr eigenes Geld und ihre eigene Währung zu emittieren. Wenn es – wie einige vorschlagen – nur eine Währung in der Welt gäbe, wäre die Inflationsgefahr maximal.
Haben wir denn nicht eigentlich „eine“ Währung in der Form, dass alles Geld auf der Welt Papiergeld ist? Und die Notenbanken arbeiten bis auf kleine Nuancen doch auch Hand in Hand, helfen sich notfalls sogar mit Swap-Geschäften aus …
Ja, es gibt fast nur noch Papiergeld und Buchgeld, aber die Inflationsraten sind unterschiedlich, und die Wechselkurse ändern sich. Es hat Zeiten gegeben, in denen der Währungswettbewerb zwischen den staatlichen Notenbanken eine wichtige Rolle gespielt hat – zum Beispiel in den siebziger Jahren. Die niedrigeren Inflationsraten in Deutschland, der Schweiz und Japan zwangen die Notenbanken in den USA, Großbritannien, Frankreich, Italien usw. zu einer anti-inflationären Geldpolitik. Denken Sie an Friedrich August von Hayek: ein halbes Jahr vor seinem Buch „The Denationalisation of Money“ veröffentlichte er 1976 seine Schrift „Choice in Currency“. Darin forderte er einen unbeschränkten Währungswettbewerb zwischen den Notenbanken.
Die Kräfte, die die Zentralisierung vorantreiben wollen, sind sehr stark, denken wir alleine an die EU-Kommission. Sind konsensfähige Reformen nicht mehr als nur Sand im Zentralisierungs-Getriebe? Wie bekommen wir einen Wettbewerb der politischen Institutionen? Niedrigere Steuern, weniger Bürokratie …
Ja, die Parallelumfragen in meinem Buch zeigen, dass die führenden Kommissionsbeamten und die Euro-Parlamentarier der EU mehr Macht geben wollen, als die Bürger wünschen. Aber noch sind die Mitgliedstaaten die Herren der Verträge. Sie können der EU Kompetenzen, die sich nicht bewährt haben, wieder wegnehmen, auch wenn das Europäische Parlament und die Kommission dagegen sind. In der Bundesrepublik ist das problematischer: Die Länder können das Grundgesetz nicht gegen den Willen des Bundestages ändern. Trotzdem hat es Phasen der Dezentralisierung gegeben – zum Beispiel die sogenannte Föderalismus-Reform. In vielen Industrieländern ist sogar ein anhaltender Trend der Dezentralisierung zu beobachten. So konnte ich 2009 zeigen, dass der Anteil der zentralstaatlichen Ausgaben an den gesamten Staatsausgaben von 1972-74 bis 2002-04 in 18 der 27 Staaten, für die wir diese Daten haben, zurückgegangen ist – zum Beispiel in Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Portugal, Spanien, Schweden, den USA, Kanada und Australien. Es gibt kein „eisernes Gesetz der Zentralisierung“.
Vielen Dank, Herr Vaubel.
*****
Das Interview wurde im Dezember per email geführt. Die Fragen stellte Andreas Marquart.
——————————————————————————————————————————————————————————–
Roland Vaubel hat von 1984 bis 2016 Wirtschaftspolitik und politische Ökonomie an der Universität Mannheim gelehrt. Davor war er ordentlicher Professor an der Erasmus Universität Rotterdam und unterrichtete als Gastprofessor an der University of Chicago. Seit 1993 gehört er dem Wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums an. Er ist seit 1991 Mitglied der international besetzten European Constitutional Group, die wiederholt Vorschläge für die Reform der EU veröffentlicht hat. Vaubel hat früher selbst bei der EU-Kommission gearbeitet und wurde von ihr in eine hochrangige Studiengruppe berufen.
*****
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Institut Deutschland wieder.
Foto Startseite: © beugdesign – Fotolia.com