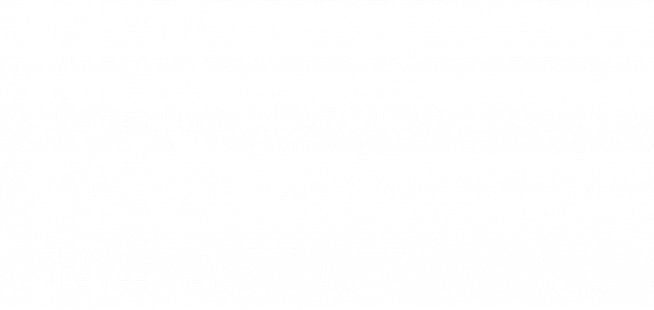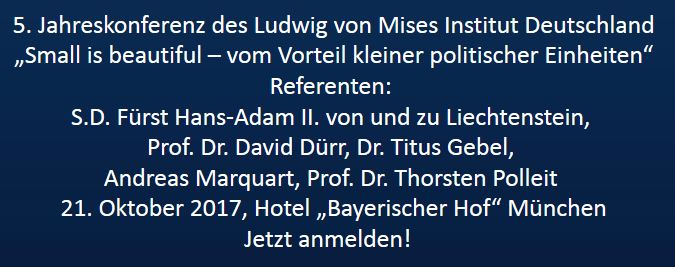Das Kurzfristdenken der Hauptstrom-Ökonomen
8.9.2017 – von Karl-Friedrich Israel.
Obwohl die Volkswirtschaftslehre noch eine sehr junge Wissenschaft ist, hat sie eine sehr bewegte Geschichte. Es gibt Strömungen in die eine wie die andere Richtung, und es gibt unterschiedliche Lager, die sich intellektuell bekämpfen. Historiker der ökonomischen Ideengeschichte sprechen zuweilen schon bei kleinen Veränderungen im ökonomischen Denken von einem Paradigmenwechsel, einer abgelösten Orthodoxie, oder gar von Revolutionen und Konterrevolutionen.
Zum einen ist dies sicherlich der Lust am Spektakel geschuldet. Und es trägt ja auch zu einem gewissen Unterhaltungswert in einer sonst trockenen Disziplin bei. Andererseits liegt es wohl an der hohen politischen Relevanz der Volkswirtschaftslehre. Eine nüchterne Debatte wird immer dann erschwert, wenn politische Interessen involviert sind. Dieser Umstand liefert auch allerhand Raum für Spekulationen, warum die Ökonomik so geworden ist, wie sie sich uns heute präsentiert: nach außen abgehoben formal und vermeintlich wertfrei, in ihren Schlussfolgerungen aber von höchster gesellschaftlicher Relevanz und zuweilen extrem invasiv, hinsichtlich ihrer Politikempfehlungen für das zwischenmenschliche Miteinander.
Das zentrale Problem vom wissenschaftlichen Standpunkt ist, dass die schnelle Rede von revolutionären Umwälzungen – etwa der Keynesianischen Revolution und der Monetaristischen Konterrevolution –, die man wahlweise feiern oder bekämpfen sollte, für die wirklich fundamentalen Unterschiede und Gemeinsamkeiten blind macht. Folglich werden auch wichtige Konsequenzen dogmengeschichtlicher Entwicklungen nicht richtig abgeschätzt.
Es gibt natürlich sowohl in den spezifischen Analyseverfahren als auch den politischen Schlussfolgerungen ganz erhebliche Unterschiede zwischen Keynesianern und Monetaristen sowie zwischen den diversen Untergruppen. Dennoch ist es gerade vom Standpunkt der Österreichischen Schule nicht schwer, ein verbindendes Element auszumachen. Dieses Element ist methodologischer Natur.
Alle gegenwärtigen Hauptströmungen der Ökonomik vereint, dass sie zu wichtigen Teilen die Kernthese der modernen Ökonometrie nach Ragnar Frisch verinnerlicht haben. Der spätere Nobelpreisträger (1969) postulierte im Jahre 1926 die These, dass die Ökonomik in eine „Wissenschaft im engeren Sinne des Wortes“ transformiert werden müsse, d.h. in eine Wissenschaft nach dem Vorbild der Physik (Frisch, 1926).
Frisch und einige seiner Gefolgsleute in der Econometric Society, darunter illustre Gestalten wie Irving Fisher, haben die Quantifizierung und Vorhersagekraft von ökonomischer Theorie in den Vordergrund gestellt. Ein Modell sei nur so gut wie seine quantitativ-empirischen Vorhersagen. Diese Überzeugung floss ein in die Keynesianisch inspirierten und großspurig angelegten Modellversuche von Ökonomen wie Lawrence Klein in der Nachkriegszeit. Klein, Nobelpreisträger von 1980, machte es sich zur Lebensaufgabe, die Keynesianische Theorie empirisch zu prüfen, auszubauen und zu verfeinern. Dazu hat er ökonometrische Modelle mit mehr als 400 Gleichungen erstellt (Bodkin, Klein, & Marwah, 1991), die die komplette Dynamik einer gesamten Volkswirtschaft einfangen sollten. Moderne Datenerhebung und die sich rapide entwickelnde Computertechnologie haben dies möglich gemacht.
Milton Friedman, ranghöchster Monetarist und Nobelpreisträger von 1976, hatte an diesem grundsätzlichen Vorgehen wenig zu bemängeln. Im Gegenteil, er hat den methodologischen Instrumentalismus und den Fokus auf empirisch-quantitative Vorhersagen mit seinem wohl bekanntesten Essay zementiert (Friedman, 1953). Das einzige was zählt und eine Theorie oder ein Modell letztlich rechtfertigt, sei dessen Vorhersagekraft. Die zugrundeliegenden Annahmen könnten noch so unrealistisch sein, sofern das Modell gute Prognosen über empirisch messbare Größen liefert.
Dieses Ideal hat nur sehr langsam von seiner Dominanz eingebüßt und ist schulübergreifend in der modernen Hauptstromökonomik anzufinden. Selbst die Neuklassiker und Neukeynesianer, denen man gern zu viel weltfremdes Theoretisieren vorwirft, entwickelten ihre dynamisch-stochastischen Gleichgewichtsmodelle als eine Antwort auf das empirische Scheitern der großspurigen Makromodelle während der Stagflation der 1970er und 80er Jahre. Letztere hatten die steigenden Preisinflationsraten nicht vorhersagt.
Nun ist es natürlich ein Gebot der wissenschaftlichen Aufrichtigkeit, ein gescheitertes Modell zu verbessern oder ganz zu ersetzen und über die Mängel nicht einfach so hinwegzutäuschen. Das faszinierende jedoch ist, dass sich im Grunde nur die äußere Form der Modelle, nicht aber tatsächlich die Vorhersagen oder die politischen Schlussfolgerungen, die aus ihnen gezogen werden, verändert haben. Man hat sogar zeigen können, dass die modernen Modelle ähnlich schlecht abgeschnitten hätten, wären sie anstelle der alten Modelle in den 1970er Jahren verwendet worden (Hurtado, 2014). Woran liegt das?
Im Grunde lässt sich diese Frage mit einer Binsenweisheit beantworten: Prognosen sind schwer, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Allerdings wird der Schwierigkeitsgrad noch erhöht, wenn sie die ferne Zukunft betreffen. Über die kurze Frist schneiden die diversen ökonometrischen Modelle relativ gut ab, kommt es nicht gerade zu einem ökonomischen Großereignis wie einer Finanzkrise. Je länger der Prognosehorizont jedoch gewählt wird, desto unsicherer werden die Vorhersagen.
Dies hat eine sehr verheerende Folge. Die Vorhersagekraft als wichtigstes Gütekriterium einer ökonomischen Theorie führt dazu, dass die kurzfristigen Folgen diverser politischer Eingriffe sehr gut und ausgiebig studiert werden. Sie lassen sich empirisch relativ gut fassen. Geht es um die langfristigen Folgen, so verändert sich das Bild. Da kein Modell gute Prognosen in der langen Frist abgibt, ist auch keines tauglich, langfristige Folgen von Politikeingriffen und anderen Veränderungen abzuschätzen. Es ergibt sich ein methodologischer Bias zugunsten der Kurzfristanalyse.
Man besinnt sich also auf das, was relativ gut klappt, wenn nicht gerade gravierende und unerwartete Veränderungen eintreten. Man konzentriert sich auf die unmittelbaren Folgen. Und wer würde eigentlich leugnen, dass eine expansive Geldpolitik auf kurze Sicht eine stimulierende Wirkung hat? Nicht einmal die Österreicher. Allerdings erkennen die Österreicher, dass die expansive Wirkung, die von Zinssenkungen oder Geldmengenausweitungen ausgehen, zu Kapitalfehllenkungen führen, die Volkswirtschaften langfristig schaden, nicht nutzen.
Referenzen
Bodkin, R. G., Klein, L. R., & Marwah, K. (Eds.). (1991). A History of Macroeconometric Model-Building. Aldershot: Edward Elgar Publishing Ltd.
Friedman, M. (1953). The Methodology of Positive Economics. In Essays in Positive Economics (pp. 3–43). Chicago and London: The University of Chicago Press.
Frisch, R. (1926). Sur un problème d’économie pure. Norsk Matematisk Forenings Skrifter, Series 1(16), 1–40.
Hurtado, S. (2014). DSGE models and the Lucas critique. Economic Modelling, 44, S12–S19. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2013.12.002
——————————————————————————————————————————————————————————–
Karl-Friedrich Israel, 28, hat Volkswirtschaftslehre, Angewandte Mathematik und Statistik an der Humboldt-Universität zu Berlin, der ENSAE ParisTech und der Universität Oxford studiert. Zur Zeit absolviert er ein Doktorstudium an der Universität Angers in Frankreich.
*****
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Institut Deutschland wieder.