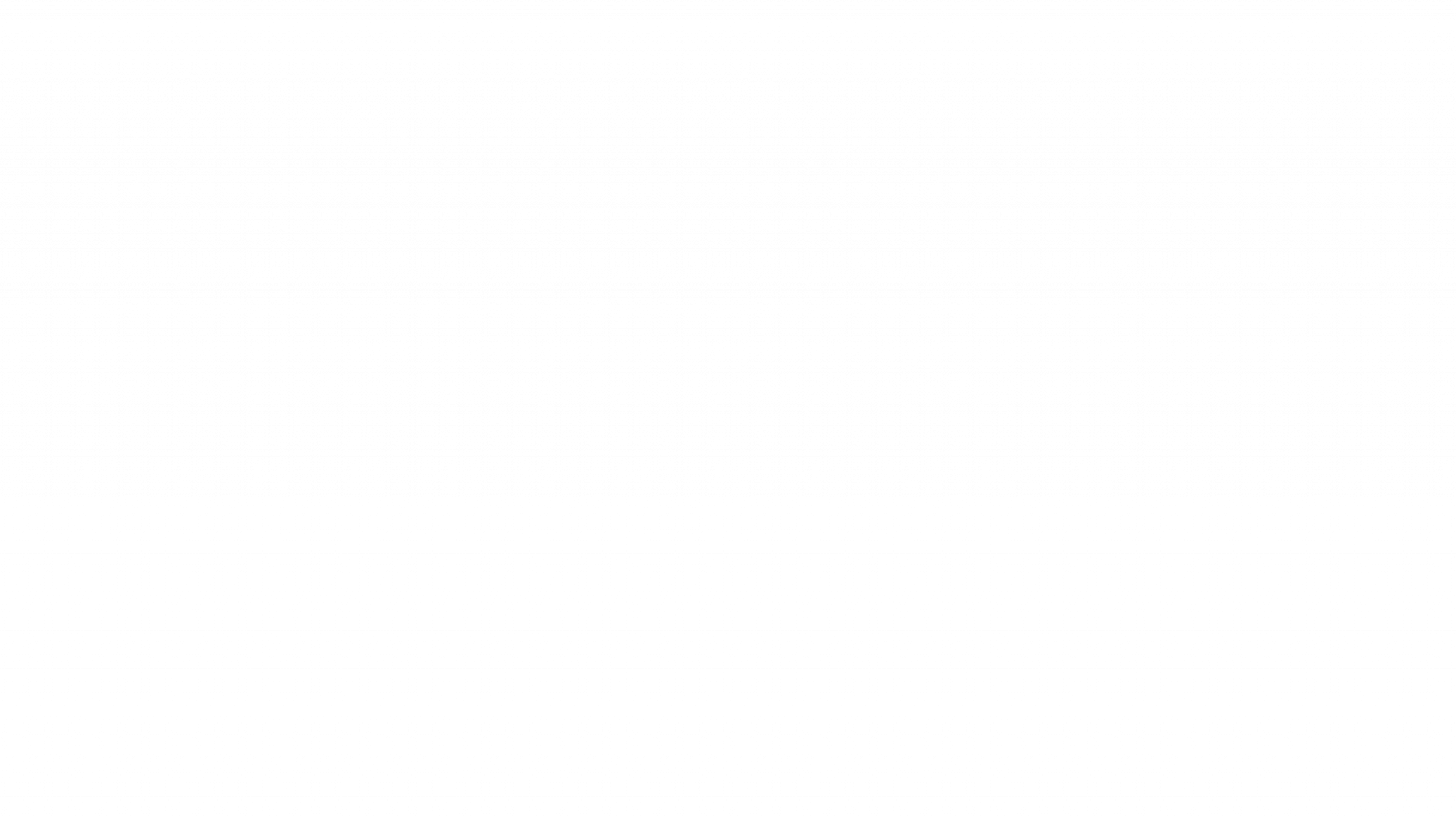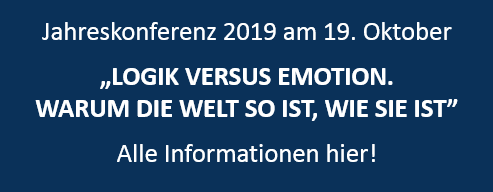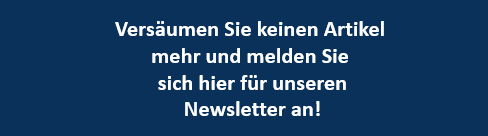Die Unmöglichkeit der Gleichheit
9. September 2019 – von Murray N. Rothbard
[Entnommen aus Kapitel 7 von „Man, Economy an State“]

Murray N. Rothbard (1926 – 1995)
Die wohl häufigste ethische Kritik an der Marktwirtschaft ist, dass sie das Ziel der Gleichheit nicht erreicht. Gleichheit wird in verschiedenen „wirtschaftlichen“ Bereichen befürwortet, wie z.B. bei der sozialen Sicherung oder dem abnehmenden Grenznutzen von Geld (siehe das vorherige Kapitel über Steuern). Aber in den letzten Jahren haben Ökonomen erkannt, dass sie Gleichmacherei (Egalitarismus) auf wirtschaftswissenschaftlicher Basis nicht begründen können und dass sie letztlich eine ethische Begründung für Gleichheit benötigen.
Zwar lassen sich mit der Volkswirtschaftslehre oder der Lehre vom menschlichen Handeln (Praxeologie) keine Aussagen zu der Gültigkeit ethischer Wertevorstellungen machen, aber auch ethische Ziele müssen zweckmäßig gestaltet werden. Sie müssen daher den praxeologischen Test als in sich stimmig und überhaupt erreichbar erfüllen. Die Kernbausteine der „Gleichheit“ wurden daraufhin bisher nicht ausreichend untersucht.
Unbestreitbar wurden schon viele Einwände vorgebracht, die die Verfechter der Gleichheit verstummen ließen. Manchmal führt die Einsicht in die unausweichlichen Folgen ihrer Politik dazu, dass gleichmacherische Konzepte fallen gelassen werden. In den meisten Fällen jedoch werden diese nur verlangsamt. Das bedeutet, erzwungene Gleichmacherei erstickt nachweislich die Leistungsanreize, unterbindet marktwirtschaftliche Anpassungsprozesse, zerstört die effiziente Befriedigung von Verbraucherwünschen, reduziert die Kapitalbildung und verursacht Kapitalverzehr. Alles Effekte, die einen drastischen Rückgang des allgemeinen Lebensstandards zur Folge haben. Darüber hinaus gibt es nur in einer freien Gesellschaft keine Kasten und deshalb ermöglicht nur die Freiheit die Einkommensverteilung nach dem Leistungsprinzip. Staatlicher Dirigismus hingegen würde die Wirtschaft in eine Form der (unproduktiven) Ungleichheit einfrieren.
Doch diese Argumente, obwohl sie stichhaltig sind, sind für viele nicht ausschlaggebend. Einige Menschen werden so oder so Gleichheit anstreben. Viele werden diese Überlegungen berücksichtigen und sich mit einigen Kürzungen des Lebensstandards zufrieden geben, um mehr Gleichheit zu erreichen.
In allen Diskussionen über Gleichheit gilt sie wie selbstverständlich als ein erstrebenswertes Ziel. Aber das ist keineswegs selbstverständlich. Denn zu allererst steht die Gleichheit an sich zur Debatte. Die Lehren der Praxeologie leiten sich aus drei allgemein gültigen Grundsätzen (Axiomen) ab: Dem Hauptaxiom der Existenz von zielgerichtetem, menschlichem Handeln und zwei kleineren Postulaten (oder Axiomen) der Verschiedenartigkeit menschlicher Fähigkeiten und natürlicher Rohstoffe sowie dem Arbeitsleid. Obwohl es möglich ist, eine ökonomische Gesellschaftstheorie ohne diese beiden kleinen Axiome (aber eben nicht ohne das Hauptaxiom) zu entwickeln, werden sie mit einbezogen, um unsere Theorie auf Gesetzmäßigkeiten zu beschränken, die direkt auf die Wirklichkeit anwendbar sind.[1] Jeder, der eine Theorie für austauschbare Menschen aufstellen will, ist dazu eingeladen.
Die Verschiedenartigkeit der Menschen ist somit ein grundlegendes Postulat unseres Wissens über die Menschheit. Aber wenn die Menschen verschieden und individuell sind, wie kann dann jemand Gleichheit als Ideal vorschlagen? Jedes Jahr veranstalten Wissenschaftler Konferenzen zur Gleichheit und fordern mehr davon, aber niemand stellt den Grundgedanken an sich in Frage. Aber welche Rechtfertigung kann Gleichheit in der Natur des Menschen finden? Wenn jeder Mensch einzigartig ist, wie sonst kann man ihn mit anderen „gleich“ machen, außer indem man das meiste von dem, was ihn menschlich macht, zerstört und die menschliche Gesellschaft auf die geistlose Gleichförmigkeit eines Ameisenhaufens reduziert? Es ist die Pflicht des Gleichmachers, der selbstbewusst hervortritt und den Ökonomen über sein oberstes ethisches Ziel belehrt, seinen Standpunkt zu beweisen. Er muss zeigen, wie Gleichheit mit der Natur des Menschen vereinbar sein kann, und die Machbarkeit einer möglichen gleichmacherischen Welt verteidigen.
Aber der Verfechter der Gleichheit befindet sich in noch schärferer Notlage, denn es lässt sich zeigen, dass die Einkommensgleichheit ein unmögliches Ziel für die Menschheit ist. Das Einkommen kann nie gleich sein. Einkommen muss natürlich realer und nicht bloß geldwerter Art sein, sonst gäbe es keine echte Gleichstellung. Doch das reale Einkommen kann nie gleichgemacht werden. Denn wie kann der Genuss eines New Yorkers an der Skyline Manhattans mit dem eines Inders gleichgemacht werden? Wie kann der New Yorker sich bei einem Bad im Ganges so wohl fühlen wie ein Inder? Da sich jeder Einzelne notwendigerweise in einer anderen Lage befindet, muss sich das reale Einkommen jedes Einzelnen von Gut zu Gut und von Person zu Person unterscheiden. Es gibt schlicht keine Möglichkeit, Waren verschiedener Art zu kombinieren und ein gewisses Einkommensniveau zu messen. Daher ist es unsinnig zu versuchen, auf eine Art „gleiches“ Niveau zu gelangen. Es ist eine unumgängliche Tatsache, dass Gleichheit nicht erreicht werden kann, weil schon die Idee an sich ein unmögliches Ziel für den Menschen aufgrund seiner gegebenen regionalen Verstreuung und individueller Vielfalt darstellt. Aber wenn Gleichheit selbst schon ein widersprüchliches (und damit vernunftwidriges) Ziel ist, dann ist jeder Versuch, sich der Gleichheit zu nähern, entsprechend abwegig. Wenn ein Ziel sinnlos ist, dann ist auch jeder Versuch, es zu erreichen, sinnlos.
Viele Menschen glauben, weil die Einkommensgleichheit ein unsinniges Leitbild ist, können sie es durch das Leitbild der Chancengleichheit ersetzen. Doch auch das ist ein genauso hohles Konzept wie das andere. Wie kann die Chance des New Yorkers und des Inders, Manhattan zu umsegeln oder im Ganges zu schwimmen, „ausgeglichen“ werden? Die unausweichlichen regionalen Unterschiede der Menschen schließen jede Möglichkeit des Ausgleichs von „Chancen“ effektiv aus.
Blum und Kalven unterliegen einem häufigen Fehler,[2] wenn sie behaupten, dass Gerechtigkeit Chancengleichheit bedeutet und dass diese Gleichheit voraussetzt, dass „die Teilnehmer vom gleichen Startpunkt starten“, damit das „Spiel“ „gerecht“ ist. Das menschliche Leben ist aber kein Rennen oder Spiel, bei dem jeder von einem gleichen Startpunkt beginnen sollte. Es ist der Versuch eines jeden Menschen, so glücklich wie möglich zu sein. Und jeder Mensch kann nicht von demselben Punkt aus beginnen, denn die Welt ist kein eigenschaftsleerer Raum, sie ist vielgestaltig und unterscheidet sich von Ort zu Ort. Die bloße Tatsache, dass ein Individuum notwendigerweise an einem anderen Ort als ein anderes geboren wird, bewirkt unmittelbar, dass seine vererbten Chancen nicht die gleichen sein können wie die seines Nachbarn. Das Streben nach Chancengleichheit würde auch die Abschaffung der Familie erfordern, da unterschiedliche Eltern ungleiche Fähigkeiten haben. Kindern müssten demnach durch die Gemeinschaft erzogen werden. Der Staat müsste alle Neugeborenen verstaatlichen und unter „gleichen“ Bedingungen in staatlichen Kindertagesstätten aufziehen. Aber auch hier sind die Bedingungen nicht gleich, denn verschiedene Staatsbedienstete werden selbst unterschiedliche Fähigkeiten und Persönlichkeiten haben. Und Gleichheit kann niemals erreicht werden, weil es notwendige Standortunterschiede gibt.
Dem Verfechter der Gleichheit darf es daher nicht länger erlaubt sein, die Diskussion zu beenden, indem er einfach Gleichheit als absolutes ethisches Ziel verkündet. Er muss sich zunächst allen sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Gleichmacherei stellen und versuchen zu zeigen, dass sie nicht im Widerspruch zur grundlegenden Natur des Menschen stehen. Er muss den Einwand widerlegen, dass der Mensch nicht für eine erzwungene Ameisenhaufenexistenz geschaffen ist. Und schließlich muss er erkennen, dass die Ziele der Einkommens- und der Chancengleichheit an sich nicht umsetzbar und damit unsinnig sind. Jeder Drang, sie zu erreichen, ist folglich ebenfalls unsinnig.
Die Gleichmacherei ist daher buchstäblich eine sinnlose Sozialphilosophie. Ihre einzige sinnvolle Ausformulierung ist das Ziel der „Gleichheit der Freiheit“ – formuliert von Herbert Spencer in seinem berühmten Gesetz der gleichen Freiheit: „Jeder Mensch hat die Freiheit, alles zu tun, was er will, sofern er nicht gegen die gleiche Freiheit eines anderen Menschen verstößt.“[3]
Diese Zielsetzung versucht nicht, den Gesamtzustand jedes Einzelnen gleich zu machen, denn das ist ein absolut unmögliches Unterfangen. Sondern befürwortet vielmehr die Freiheit – einen Zustand der Abwesenheit von Zwang über andere Person und deren Eigentum.[4]
Doch auch diese Fassung der Gleichheit hat viele Mängel und kann erkenntnisbringend verworfen werden. Erstens öffnet sie die Tür für Mehrdeutigkeit und Gleichmacherei. Zweitens kennzeichnet der Begriff „Gleichheit“ messbare Übereinstimmung mit einer festen, bestimmten Einheit. „Gleiche Länge“ bezeichnet die Übereinstimmung einer Messung mit einer objektiv bestimmbaren Einheit. In der Lehre vom menschlichen Handeln, sei es in der Praxeologie oder in der Sozialphilosophie, gibt es keine solche mengenmäßige Einheit, und daher kann es keine solche „Gleichheit“ geben. Es ist viel besser zu sagen, dass „jeder Mensch X haben sollte“, als zu sagen, dass „alle Menschen in X gleich sein sollten.“ Wenn jemand alle Menschen zum Kauf eines Autos drängen will, formuliert er sein Ziel auf diese Weise: „Jeder sollte ein Auto kaufen“, und nicht in solchen Worten wie: „Alle sollten die Gleichheit beim Autokauf haben.“ Die Verwendung des Begriffs „Gleichheit“ ist sowohl unangenehm als auch irreführend.
Und schließlich, wie Clara Dixon Davidson vor vielen Jahren so überzeugend betonte, ist Spencers Gesetz der gleichen Freiheit überflüssig. Denn wenn jeder Mensch die Freiheit hat, alles zu tun, was er will, folgt aus dieser Annahme, dass die Freiheit keines Menschen missachtet oder angegriffen wurde. Der ganze zweite Abschnitt des Gesetzes nach „was er will“ ist überflüssig und unnötig.[5] Seit seiner Veröffentlichung haben Gegner von Spencer den Qualifizierungsabschnitt in seinem Gesetz genutzt, um Löcher in die libertäre Philosophie zu bohren. Doch die ganze Zeit über zielten sie auf eine Einschränkung und nicht auf das Wesentliche des Gesetzes. Das Konzept der „Gleichheit“ hat keinen rechtmäßigen Platz im „Gesetz der gleichen Freiheit“, das durch den logischen Zusatz „jeder“ ersetzt werden kann. Das „Gesetz der gleichen Freiheit“ könnte durchaus in das „Gesetz der totalen Freiheit“ umbenannt werden.
[1] Für eine weiterführende Behandlung dieser Axiome, siehe Rothbard (1957): In Defense of Extreme Apriorism, Southern Economic Journal, S. 314–20.
[2] Blum and Kalven: Uneasy Case for Progressive Taxation, S. 501ff.
[3] Spencer, Social Statics, p. 121.
[4] Dieses Ziel wurde manchmal als „Gleichheit vor dem Gesetz“ oder „Gleichheit der Rechte“ bezeichnet. Beide Formulierungen sind jedoch mehrdeutig und irreführend. Ersteres könnte als sowohl als Gleichheit von Sklaverei und als auch als Gleichheit von Freiheit verstanden werden und wurde in den letzten Jahren sogar so stark eingeschränkt, dass es von untergeordneter Bedeutung ist. Bei letzterem kann jede Art von „Recht“ hineingedeutet werden, einschließlich des „Rechts auf ein gleiches Einkommen“.
[5] „… der erste Teil beinhaltet bereits das was folgt. Denn wenn jemand die Freiheit eines anderen verletzt, wären nicht alle gleich frei.“ Clara Dixon Davidson (1892): Liberty, September 3, 1892; zitiert nach Benjamin R. Tucker (1893): Instead of a Book, New York: Benjamin R. Tucker, S. 137. Davidsons Aussage wurde völlig übergangen.
*****
Aus dem Englischen übersetzt von Arno Stöcker. Der Originalbeitrag mit dem Titel The Impossibility of Equality ist am 21.8.2019 auf der website des Mises-Institute, Auburn, US Alabama erschienen.
Murray N. Rothbard wurde 1926 in New York geboren, wo er an der dortigen Universität Schüler von Ludwig von Mises wurde. Rothbard, der 1962 in seinem Werk Man, Economy, and State die Misesianische Theorie noch einmal grundlegend zusammenfasste, hat selbst diese letzte Aufgabe, die Mises dem Staat zubilligt, einer mehr als kritischen Überprüfung unterzogen.
*****
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Institut Deutschland wieder.
Foto: Adobe