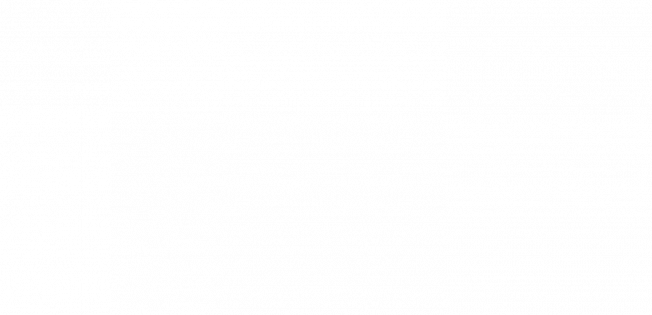Der sogenannte Keynesianische Ausgabenmultiplikator
11.9.2015 – von Eduard Braun.
Auch wenn er einige Vorgänger hatte, so war es doch hauptsächlich John Maynard Keynes, der in seinem Hauptwerk „Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes“ von 1936 den Ausgabenmultiplikator salonfähig und populär gemacht hat. Heutzutage ist der nach ihm benannte Keynesianische Multiplikator jedem Studenten der Wirtschaftswissenschaften ein Begriff. Auch fleißige Leser der Wirtschaftsnachrichten dürften dieses Konzept zumindest oberflächlich kennen, beruhen darauf doch nicht zuletzt zahlreiche wirtschaftspolitische Empfehlungen des Wirtschaftsnobelpreisträgers Paul Krugman.
Im Kern besagt der Keynesianische Multiplikator, daß eine Erhöhung der gesamtgesellschaftlichen Ausgaben um einen bestimmten Betrag das Sozialprodukt um ein Vielfaches dieses Betrages ansteigen läßt. Prinzipiell ist es egal, ob es sich hierbei um Ausgaben für den Konsum oder für Investitionen handelt, und ob sie von Privaten oder vom Staat getätigt werden. Bedeutsam ist der Multiplikator aber vor allem im Hinblick auf staatliche Eingriffe. Zahlreiche expansive wirtschaftspolitische Maßnahmen erscheinen im Rahmen dieses theoretischen Konzepts in einem besonders günstigen Licht, da ihre Wirkung sozusagen multipliziert wird.
Es ist davon auszugehen, daß der Keynesianische Ausgabenmultiplikator und das dazugehörige Modell für viele Betriebs-, aber auch Volkswirte so ziemlich das einzige sein dürften, was sie aus der Universität in Bezug auf Konjunkturpolitik in ihr späteres Leben mitnehmen. Der vorliegende Artikel hat es sich zur Aufgabe gemacht, ohne großen gesellschaftspolitischen Kommentar darzulegen, was hinter dieser sehr zentralen Theorie eigentlich steckt.
Der Ausgangspunkt des Multiplikators ist der normale volkswirtschaftliche Kreislauf. Wenn ich mein Einkommen zum Bäcker trage, wird das Geld dort zum Einkommen des Bäckers und seiner Angestellten und Vorleister. Wenn diese Personen ihr Einkommen ihrerseits ausgeben, wird das Geld zum Einkommen weiterer Personen usw. Jeder einzelne Euro zirkuliert in der Volkswirtschaft, wird von Person zu Person und von Unternehmen zu Unternehmen weitergegeben. Solange diese Zirkulation funktioniert, weil der Geldwert stabil ist und die Menschen sich gegenseitig vertrauen, wird das immer so weitergehen. Es handelt sich eben im übertragenen Sinne um einen Kreislauf. Unter anderem bedeutet das, daß jeder Euro innerhalb eines Jahres nicht nur einen Euro an Einkommen vermittelt, sondern deren mehrere. Wie viele es genau sind, gibt die sogenannte „Einkommensgeschwindigkeit des Geldes“ an. Beträgt diese z.B. zehn, dann vermittelt eine Geldmenge von 100 Millionen Euro jährlich eine Milliarde Euro an Einkommen.
Laut Keynes besteht jetzt aber unglücklicherweise folgendes Problem. Die Menschen leiden an einer Ausgabenphobie. Ein fundamentales, das heißt allgemeingültiges psychologisches Gesetz hindert sie daran, ihr ganzes Einkommen auszugeben, das heißt wieder in den Kreislauf zurückzugeben. In den Lehrbüchern wird meistens davon ausgegangen, daß nur ca. drei Viertel oder 75 Prozent des Einkommens wieder für Konsumzwecke ausgegeben werden. Die restlichen 25 Prozent werden gehortet und bleiben dem Kreislauf somit entzogen. Da Einkommen in Geld bezahlt wird, bedeutet das, daß sich die zirkulierende Geldmenge in jeder Periode um ungefähr 25 Prozent verringert. Der Kreislauf trocknet über kurz oder lang aus.
In anderen Worten: In der keynesianischen Auffassung gibt es eigentlich gar keinen Wirtschaftskreislauf. Aufgrund eines allgemeingültigen psychologischen Gesetzes ist in unsere Wirtschaft ein Leck eingebaut, das aus dem Kreislauf so etwas wie eine auslaufende Badewanne macht.
Was in der Argumentation nun als nächstes kommen muß, wenn man einen derart versiegenden Kreislauf annimmt, ist klar. Das Leck muß irgendwie gestopft werden. Die Ausgabenphobie der normalen Bevölkerung als (laut Keynes) eigentliche Ursache kann dabei offenbar nicht beseitigt werden, da sie fundamental im Menschen verankert ist. Als Lösung bleibt daher nur übrig, den ständigen Abfluß des Geldes in die Horte zu kompensieren. Das ist nun, so Keynes, tatsächlich möglich, und zwar durch sogenannte exogene oder autonome Ausgaben. Es gibt außerhalb des volkswirtschaftlichen Kreislaufes mehrere Ausgabequellen, welche die Geldmenge wieder auffüllen und somit ein Versiegen des Kreislaufs verhindern können.
Eine dieser Quellen ist der sogenannte „autonome Konsum“, also private Konsumausgaben, die unabhängig vom Einkommen sind. Woher das Geld kommen soll, das hierfür benötigt wird, ob aus Krediten oder Sozialhilfe, und wer hinwiederum diese finanziert, wird allerdings nicht geklärt. Viel wichtigere Quellen solcher exogenen Ausgaben sind jedoch die privaten Investitionen und die Staatsausgaben.
Wie es der Zufall oder der Teufel will, sind gerade diese beiden wichtigen Quellen exogener Ausgaben äußerst zugänglich für eine wirtschaftspolitische Einflußnahme. Private Investitionen können durch eine Leitzinssenkung der Zentralbank und die damit verbundene Geldmengen- und Kreditausdehnung des Bankensystems angekurbelt und finanziert werden. Daß Staatsausgaben durch Kreditaufnahme erhöht werden können und somit eine Quelle exogener Ausgaben darstellen, versteht sich von selbst.
Angesichts des undichten Kreislaufs, den Keynes annimmt, muß es nun zunächst einmal das Ziel der Wirtschaftspolitik sein, in jeder Periode genau soviel Geld wieder in den Kreislauf hineinzupumpen, wie aufgrund der Ausgabenphobie in der Horte verschwindet. Wenn in jeder Periode 25 Prozent des Einkommens einer Gesellschaft gehortet werden, müssen auf der anderen Seite wieder genau diese 25 Prozent in Form neu geschaffenen Geldes hineinfließen. Damit das gesamtgesellschaftliche Einkommen – das Sozialprodukt – überhaupt nur konstant bleiben kann, muß also in jeder Periode ca. ein Viertel des Sozialprodukts in Form von exogenen oder autonomen Ausgaben von außen in den Kreislauf eingeschossen werden, wobei hier natürlich im wesentlichen Staatsausgaben und von der Zentralbank angekurbelte private Investitionen in Frage kommen.
Wenn das Sozialprodukt 400 Milliarden beträgt, um ein Beispiel zu nennen, müssen pro Periode – sagen wir jährlich – 100 Milliarden exogene Ausgaben generiert werden, um die Wirtschaft stabil zu halten. Im Grunde beschreibt das keynesianische Modell also katastrophale Zustände. Der volkswirtschaftliche Kreislauf ist von Haus aus massiv gestört und kann nur durch hohe und permanente Eingriffe von außen aufrechterhalten werden.
Im keynesianischen Modell haben die Wirtschaftspolitik und der Staat demnach äußerst ausgedehnte Aufgaben. Sie sollen nicht nur für einen sicheren gesellschaftlichen Rahmen und eine funktionierende Rechtsordnung sorgen, wie es die Ordoliberalen fordern; sie sollen auch nicht nur öffentliche Güter wie Straßen, Schulen und die Polizei bereitstellen, wie das auch schon vor Keynes von vielen Volkswirten befürwortet worden war; nein, der Wirtschaftspolitik kommt in der keynesianischen Auffassung die Aufgabe zu, die gesamte Wirtschaftstätigkeit einer Gesellschaft vor dem Zusammenbruch zu bewahren.
Und dieses Ergebnis muß teuer erkauft werden! Wie wir eben gesehen haben, müssen bei einer Hortquote von 25 Prozent, die durchaus dem entspricht, was in vielen Lehrbüchern angenommenen wird, jedes Jahr 100 Milliarden Euro exogen zugeschossen werden, damit ein Sozialprodukt in Höhe von 400 Milliarden erhalten werden kann. Ein pessimistischerer Standpunkt kann eigentlich fast gar nicht eingenommen werden.
Wie schafft es Keynes nun, auf dieser extrem pessimistischen Grundauffassung ein allgemein als sehr optimistisch beurteiltes Konzept aufzubauen, nämlich den Ausgabenmultiplikator? Hierzu müssen wir einfach nur die Perspektive wechseln. Anstatt zu sagen, daß 100 Milliarden jährlich ausgegeben werden müssen, um das Sozialprodukt bei 400 Milliarden stabil zu halten, könnten wir das ganze auch so formulieren: Um ein Sozialprodukt von 400 Milliarden zu generieren, ist es gar nicht nötig, daß der Staat jährlich 400 Milliarden an Ausgaben induziert. Es genügen schon 100 Milliarden! Diese 100 Milliarden werden wie durch ein Wunder multipliziert, in unserem Beispiel vervierfacht. Der Multiplikator beträgt somit vier. Und wenn ich nun die Staatsausgaben noch einmal um eine Milliarde erhöhe, erhöht sich das Sozialprodukt um vier Milliarden. Voilà, eine wunderbare Rechtfertigung für eine Erhöhung der Staatsausgaben!
Wenn man sich die Geschichte so zurechtlegt, erscheint der Multiplikator tatsächlich als ein optimistisches Konzept. Eine Vervierfachung der Wirkung der Staatsausgaben hört sich nun einmal nicht schlecht an. Aber in Wahrheit geht es nur darum, ein Leck zu stopfen, das dem Wirtschaftskreislauf annahmegemäß inhärent ist. Nur aus dem Grund, daß bei einem Sozialprodukt von 400 Milliarden jährlich 100 Milliarden heraussickern, muß die Wirtschaftspolitik überhaupt erst wieder 100 Milliarden hineinpumpen! Hier von einem Multiplikator zu sprechen, nur weil nicht die ganzen 400 Milliarden des Sozialprodukts in die Horte fließen, und somit auch nicht 400 Milliarden ausgegeben werden müssen, um das Sozialprodukt aufrechtzuerhalten, sondern nur 100 Milliarden, ist ein Euphemismus, wie er seinesgleichen selbst in den Wirtschaftswissenschaften sucht.
„Ausgabenmultiplikator“ ist eine völlige Fehlbezeichnung. Zusätzliche Staatsausgaben werden keineswegs multipliziert. Das entsprechend geschaffene Geld versickert einfach nur nicht unendlich schnell, sondern verbleibt für einige Jahre im Kreislauf – jedes Jahr versickern ja „nur“ 25 Prozent davon in der Horte. Wenn also im folgenden Jahr weiterhin Staatsausgaben getätigt werden, kommen diese zu den verbliebenen 75 Prozent aus dem Vorjahr hinzu, wodurch sich die Wirkung ein klein wenig aufschaukelt. Auf diese Weise kann es, wenn Staatsausgaben erhöht werden, für kurze Zeiträume zu einer Situation kommen, in der mehr in die Wirtschaft hineingepumpt wird, als auf der anderen Seite heraussickert. Das ändert aber nichts an dem Grundprinzip, wonach die exogenen Ausgaben nur dazu da sind, ein Leck im Kreislauf zu stopfen.
Wir sehen also folgendes: Der keynesianische Multiplikator ist im Grunde genommen kein optimistisches Konzept. Vielmehr beruht er auf einem Modell, das ein extrem pessimistisches Bild des Wirtschaftskreislaufs zeichnet. Weil die Bevölkerung nicht ihr gesamtes Einkommen ausgibt, sondern einen Teil davon hortet, befinden wir uns ständig in der Gefahr eines vollkommenen Zusammenbruchs der Wirtschaft. Staats- und andere exogene Ausgaben haben die Aufgabe, diesen drohenden Zusammenbruch zu verhindern. Ohne sie wäre die gesamte Geldmenge binnen weniger Jahre versickert und das Sozialprodukt läge im Extremfall bei null.
Die Begründung expansiver Wirtschaftspolitik, die vom keynesianischen Modell geliefert wird, liegt somit nicht in der sagenhaften, sich selbst multiplizierenden Wirkung zusätzlicher Ausgaben, auch wenn dahin die Behauptungen gehen und sich sogar der Name des Multiplikators davon ableitet. Das Entscheidende ist vielmehr die dem Modell zugrundeliegenden Annahme, daß unser Wirtschaftssystem eigentlich vollkommen instabil ist und nur durch permanente Zuschüsse von außen daran gehindert werden kann, zusammenzubrechen. Daß diese Prämisse in den Lehrbüchern nicht offen ausgesprochen wird, sollte zu denken geben.
Wie realistisch ist nun die Annahme, daß ein großer Bestandteil aller Einkommen (in unserem Beispiel 25 Prozent) in der Horte landet? Mit ihr steht und fällt das gesamte Modell samt Multiplikator. Dazu ist nur folgendes zu sagen: Das keynesianische Modell ignoriert vollständig den Finanzmarkt und damit die Tatsache, daß die 25 Prozent des Einkommens, die nicht für Konsum ausgegeben werden, im Regelfall auf dem Bankkonto landen, von wo aus sie die Kreditvergabe der Banken ermöglichen. Diese Kredite führen selbstverständlich ebenfalls zu Ausgaben, sei es für Investitionen oder Konsum. Von einem allgemeinen Versickern des Wirtschaftskreislaufs kann keinesfalls die Rede sein. Warum es trotzdem zu einem derart vernichtenden Ausgabenleck kommen sollte, wie es für das Konzept des Multiplikators angenommen werden muß, ist schleierhaft. Die Annahme, wonach bei jeder Einkommenszahlung – im Grunde genommen also jeden Monat – ein großer Bestandteil der Geldmenge einfach im Nichts verschwindet, ist jedenfalls völlig unrealistisch und bedürfte einer deutlich eingehenderen, ja überhaupt erst einmal einer Begründung.
Nachsatz: Einige Leser werden sich vielleicht darüber wundern, daß ich im vorhergehenden die exogenen Ausgaben mit einer Erhöhung der Geldmenge gleichsetze, was keineswegs der üblichen Praxis in den Lehrbüchern entspricht. Schließlich muß es sich ja um ungeheure Summen handeln, wenn 25 Prozent des Sozialprodukts in Form von Geld in der Horte verschwinden und auf der anderen Seite wieder in den Kreislauf hineingepumpt werden sollen. Der Grund hierfür ist darin zu suchen, daß die Lehrbücher über diese Frage stillschweigend hinweggehen und ansonsten keine andere Interpretation zulassen. Auch einigen Post-Keynesianer ist aufgefallen, daß hier eine Lücke in den Modellen besteht, und daß bei einem angenommenen Abfluß von Geld in die Horte gar keine andere Möglichkeit besteht, als die Finanzierung der exogenen Ausgaben durch von außen neu hinzukommendes Geld zu bewerkstelligen.[1]
Bei der oben vorgetragene Analyse des Multiplikators handelt es sich ansonsten um eine freie Interpretation der weitgehend unbekannten Arbeiten von Alexander Mahr, Vera Lutz und Otto Kraus, die sich bereits in der Mitte des 20. Jahrhunderts mit diesen Ungereimtheiten des Multiplikatorkonzepts auseinandergesetzt haben.[2]
*****
[1] Vgl. z.B. Moore, B. J.: The demise of the Keynesian multiplier revisited, in: Gnos, C. und Rochon, L.-P. (Hrsg.): The Keynesian Multiplier. London und New York: Routledge, 2008, S. 120-126, hier S. 124.
[2] Vgl. Mahr, A.: Multiplikatorprinzip und Einkommenskreislauf, in: Gesammelte Abhandlungen zur ökonomischen Theorie. Berlin: Duncker & Humblot, 1967, S. 196-205.
Kraus, O.: Konjunktur und Beschäftigung. München: Max Hueber, 1954, hier S. 71-76.
Lutz, V.: Multiplier and Velocity Analysis: A Marriage, in: Economica (New Series) 22 (85),1955, S. 29-44.
————————————————————————————————————————————————————————
Dr. Eduard Braun hat im Jahr 2011 bei Professor Dr. Jörg Guido Hülsmann an der Universität Angers (Frankreich) promoviert und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Professor Dr. Mathias Erlei, Abteilung für Volkswirtschaftslehre, an der Universität Clausthal-Zellerfeld, (http://www.wiwi.tu-clausthal.de/index.php?id=430).
Zuletzt erschien sein Buch Finance Behind the Veil of Money.