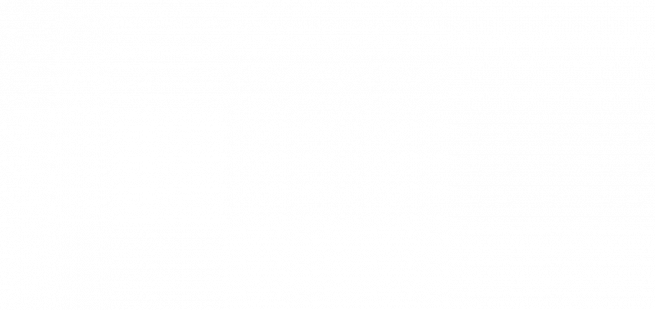Osteuropas Sozialismus-Albtraum
29.11.2017 – von James Bovard.
In diesem Monat jährt sich die Machtergreifung der kommunistischen Partei in Petrograd, Russland, zum 100. mal. Der Kolumnist des britischen Guardian, Paul Mason, behauptete kürzlich, die Sowjetrevolution sei „ein, wenn auch nur kurzlebiges, Leuchtfeuer für den Rest der Menschheit gewesen“. Die New York Times hat die Machtergreifung der Sowjets in einer Artikelserie über das „rote Jahrhundert“ verklärt und sogar behauptet, „Frauen hätten im Kommunismus besseren Sex“ (gestützt auf einen einzigen, zweifelhaften Vergleich der Orgasmuszahlen zwischen ost- und westdeutschen Frauen.)
Der Artikel von Professor Hunt Tooley am ersten November auf der Seite des Mises Institute führt die erschreckend hohen Todeszahlen, die der Kommunismus in Russland und anderswo verursacht hat, vor Augen. Stalin hat angeblich gesagt, ein Toter sei eine Tragödie, eine Million Tote dagegen seien Statistik.
Die Zahl der Todesopfer alleine macht jedoch nicht den ganzen Albtraum des Kommunismus begreifbar – dazu kommen noch die Erniedrigungen, die die Opfer tagtäglich erdulden mussten. Mitte der 1980er gab es jede Menge Journalisten in den Westmedien, die die Sowjetunion „schönschrieben und schönredeten“. Wirklich jede Reform im Ostblock wurde als der Durchbruch zu anhaltendem wirtschaftlichen Fortschritt gefeiert. Es war mir ein Rätsel, wie Menschen, die in Freiheit lebten, ein System der staatlichen Sklaverei verehren konnten.
1986 und 1987 gelang es mir ein halbes Dutzend Mal, mich hinter den Eisernen Vorhang zu schmuggeln, um die wirtschaftliche Perversion und die politische Sklaverei zu studieren, während ich Artikel für die New York Times, das Wall Street Journal Europe, Freeman, das Journal of Economic Growth und anderen Publikationen verfasste. Meine letzte Reise im November 1987 begann in Budapest, um mich dann in das Reich des repressivsten Regimes Europas zu führen.
Der Zug von Budapest nach Bukarest in Rumänien wurde Orientexpress genannt. Der echte Orientexpress der 1880er verband Paris mit Konstantinopel. Bei seiner ersten Fahrt wurden unter anderem Austern, Suppe mit italienischen Pasta, Heilbutt mit Grüner Sauce, Hähnchen ‘à la chasseur’, Filetsteak mit ‘château’-Kartoffeln, ‘chaud-froid’ vom Wild, Schokoladenpudding und ein Dessertbuffet serviert. In der kommunistischen Version des Orientexpress in Rumänien gab es nichts zu essen, wenngleich es in Ungarn ein paar Häppchen gegeben hat.
 Ich hatte eine Kabine für mich alleine, als sich der Zug aus Budapest nach Südosten bewegte. Mir war berichtet worden, dass ich verhaftet oder mir die Einreise verweigert würde, sollten die Grenzbeamten Karten von Rumänien oder sonstige verdächtige Papiere bei mir finden. Während wir uns spät nachts der rumänischen Grenze näherten, studierte ich ein weiteres Mal Dokumente und prägte mir Dinge ein, nach denen ich Ausschau halten sollte, zerriss sie dann und warf sie einzeln aus dem Zugfenster.
Ich hatte eine Kabine für mich alleine, als sich der Zug aus Budapest nach Südosten bewegte. Mir war berichtet worden, dass ich verhaftet oder mir die Einreise verweigert würde, sollten die Grenzbeamten Karten von Rumänien oder sonstige verdächtige Papiere bei mir finden. Während wir uns spät nachts der rumänischen Grenze näherten, studierte ich ein weiteres Mal Dokumente und prägte mir Dinge ein, nach denen ich Ausschau halten sollte, zerriss sie dann und warf sie einzeln aus dem Zugfenster.
Kurz nach Mitternacht kam der Zug in Transsilvanien, an der Rumänisch-ungarischen Grenze, zum Stehen. Die Szenerie konnte stimmungsmäßig ohne Probleme mit dem Dracula-Film von 1931 mithalten. Ich hörte zwar keine Wölfe heulen, aber die umliegenden Berge, der Bodennebel und die Grenzposten, die mit Deutschen Schäferhunden pausenlos den Zug umkreisten, waren völlig ausreichend.
Meine Kabine wurde viermal durchsucht, wobei jedes Team das vorige zu übertreffen versuchte. Die Matratzen der Liegen wurden durchgeschüttelt, und praktisch jeder Kubikzentimeter Raum wurde gründlich durchforstet.
Die letzte Inspektion wurde von einem (nach kommunistischen Maßstäben) „süßen“ Offizier überwacht. Vielleicht dachten sich die Behörden, ich würde dem anderen Geschlecht meine Niedertracht eher gestehen. Dabei war ich doch nur ein Tourist auf dem Weg zum „Paris Osteuropas“, wie Bukarest sich in vorkommunistischen Zeiten gerne nannte. Zu meiner Zeit jedoch waren fast keine Touristen in dem Land, das damals eher „Äthiopien Europas“ genannt werden konnte. Ich betrat Rumänien illegal mit einem leicht zu erhaltenden Touristenvisum, anstatt mir den Ärger anzutun, der mit der Beantragung eines Journalistenvisums verbunden war (was außerdem mehr Überwachung bedeutet hätte).
Nach der abschließenden Durchsuchung versperrten die Grenzbeamten meine Kabine von außen. Der Pseudo-Luxuszug hatte sich damit offiziell in ein rollendes Gefängnis verwandelt. Mein US-Pass war einmal mehr der Grund für eine Sonderbehandlung. Ich lehnte mich zurück und genoss mein Privileg – in Westeuropa kostete eine Einzelkabine doppelt.
Der Orientexpress hörte nach der rumänischen Grenze auf, ein Express zu sein, und brauchte 13 Stunden für 640 Kilometer. Er blieb weit hinter dem Fahrplan zurück.
Die Zeichen eines Staates, der zunehmend Angst vor seinen Bürgern hatte, waren allgegenwärtig. In Transsilvanien waren Radiosendemasten von Stacheldraht und Wachsoldaten umgeben. Der Zug hielt in Brasov – eine mittelalterliche Stadt, die für kurze Zeit in Stalin-Stadt umbenannt worden war, bis sich die Beziehungen zu Moskau abzukühlen begannen. Kurz vor meiner Durchreise hatten dort tausende Arbeiter auf Lohnkürzungen damit reagiert, kommunistische Parteibüros zu verwüsten und zwei Milizionäre zu töten.
Es gab Pferdewagen neben dreckschleudernden Fabriken und gewaltigen Wohnblöcken. Zahlreiche Leute hatten ihre klapprigen Autos einfach am Straßenrand stehen gelassen, nachdem die Regierung kurzzeitig den Verkauf von Benzin für Privatfahrzeuge verboten hatte.
Gegen 9 Uhr am nächsten Morgen wurde leicht an meiner Tür gerüttelt, als ob mir jemand eine geheime Nachricht übermitteln wollte.
Ich hörte, wie sich jemand mit der versperrten Tür plagte, die bald aufsprang und einem halben Dutzend schlechtgekleideter rumänischer Arbeiter Zugang gewährte. Sie hatten gehört, ein Ausländer sei im Zug eingesperrt. Sie starrten mich an, als ob ich E.T. aus dem Weltall sei. Zwei Arbeiter beugten sich vor und berührten mit vor Erstaunen weit geöffneten Augen meine Lederstiefel. Lederstiefel waren dort anscheinend zu einem Luxusgut, ähnlich Nerzmänteln in den USA, geworden. In der vorkommunistischen Zeit waren Lederstiefel dagegen für Fabrik- und Landarbeiter vermutlich Gang und Gäbe gewesen. Wir verständigten uns mit einfacher Zeichensprache, da ich nicht rumänisch sprach und sie kein Englisch. Sie schienen mir wohlgesonnen, verschwanden aber nach ein paar Minuten – vielleicht aus Angst, mit einem Ausländer gesehen zu werden.
Die Arbeiter waren wahrscheinlich keine Fans des kommunistischen Diktators Nicola Ceausescu, der entschlossen zu sein schien, die Menschen in die Unterwerfung zu hungern. Obwohl Rumänien vor dem Ersten Weltkrieg einer der weltweit größten Getreideexporteure gewesen war, waren Lebensmittel nun genau so selten wie korrekte Wirtschaftsdaten.
Kinder erhielten Milch nur auf ärztliches Rezept. Ausländern war es verboten, Lebensmittel nach Rumänien zu schicken. Auf Lebensmittelknappheit reagierte die Regierung mit einer Kampagne gegen die Gefahr, zu viel zu essen. Die Regierung warb auch im Ausland mit Rumäniens „weltberühmten“ Abnehmkliniken. Schließlich wurde die Lebensmittelknappheit so schlimm, dass der Löwe im Zoo von Bukarest zum unfreiwilligen Vegetarier wurde und deshalb seine Zähne verlor.
Die Kommunisten zerstörten hunderte Quadratkilometer bestes Ackerland, um darauf Fabriken und Tagebau-Minen zu errichten. Hunderte Dörfer wurden dem Erdboden gleichgemacht, die Einwohner wurden in Städten zusammengepfercht und für die Fabrikarbeit herangezogen. Die Regierung leitete fast alle Investitionen in die Schwerindustrie – die heilige Kuh aller kommunistischen Regimes. Aber ungefähr die Hälfte aller rumänischen Fabrikerzeugnisse war so minderwertig, dass sie gleich vom Fließband in die Mülltonne wanderte. Außerdem war die rumänische Industrie außerordentlich ineffizient und verbrauchte bis zu fünfmal so viel Energie wie vergleichbare westliche Fabriken. Die Regierung glich das aus, in dem sie Privathaushalten im Winter für bis zu sechs Stunden täglich den Strom abdrehte und nur eine 25-Watt-Glühbrine pro Raum gestattete.
Das Gesundheitssystem befand sich im freien Fall. Die Säuglingssterblichkeit war so hoch, dass die Regierung Kinder erst als geboren meldete, nachdem sie den ersten Monat überlebt hatten. Außerdem drehte die Regierung regelmäßig auch Krankenhäusern den Strom ab, was im vorigen Winter zu eintausend Todesfällen geführt hatte.
Und trotzdem verehrten einige westliche Experten Ceausescu als einen bahnbrechenden Visionär. Ein Bericht der Weltbank von 1979 mit dem Titel „Die Bedeutung zentraler Wirtschaftskontrolle“ lobte das rumänische Regime dafür, „Politiken zu verfolgen, die zum Ziel haben, die Bevölkerung besser als Produktionsfaktor zu nutzen“, in dem „Anreize für den Anstieg der Geburtenrate gesetzt werden“.
Und wie setzte der wohlwollende Herrscher dies um? Er verbot Verhütungsmittel und Abtreibungen. Weil der Plan nach höheren Geburtenraten verlangte, verwirkte jede Frau das Recht über ihren Körper und ihr Leben. So verkündete Ceausescu 1985: „Der Fötus ist Eigentum der Gesellschaft … Wer sich weigert, Kinder zu haben, ist ein Deserteur“. Der Staat zwang alle Frauen zwischen 18 und 40 zu einer monatlichen gynäkologischen Untersuchung, damit niemand den Staat mit einer geheimen Abtreibung betrog. Diese Politik verwandelte Rumänien in die weltweite Hauptstadt der ausgesetzten Kinder.
Endlich in Bukarest angekommen, fand ich heraus, dass Ausländer einzig im Hotel Intercontinental logieren durften. Nach dem Check-in kam eine bullige Frau Mitte 30 auf mich zu. Sie fragte mich mit Kettenraucherstimme: „Möchten Sie etwas Gesellschaft?“
„Wie bitte?“, fragte ich.
„Möchten Sie etwas Gesellschaft – auf ihrem Zimmer?“ Sie lächelte und deutete nach oben.
„Äh … nein danke, alles bestens.“
Sie fragte mit kehliger Stimme: „Warum sind Sie hier in Bukarest?“
„Ich bin Tourist.“
„Aber es ist so kalt draußen. Bleiben wir lieber drinnen. Sind Sie nicht einsam?“
Es gab etliche Gründe, warum ich ablehnte, von denen die Regel, nichts mit Frauen anzufangen, deren Schnurrbart meinen übertraf, nicht der unwichtigste war.
Die rumänische Regierung war dafür bekannt, Geheimdienstler als Prostituierte zu tarnen. Statt einer einfachen, ehrlichen Prostituierten war sie vermutlich eine Spionage-Prostituierte. Wenn ich bedachte, wie schlecht alles andere in diesem Land funktionierte, war mir nicht danach, herauszufinden, wie tief der rumänische Standard für „gut genug für Regierungs-Sexarbeit“ lag.
Ich bezog meinen Raum, der für Überwachung gebaut zu sein schien – es gab Hohlräume und nichtmarkierte Türen zwischen den Zimmern. Ich schaltete den Fernseher an und sah Chöre von Arbeitern und Bauern in Overalls, die lustlos Flaggen schwenkten und Loblieder auf Ceausescu, das „Genie der Karpaten“, sangen, während die Kamera auf das Gesicht des großen Mannes zoomte.
Faszinierende Bilder, aber die Story war so fadenscheinig, dass ich mich lieber nach anderweitiger Unterhaltung umsah.
Wenn ich eine neue Stadt besuche, spaziere ich gerne stundenlang herum, um ein Gefühl für sie zu bekommen. Ich fragte also den Concierge nach einer Straßenkarte von Bukarest. Ich dachte mir, er hätte vielleicht etwas wie einen Führer der größten Triumphe des Ceausescuismus im Umkreis um die Zentrale der kommunistischen Partei.
Der Concierge verzog schon in der Mitte meines Satzes das Gesicht. Dieser grauhäutige, knopfäugige Mann war hier beschäftigt, weil er einen natürlichen Hass auf die Menschheit ausstrahlte.
„Wofür brauchen Sie eine Karte?“
„Ich möchte die Attraktionen der Stadt besichtigen.“
„Wir haben keine Karten. Wenn Sie irgendwo hin möchten, fragen Sie mich, und ich sagen Ihnen, wie Sie dorthin kommen.“
„Wo ist die Altstadt?“ Ich fragte ihn in dem Wissen, dass der größte Teil davon eingeebnet worden war, um den hässlichsten Monolithen des „sozialistischen Realismus“ jenseits von Pjöngjang Platz zu machen.
Der Concierge machte ein finsteres Gesicht und murmelte irgendetwas – vermutlich ein rumänisches Schimpfwort für lästige Ausländer. Ich vermutete, Trinkgelder waren kein großer Teil seines Einkommens.
In den Straßen wichen viele Menschen meinen Blicken aus, als ob Blickkontakt mit Fremden Lepra verursachen würde. Ich hatte gehört, in Rumänien sei es ein Vergehen, mit Fremden zu sprechen. Aber ein paar Leute radebrechten ein paar englische Sätze, um eine Packung Kent-Zigaretten zu erbetteln, um Ärzte zur Behandlung ihrer kranken Kinder zu bestechen. Da die rumänische Währung praktisch wertlos war, wurden Kent-Zigaretten als Schwarzmarktwährung verwendet. Ich hatte mir vor meiner Reise nach Rumänien ein paar Kartons Kents gekauft und gab einigen Leuten, die mit mir sprachen, einige Packungen davon.
Ich betrat das größte Kaufhaus Bukarests; es war dunkel, feucht und erbärmlich. Verkäufer saßen auf Stapeln neuer Kleidung, die auf dem Boden lagen. Ungarische Arbeiter waren schon ziemlich faul, aber rumänische Arbeiter schienen geradezu apathisch. Eine der Hauptattraktionen des Geschäfts waren unglaublich klapprige Kinderwagen – die Art, die man verwenden würde, um sein Kind damit zu töten und dann den Hersteller zu verklagen. Diese Regierung allerdings übernahm keine Haftung gegenüber ihren Opfern, egal wie viele Menschen dank ihrer Produkte oder ihrer Politik starben.
Ich ging am zugenagelten Haupteingang einer alten Kirche vorbei, die verlassen inmitten von Baustellen stand, denen die umgebenden Gebäude hatten weichen müssen. Viele Rumänen bekreuzigten sich verdrießlich, als sie daran vorbeigingen.
Außerhalb der US-Botschaft standen rumänische Wachen mit Sturmgewehren, um die Menschen davon abzuhalten, dort um Asyl zu bitten. Mein Gefühl sagte mir, dass ein Halt dort den Ärger nicht wert sei. (Die tschechische Polizei hatte mich im Visier gehabt, nachdem ich die Prager US-Botschaft Anfang des Jahres besucht hatte).
Rumänien war wie die anderen kommunistischen Regimes auch eine ökonomische Theokratie. Die Regierung gebrauchte ihre eiserne Faust, um dafür zu sorgen, dass alles nach Plan verlief. So würden gemäß dem Fünfjahresplan von 1985 bis 1990 rumänische Wissenschaftler 4.015 Entdeckungen machen, von denen 2.423 zu neuen Produkten rumänischer Firmen führen würden. Der Plan sagte nicht, wie nicht ausreichend kreative Wissenschaftler bestraft werden sollten.
Rumänien war ein Liebling der Weltbank, von der es zwischen 1974 und 1982 mehr als 2 Milliarden US-Dollar erhielt. 1979 sagte die Weltbank voraus, dass Rumänien „im nächsten Jahrzehnt weiterhin eine der höchsten Wirtschaftswachstumsraten der entwickelten Welt aufweisen würde … und 1990 eine Industrienation wäre“. Aber der größte Teil des rumänischen Wirtschaftswachstums war den Infusionen der Weltbank zu verdanken. Je mehr Geld die Weltbank einem Staat gibt, desto einfacher ist es, diesen als Erfolgsmodell hinzustellen. Weltbankpräsident Robert McNamara verwies auf Rumänien, um sein „Vertrauen in die finanzielle Moral sozialistischer Länder“ zu rechtfertigen.
Die Weltbank lobte das rumänische Regime auch für seine Fähigkeit, die „Ressourcen zu mobilisieren“, die für Wirtschaftswachstum nötig seien. In Wahrheit presste die Regierung ihren Untertanen die Mittel ab, mit denen dann die industriellen Lieblinge der Weltbank gepäppelt wurden – die selbe Methode, mit der Stalin seine Fünfjahrespläne realisierte.
Das rumänische Regime „mobilisierte“ auch „Ressourcen“, in dem es ethnische Deutsche und Juden, die in seinem Herrschaftsbereich lebten, an die entsprechenden Länder verkaufte. Westdeutschland zahlte ca. 20.000 US-Dollar für jeden „exportierten“ Deutschen, und Israel zahlte in etwa dieselben Summe für jeden rumänischen Juden, der nach Israel entlassen wurde. Im 19.Jahrhundert gab es Verträge gegen Sklavenhandel, aber im 20. Jahrhundert war der Verkauf von Menschen anscheinend akzeptabel, wenn die Einkünfte für progressive Projekte verwendet wurden. (80% der rumänischen Kinder, die nach Deutschland umgesiedelt wurden, wurden dort für schwer unterernährt befunden).
Die Weltbank drehte Ceausescu nie den Geldhahn zu; er hörte vielmehr auf, sich Geld zu leihen, nachdem er zu der Überzeugung gelangt war, dass Schulden beim Westen schlecht für sein Land seien. McNamaras Lobeshymnen auf Ceausescu waren kein Hinderungsgrund, ihn in den Aufsichtsrat der Washington Post zu berufen oder dass er von der amerikanischen Presse nach seinem Tod 2009 in den Kanon der Heiligen aufgenommen wurde.
Während meiner Streifzüge durch Bukarest ging ich davon aus, beschattet zu werden. Ungefähr einer von 15 Rumänen arbeitete als Spitzel für die Regierung. Da ich wusste, dass das Zücken eines Notizblocks Alarm auslösen würde, kritzelte ich Notizen auf meine Handballen. Dieses Verhalten galt höchstens als exzentrisch, nicht als bedrohlich. Ich benutzte einzelne Wörter als Anker, um später Fakten und Gedankenketten abzurufen.
Als ich am Hauptflughafen von Bukarest ankam, um nach Frankfurt weiterzufliegen, sah ich, dass die meisten Reisenden vor mir offen jedem nutzlosen Schergen an jeder der zahlreichen Sicherheitskontrollen eine Packung Kent gaben. Bald verteilte ich selbst Zigarettenschachteln an die Wachen wie eine alte Frau Süßigkeiten an Kinder zu Halloween.
Ich sah ein oder zwei deutsche Geschäftsleute, die für gründlichere Durchsuchungen beiseite genommen wurden. Ihre Kleidung war kreuz und quer über die Tische der Wachen verteilt. Nachdem ich die letzte Kontrolle passiert hatte, machte ich drei Kreuze, dass mir das erspart geblieben war.
Die Lufthansa-Maschine auf dem Rollfeld war der mit Abstand schönste Anblick seit ich mit dem Orientexpress die rumänische Grenze überquert hatte. Ein einzelner älterer Soldat stand lustlos ungefähr zehn Meter neben dem Flugzeug. Ich hielt meinen Pass in die Höhe und er winkte mich heran.
Ich hatte fast die Gangway erreicht, als ein „HALT!“ ertönte.
Ich drehte mich um und sah, wie der Soldat auf mich zulief, während seine MP vor seinem nicht gerade kleinen Bauch hin und her tanzte.
Leicht schnaufend erreichte er mich, griff meinen linken Arm, riss ihn zurück, und fragte, auf meine Hand deutend: „WAS IST DAS?“
Ich schaute auf meine Hand, dann auf ihn.
„Das ist Tinte.“
Er hielt an, kniff die Augen zusammen, nickte wissend, und ließ mich dann weiter ins Flugzeug.
Sobald die Lufthansa-Maschine den rumänischen Luftraum verlassen hatte, kramte ich meinen kleinen Notizblock aus seinem üblichen Versteck – in meiner Unterwäsche – hervor, und fing an, meine Handnotizen zu übertragen.
Im folgenden Monat veröffentlichte die New York Times meinen Artikel „Osteuropa, die neue Dritte Welt“, in dem stand, dass „Osteuropa wesentlich näher am wirtschaftlichen Zusammenbruch ist, als die meisten Menschen im Westen glauben. Nach hunderten sogenannter marktwirtschaftlicher Reformen gibt es immer noch keine Marktwirtschaft in Osteuropa.“ Der Readers Digest Artikel über das selbe Thema erschien in zehn fremdsprachigen Ausgaben. Ich wollte den Ostblockregimen dabei helfen, die Kreditratings zu bekommen, die sie verdienten.
Im gesamten Ostblock versuchten die Regierungen, ihre Wirtschaft zu reformieren und dabei sowohl den Staatsbesitz als auch umfassende Preis- und Produktionskontrollen selbst für nicht-sozialistische Aktivitäten zu erhalten. Es war unmöglich, die Ostblockökonomien zu reparieren, ohne den kommunistischen Parteien die Macht zu entreißen.
Unglücklicherweise herrscht wieder zunehmend romantische Verklärung in Bezug auf die harten Lebensumstände, die die kommunistischen Regimes den Menschen unter ihrer Herrschaft aufzwangen, während immer mehr Zeit seit dem Fall der Sowjetunion vergeht. Aber jedes Wirtschaftssystem, dass Löwen zu veganer Ernährung zwingt, sollte niemals wieder rehabilitiert werden.
*****
Aus dem Englischen übersetzt von Florian Senne. Der Originalbeitrag mit dem Titel The Daily Hell of Life in the Soviet Bloc ist am 20.11.2017 auf der website des Mises-Institute, Auburn, US Alabama erschienen.
——————————————————————————————————————————————————————————–
James Bovard ist Autor von zehn Büchern, darunter Public Policy Hooligan (2012) und Attention Deficit Democracy (2006). Er schrieb für die New York Times, das Wall Street Journal, den Playboy, die Washington Post und zahlreiche weitere Publikationen.
*****
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Institut Deutschland wieder.
Foto Startseite: © salajean – Fotolia.com