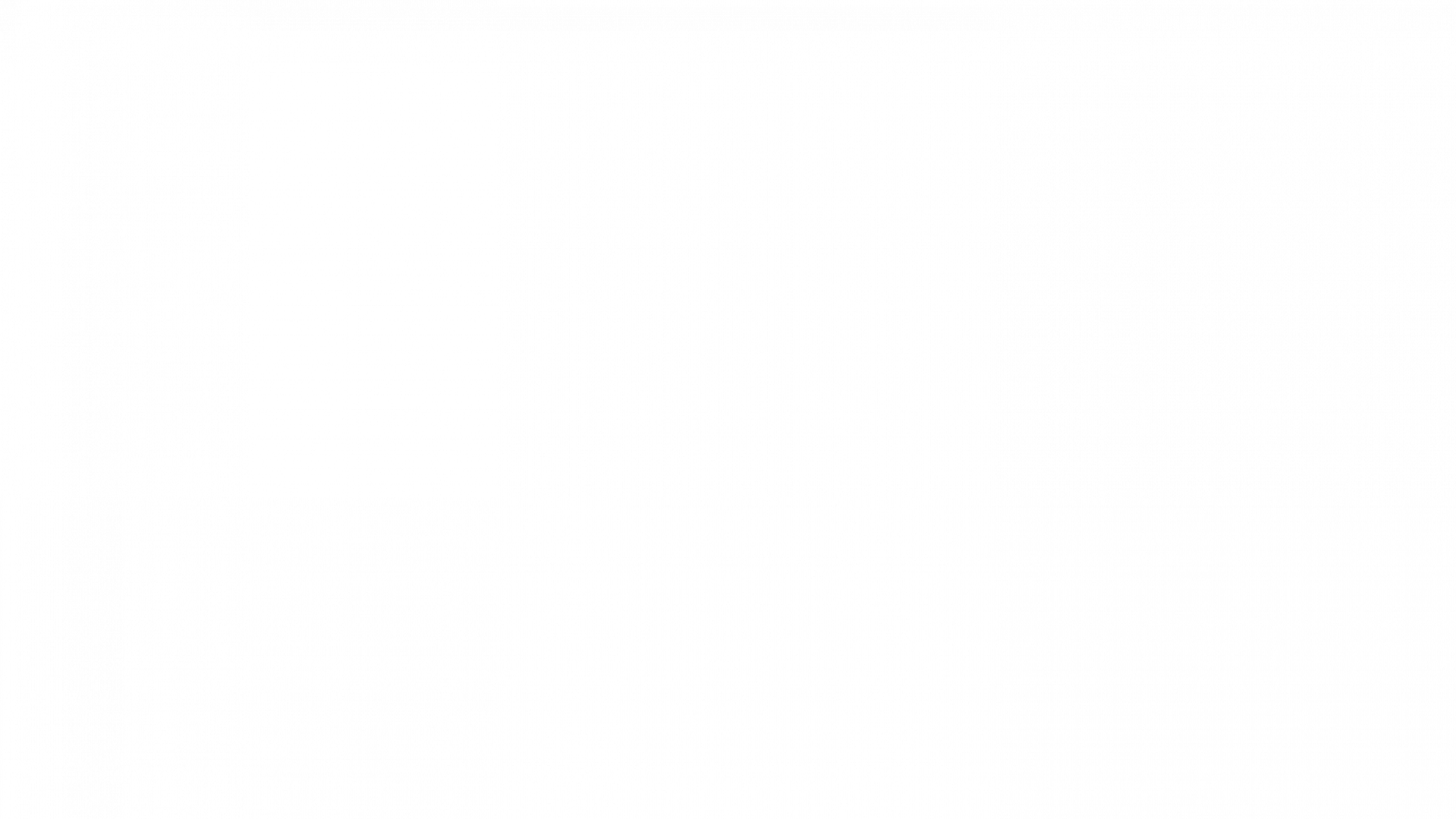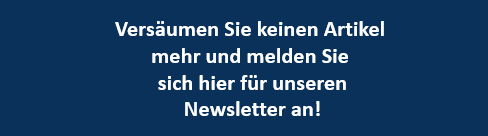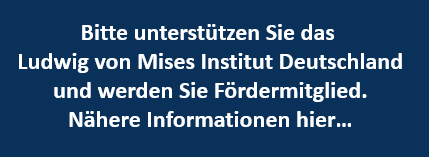Was die EZB soll und was sie nicht soll
6. November 2019 – von Klaus Peter Krause

Klaus Peter Krause
Eine Zentralbank soll dafür sorgen, dass der Geldwert stabil bleibt. Das ist auch die Aufgabe der Europäischen Zentralbank (EZB). Die politische Verführung, von dieser Aufgabe abzuweichen, ist groß. Denn um die Wirtschaft mit Geld zu versorgen, verfügen Zentralbanken als staatliche Einrichtungen heutzutage über das Monopol. Damit bestimmen und wachen sie über die Geldmenge, die eine Volkswirtschaft am Laufen hält. Doch dieses Recht enthält für sie auch eine Verpflichtung: Die Geldmenge muss abgestimmt sein auf die verfügbare Gütermenge, also auf die Menge an Waren und Dienstleistungen, die als Angebot zum Verkaufen und für die Nachfrage zum Kaufen bereitsteht. Aber mit dieser Verpflichtung ist es bei der EZB schon lange nicht mehr weit her.
Die Geldmenge lässt sich heutzutage beliebig ausweiten
Die Geldmenge heute ist nicht mehr wie einst an ein knappes Gut wie Gold oder Silber gebunden, ihre Ausweitung über eine dadurch natürliche Begrenzung hinaus also möglich. Unbegrenzt könnte die Zentralbank Papier bedrucken lassen und als Geldscheine (Banknoten) über die Geschäftsbanken im Land kreisen lassen. Unbegrenzt könnte sie Geld vor allem dadurch entstehen lassen, dass sie über die Geschäftsbanken Kredite vergibt. Jede Kreditvergabe einer Bank ist ein Geldschöpfungsakt. Sie verschafft Kaufkraft, erzeugt Nachfrage und führt zum Kauf von Gütern.
Ist die Geldmenge übergroß, die Gütermenge aber relativ knapp, steigt das Preisniveau
Täte die Zentralbank das wirklich, würde sie also die Volkswirtschaft mit Geld überschütten, ginge es nicht gut aus. Die überdimensionierte Geldmenge würde gleichsam losgelassen auf eine vergleichsweise knappe Gütermenge, weil diese sich nicht so leicht und so schnell vermehren lässt wie heutzutage die Geldmenge. Dann passiert, was auf der Hand liegt: Wer in Geld schwimmt, dem kommt es auf den Preis für das, was er begehrt, nicht so an. Schwimmen alle Nachfrager in Geld, werden die Anbieter die Lage für sich ausnutzen und an jene verkaufen, die bereit sind mehr zu bezahlen als andere. Die unausweichliche Folge: Im kaufkraftstarken Nachfragewettbewerb um das relativ knappe Güterangebot steigt tendenziell das Preisniveau. Der Geldwert sinkt. Geldwertstabilität ist das nicht. Weil der Anstieg herrührt von der aufgeblasenen Geldmenge über das ökonomisch angemessene Maß hinaus, nennt man das Inflation (inflare = aufblasen).
Die EZB ist auf Geldwertstabilität verpflichtet, nicht auf Preisstabilität
Zwischen Geldwertstabilität und Preisstabilität sollte man unterscheiden; beides gerät oft durcheinander und wird gern synonym verwendet. Im Prinzip gilt: Der Geldwert ist stabil, wenn Geldmenge und Gütermenge im (ökonomisch angemessenen) Gleichgewicht sind, und Preisstabilität besteht, wenn Nachfrage und Angebot bei der Gütermenge im Gleichgewicht sind. Das ist ein theoretischer Idealzustand, ihn aber in der geldpolitischen und wirtschaftlichen Praxis hinzukriegen, schwer. Die EZB ist auf Geldwertstabilität verpflichtet, nicht auf Preisstabilität. Geldwertstabilität heißt Inflationsrate von Null.
Preise für Waren und Dienstleistungen müssen je nach Marktlage steigen dürfen
Aber Null-Inflation bedeutet nicht zugleich Preisstabilität. Preise für Waren und Dienstleistungen müssen je nach Marktlage frei fallen und frei steigen dürfen: fallen bei Überangebot und zu schwacher Nachfrage, steigen bei Unterangebot und zu starker Nachfrage. Folglich sind auch die Begriffe Inflationsrate und Teuerungsrate auseinanderzuhalten, was aber in der Praxis schwer ist und daher durchweg nicht geschieht. Wenn zum Beispiel der Ölpreis steigt und mit ihm die Folgepreise wie die für Benzin, weil eine Ölförderanlage zerstört wurde, dann steigt er nicht, weil die Geldmenge gestiegen ist, also nicht inflationsbedingt, dann steigt er, weil sich (bei unveränderter Nachfrage) das Angebot verringert hat, also lagebedingt auf einem Gütermarkt.
Die EZB strebt eine schleichende Geldentwertung ausdrücklich an
Solche lagebedingten Preissteigerungen zu verhindern oder zu dämpfen, sind kein Fall für die EZB; das regeln die Gütermärkte, wenn sie frei genug sind, durch Wettbewerb selbst – es sei denn, der Staat glaubt, intervenieren zu müssen, aus welchen Gründen auch immer. Zuständig ist die EZB nur für die Geldwertstabilität, also für die Inflationsrate. Doch die will die EZB gar nicht auf Null bringen. Sie steuert eine Inflationsrate geradezu an. Ihr Ziel auf mittelfristige Sicht lautet unter, aber nahe bei 2 Prozent. Sie strebt also auf eine schleichende Geldentwertung sogar zu, gesteuert mit einer Geldmenge, die stärker erhöht wird als die Wirtschaftsleistung, das Bruttosozialprodukt, zunimmt. Der wesentliche Beweggrund dafür ist die Angst vor einer Deflation, also davor, dass das Preisniveau wegen gezügelter Geldversorgung sinkt. (Näheres hierzu in meinem Beitrag „Her mit der Deflation“ hier).
Sechs einstige „Zentralbanker“ wenden sich gegen ein Inflationsziel der EZB
Eine andere Angst der EZB (und der politischen Führungen in der EU und ihren Mitgliedsländern) ist die vor dem Kollaps von hochverschuldeten Banken und Euro-Staaten und damit die Angst vor einem Zusammenbruch der Einheitswährung Euro. Um die Verschuldeten vor Zahlungsunfähigkeit und Bankrott zu bewahren, hat sie die EZB über Jahre hin mit neuem Kreditgeld versorgt und dafür massenweise deren Schuldpapiere in Zahlung genommen. Diese Liquiditätsflut hat die Geldmenge in die Höhe getrieben. Gerade hat der neue österreichische Notenbankchef Robert Holzmann die ultralockere Geldpolitik der EZB scharf kritisiert, die EZB-Strategie sei falsch und müsse geändert werden. Er hoffe auf einen baldigen Kurswechsel.[1] Zuvor schon, am 4. Oktober, haben auch sechs ehemalige „Zentralbanker“ die expansive EZB-Geldpolitik kritisiert. Ein Inflationsziel zu verfolgen, entspreche nicht dem der EZB erteilten Auftrag. Sie bemängelten ferner, die Null- und Negativzinspolitik entfalte kontraproduktive Wirkungen, und die Geldpolitik habe die Grenze zur monetären Staatsfinanzierung überschritten.[2]
Das Inflationsziel der EZB ist „eine ungesetzliche, schleichende Enteignung“
Thomas Mayer, Professor an der Universität Witten/Herdecke und einstiger Chef-Volkswirt der Deutschen Bank, als es ihr noch gut ging, nennt die gezielte Verringerung der Kaufkraft des Geldes, wie sie die EZB für Konsumgüter anstrebe, „eine ungesetzliche, schleichende Enteignung der Besitzer von Geldvermögen“. Verfolge die Zentralbank um jeden Preis ein Ziel für die Inflation der Konsumentenpreise, obwohl sie diese kaum steuern könne, erzeuge sie enorme Verwerfungen in Wirtschaft und Gesellschaft. Von steigenden Vermögenspreisen profitieren würden die Besitzer von Realvermögen, leer ausgehen dagegen würden die Besitzer von Geldvermögen. Die Alten gewönnen auf Kosten der Jungen, Verschuldung werde entgrenzt, und Firmen, die unter anderen Umständen nicht überleben könnten, blieben als „Zombies“ am Markt. Produktivitätswachstum und die Ertragsrate für Kapital würden sinken, Preisblasen für Vermögenswerte die finanzielle und wirtschaftliche Fragilität erhöhen.[3]
Euro-Kaufkraftverlust in Deutschland seit 2010 über 11 Prozent
Obwohl die EZB die Euro-Geldmenge hochgetrieben hat, fühlt sich der Normalbürger von einer Inflation (Aufblähung des Preisniveaus) nicht gebeutelt. Derzeit liest er von einer (Jahres)Inflationsrate in Deutschland, die unter 1 Prozent gefallen sei. Korrekt muss das Verbraucherpreisindex (Basisjahr 2010 = 100) heißen. Dieser geringe Wert sieht weitgehend nach Stabilität aus. Doch über die Jahre hin summiert sich das. Von 2010 bis 2018 ist der deutsche Verbraucherpreisindex um 11,4 Prozent gestiegen (Quelle hier). Für Deutsche in Deutschland hat der Euro also über 11 Prozent an Kaufkraft verloren.
Wo sich die EZB-Geldschwemme schon auswirkt
Gleichwohl, ein jährlicher, durchschnittlicher Preisanstieg zwischen 1 bis 2 Prozent wirkt angesichts der von der EZB ausgelösten Geldmengenflut für den Normalbürger nicht gerade alarmierend, und schleichende Geldentwertung nimmt er, weil schon lange gewohnt, schicksalsergeben hin. Hat also diese Flut mit ihrem Inflationspotential denn auf die Güterpreise überhaupt keine Auswirkungen? Sie hat durchaus, nämlich auf solchen Märkten, wo die Geldschwemme zuerst ankommt: auf den Märkten für Vermögensgüter, vor allem denen für Immobilien, Unternehmensbeteiligungen und Edelmetalle. Vermögensgüter sind im Verbraucherpreisindex entweder gar nicht berücksichtigt oder untergewichtet. Stark gestiegen sind in Deutschland besonders die Immobilienpreise. Sie sind in den letzten Jahren stärker gestiegen als das allgemeine Preisniveau. Fast täglich warnen Fachleute vor einer Überhitzung, war in der FAZ vom 2. Oktober zu lesen („Die große Angst vor einer Immobilienblase“ hier). Einen Zusammenhang zur EZB-Geldschwemme stellt der FAZ-Bericht allerdings nicht her.
Hans-Werner Sinn: „Der Maastrichter Vertrag verlangt Preisstabilität. Das heißt null Prozent Inflation.“
Bis das zu viele Geld der EZB auch auf den Märkten für die Güter des täglichen Bedarfs preissteigernd wirkt und sich im Verbraucherpreisindex niederschlägt, vergeht weit mehr Zeit als auf den Vermögensgütermärkten mit ihren Akteuren, für die das EZB-Geld zuerst verfügbar ist. Ein überreiches Konsumgüterangebot bei unbeschränktem Wettbewerb kann die zeitliche Verzögerung noch verlängern. Auch spielt eine Rolle, welche Güter im statistischen Warenkorb erfasst und wie sie in ihm gewichtet sind. Der EZB passt diese Verzögerung nicht. Sie will die Inflationsrate/Teuerungsrate in der Euro-Zone bei nahe 2 Prozent sehen. Daher hat sie den Kauf von Anleihen wieder aufgenommen, unbefristet, bis das Ziel erreicht sei (FAZ vom 17. Oktober hier). Das ist nicht ihre Aufgabe. Es gibt prominente Ökonomen, die das ebenso sehen. Zu ihnen gehört Hans-Werner Sinn. Als er noch Ifo-Präsident war, sagte er (2015): „Der Maastrichter Vertrag verlangt Preisstabilität. Das heißt null Prozent Inflation.“ Die EZB habe eigenmächtig ihr Mandat verändert. (Quelle hier). Quod errat demonstrandum.
[1] FAZ vom 14. Oktober 2019, Seite 19.
[2] Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) vom 13. Oktober 2019, Seite 29.
[3] Ebenda. Der ganze Beitrag online hier.
Über Klaus Peter Krause: Jahrgang 1936. Abitur 1957 in Lübeck. 1959 bis 1961 Kaufmännische Lehre. Dann Studium der Wirtschaftswissenschaften in Kiel und Marburg. Seit 1966 promovierter Diplom-Volkswirt. Von 1966 bis Ende 2001 Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, davon knapp elf Jahre (1991 bis Ende 2001) verantwortlich für die FAZ-Wirtschaftsberichterstattung. Daneben von 1994 bis Ende 2003 auch Geschäftsführer der Fazit-Stiftung gewesen, der die Mehrheit an der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH und der Frankfurter Societäts-Druckerei gehört. Jetzt selbständiger Journalist und Publizist. Seine website ist www.kpkrause.de
*****
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Institut Deutschland wieder.
Foto: Adobe Stock