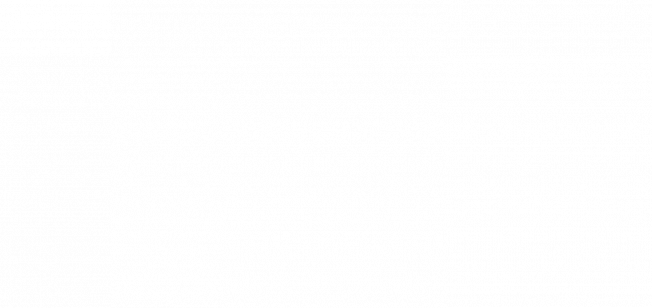Es ist Zeit für einen radikalen Idealismus (Teil 1)
31.8.2015 – Der folgende Beitrag Es ist Zeit für einen radikalen Idealismus (Teil 1) wird hier in zwei Teilen veröffentlicht. Er ist dem Buch „For a New Liberty: The Libertarian Manifesto“ von Murray N. Rothbard entnommen.Teil 2 wird am 7.9.2015 veröffentlicht.
————————————————————————————————————————————————————————
Es ist Zeit für einen radikalen Idealismus (Teil 1)
von Murray N. Rothbard.

Murray N. Rothbard (1926 – 1995)
Jede „radikale” Überzeugung war schon einmal dem Vorwurf der Utopie ausgesetzt, die libertäre Bewegung ist hiervon keine Ausnahme. Selbst einige Libertäre sind der Überzeugung, die Menschen besser nicht mit einer zu radikalen Einstellung zu erschrecken und wollen daher die vollständige libertäre Ideenlehre und ihr politisches Programm vor ihnen verborgen halten. Diese Leute empfehlen ein „fabianisches“ Programm der kleinen Schritte und konzentrieren sich, ausschließlich, auf die allmähliche Schwächung der Staatsgewalt. Ein Beispiel auf dem Gebiet des Steuersystems anzuführen mag hier genügen: Anstelle der radikalen Forderung nach einer vollkommenen Abschaffung aller Steuern oder wenigstens der Forderung nach einer Abschaffung der Einkommenssteuer, sollte man sich darauf beschränken, kleine Verbesserungen zu fordern, etwa eine zweiprozentige Kürzung der Einkommenssteuer.
Auf dem Gebiet des strategischen Denkens sei es Libertären angeraten, sich ein Beispiel an den Marxisten zu nehmen, Sie haben über Strategien zu einem radikalen Umbau der Gesellschaft länger gegrübelt als jede andere Gruppe. Für die Marxisten gibt es zwei sehr wichtige strategische Trugschlüsse, die vom richtigen Weg „abschweifen“: den einen nennen sie „linkes Sektierertum“, den anderen, ihm entgegengesetzten, „rechten Opportunismus“. Die Kritiker eines libertären „Extremismus“ sind eine Analogie zu den marxistischen „rechten Opportunisten“.
Das Hauptproblem mit den Opportunisten ist – da sie sich selbst strikt einem kleinschrittigen und „praktischen“ Programm, das die Chance hat, unmittelbar umgesetzt zu werden, verschrieben haben -, dass sie der großen Gefahr ausgesetzt sind, das große libertäre Ziel aus den Augen zu verlieren. Derjenige, der sich darauf beschränkt, eine zweiprozentige Steuersenkung zu fordern, verhindert damit das eigentliche Ziel, nämlich die endgültige Beseitigung aller Steuern. Mit seiner Fokussierung auf die unmittelbaren Instrumente, trägt er seinen Teil dazu bei, das endgültige libertäre Ziel zu beerdigen; dadurch macht es aber keinen Sinn mehr, überhaupt noch libertäre Ansichten zu vertreten. Wenn Libertäre aufhören, das Banner der reinen Lehre hochzuhalten, wer soll es sonst tun? Die Antwort ist: Niemand. Der falsche Weg der Opportunisten ist, unter anderem, einer der Hauptgründe für den Schwund in den Reihen der Libertären in den letzten Jahren.
Ein prominenter Fall für einen opportunistischen Abfall vom richtigen Weg ist das Beispiel von jemanden, den wir einfach „Robert“ nennen wollen. Robert war in den 50er Jahren ein überzeugter Libertärer. In seinem Bemühen, schnelle Erfolge vorzuweisen, vertrat Robert eine Strategie, das endgültige libertäre Ziel in den Hintergrund zu stellen und explizit die libertäre Ablehnung gegenüber dem Staat herunterzuspielen. Sein Ziel war es, nur das „Positive“ und die Annehmlichkeiten zu betonen, die Menschen durch freiwillige Zusammenarbeit erzielen könnten.
Im Verlaufe seines beruflichen Aufstieges empfand Robert ungebrochene Libertäre immer stärker als Belastung, so dass er damit begann, sich systematisch von jedem zu trennen, der sich negativ über staatliche Institutionen äußerte. Von da aus war es nur ein kurzer Weg bis Robert begann, öffentlich dem libertären Gedankengut abzuschwören und stattdessen für eine „enge Zusammenarbeit“ zwischen staatlichen Stellen und privaten Unternehmen einzutreten. Mit seinem Ruf nach der Verbindung von auf Zwang basierenden und freiwilligen Zusammenschlüssen nahm er seinen Platz im Establishment ein. Trotzdem schreckt Robert nicht davor zurück, sich selbst beizeiten zu später Stunde „Anarchist“ zu nennen, wenn auch in einer von der Realität losgelösten Definition.
Der Wirtschaftswissenschaftler Friedrich August von Hayek, sicherlich in keinster Weise ein Extremist, hat stets die außerordentliche Wichtigkeit betont, die darin liegt, die reine und „extremistische“ freiheitliche Ideenlehre, als unerschütterliches Credo hochzuhalten. Für Hayek lag eine der größten Anziehungskräfte des Sozialismus immer darin, das „edle“ Ziel fortwährend zu betonen, eines Ideals, das die Bestrebungen all jener durchdringt, erfüllt und lenkt, die bemüht sind, den Sozialismus einzuführen. Hayek führt weiter aus:
(…) [Wir müssen] die Schaffung einer freien Gesellschaft wieder zu einer geistigen Tat, einem Akt des Mutes (…) [machen]. Was uns heute mangelt, ist eine liberale Utopie, ein Programm, das weder eine bloße Verteidigung des Bestehenden ist, noch einfach als ein verwässerter Sozialismus erscheint, ein liberaler Radikalismus, der weder die Empfindlichkeiten der bestehenden Interessensgruppen schont, noch glaubt, so „praktisch“ sein zu müssen, daß er sich auf Dinge beschränkt, die heute politisch möglich erscheinen. Was es dazu braucht, sind intellektuelle Führer, die darauf vorbereitet sind, sich den Diffamierungen der Reichen und Mächtigen zu widersetzen, die bereit sind, für ihre Ideen zu kämpfen, mögen sie auch heutzutage wenig Aussicht auf Erfolg bieten. Es braucht Menschen, die bereit sind, an ihren Prinzipien festzuhalten und für deren Umsetzung zu kämpfen.
Was der echte Liberalismus vor allem aus dem Erfolg der Sozialisten lernen muß, ist, daß es ihr Mut zur Utopie war, der ihnen die Unterstützung der Intellektuellen gewann und damit jenen Einfluß auf die öffentliche Meinung gab, der schrittweise das möglich machte, was eben noch unmöglich schien. Wer sich stets auf das beschränkt, was im gegebenen Stand der Meinungen durchführbar scheint, hat immer noch erkennen müssen, daß bald auch das politisch unmöglich wurde, weil Kräfte, auf die er keinen Einfluß genommen hat, die öffentliche Meinung geändert haben. Wenn es uns nicht gelingt, die Voraussetzungen einer freien gesellschaftlichen Ordnung wieder zu einer brennenden geistigen Frage und ihre Lösung zu einer Aufgabe zu machen, die den Scharfsinn und Erfindungsgabe unserer besten Köpfe herausfordert, dann sind die Aussichten für den Fortbestand der Freiheit tatsächlich gering. Wenn wir aber jenen Glauben an die Allmacht von Ideen wiedergewinnen können, der das vornehmste Merkmal des Liberalismus in seiner großen Periode war, muß der Kampf noch nicht verloren sein.[1]
Hayek arbeitet hier eine wichtige Wahrheit heraus und liefert einen weiteren wichtigen Grund für die stete Betonung des ultimativen Ziels: die freudige Begeisterung, die aus einer logisch konsistenten Ordnung entstehen kann. Wer geht im Gegensatz dazu schon für eine zweiprozentige Steuersenkung auf die Barrikaden?
Es gibt darüber hinaus einen weiteren wesentlichen taktischen Grund, an den reinen Grundsätzen festzuhalten. In der Tat sind die tagespolitischen Geschehnisse das Ergebnis aus verschiedenen Einflussfaktoren und ein unbefriedigendes Ergebnis aus dem Hin und Her kollidierender Interessen und Weltanschauungen. Gerade schon aus diesem Grund ist es daher umso wichtiger für den Libertären, den Druck stetig hochzuhalten. Mit einem Ruf nach einer zweiprozentigen Steuersenkung erzielt man, eventuell, eine Mäßigung bei einer bereits geplanten Steuererhöhung. Der Ruf nach einer drastischen Steuersenkung kann hingegen zu einer substanziellen Steuersenkung führen. Es ist genau das strategische Ziel eines „Extremisten“, den Diskursrahmen der tagespolitischen Debatten über die Jahre Stück für Stück weiter in seine Richtung zu lenken.
Die Sozialisten waren außerordentlich versiert in dieser Strategie. Schaut man sich sozialistische Programme an, die etwa vor 60 oder 30 Jahren entwickelt wurden, so ist auffällig, dass Maßnahmen, die noch ein oder zwei Generationen zuvor als gefährlich sozialistisch galten, heutzutage in Fleisch und Blut des amerikanischen Mainstream übergegangen sind. Auf diese Art und Weise werden die täglichen Beschlüsse in der Realpolitik Stück für Stück in eine kollektivistische Richtung verschoben. Es gibt keinen Grund, warum nicht auch den Libertären das Gleiche gelingen sollte. Einer der Gründe, warum gerade von konservativer Seite so wenig Widerspruch gegen kollektivistische Ideen zu hören ist, liegt darin, dass Konservative ihrer Natur nach keine konsistente politische Philosophie vorweisen können, sondern nur eine realpolitische Verteidigung des Status Quo als Ziel haben, verankert in Gestalt der amerikanischen „Tradition“. Während der Etatismus immer weiter wächst, findet er seinen natürlichen Eingang in diese „Tradition“ – Konservativen fehlen schlicht die intellektuellen Waffen, um den wuchernden Etatismus zum Einsturz zu bringen.
An Prinzipien festzuhalten bedeutet mehr, als nur sie hochzuhalten und dem libertären Ideal nicht zu widersprechen. Es bedeutet vielmehr, sich darum zu bemühen, sie so schnell wie möglich umzusetzen. Kurz gesagt, darf der Libertäre niemals für eine graduelle Vorgehensweise seiner Ziele, anstatt einer schnellen und unmittelbaren, werben oder diese gar vorziehen. Tut er dies dennoch, höhlt er seine eigenen Ziele und Werte aus. Wenn bereits er seine eigenen Ziele so wenig wertschätzt, wie sollen dann andere die Ziele zu schätzen lernen?
Will der Libertäre daher die freiheitlichen Werte als oberstes Ziel wirklich verfolgen, muss er danach streben, diese auf die wirksamste und schnellste Art und Weise umzusetzen. Von diesem Geiste beseelt war der klassische Liberale Leonard E. Read, als er sich in einer Rede nach dem Zweiten Weltkrieg mit den folgenden Worten dafür aussprach, alle Preis- und Lohnkontrollen unverzüglich abzuschaffen: „Gäbe es eine Knopf auf diesem Podium, mit dem man alle Preise und Löhne von ihren Kontrollen augenblicklich befreien könnte, würde ich meinen Finger auf ihn legen und drücken!“[2]
Der Libertäre sollte daher von dem Schlage Mensch sein, den Knopf, so er denn existieren sollte, zu drücken, um augenblicklich alle Übertritte gegen die Freiheit zu beseitigen. Selbstverständlich ist jedem klar, dass ein solcher Knopf nicht existiert, vielmehr soll dieses Beispiel verdeutlichen, welche Art Wertvorstellungen sein gesamtes strategisches Denken leiten sollten.
Mit einer solchen radikalen Alles-oder-Nichts Einstellung hegt der Libertäre keine unrealistischen Vorstellungen darüber, wie lange es braucht, seine Ziele umzusetzen. Der libertäre Gegner der Sklaverei, William Lloyd Garrison, war in den 1830er Jahren nicht „unrealistisch“, als er erstmalig den ruhmreichen Anspruch nach der rechtlichen Gleichberechtigung der Sklaven vertrat. Sein Ziel war das moralisch überlegene und sein strategischer Realismus kam in der Erwartung zum Ausdruck, sein Ziel nicht kurzfristig umsetzen zu können. Wie es bereits in Kapitel 1 deutlich wurde, unterschied Garrison: „Fordern wir die sofortige Abschaffung so aufrichtig wir können, so wird sie, leider!, am Ende dennoch schrittweise erfolgen. Wir haben nie behauptet, die Sklaverei könnte auf einen Schlag abgeschafft werden; dass es so sein sollte, dafür werden wir immer kämpfen.“ Sollte es anders sein, warnte schon Garrison messerscharf, „Der Weg der kleinen Schritte in der Theorie, bedeutet Ruhestand in der Praxis.“[3]
Der Ansatz der kleinen Schritte unterhöhlt die Zielsetzung durch das Eingeständnis, man müsse sich auch mit der zweit- oder drittbesten Lösung zufrieden geben, bevor keine oder nur noch antilibertäre Überlegungen übrig bleiben. Ein Vorziehen einer graduellen Vorgehensweise bedeutet aber nichts anderes, als seien diese anderen Erwägungen wichtiger als die Freiheit. Man stelle sich einmal vor, die Gegner der Sklaverei hätten gesagt, „Ich befürworte ein Ende der Sklaverei, aber nur nach einer zehnjährigen Übergangsperiode.“ Dies würde aber bedeuten, eine Abschaffung in acht oder neun Jahren oder a fortiori [erst recht] mit sofortiger Wirkung, wäre falsch und es wäre daher besser, die Sklaverei noch eine Weile fortzusetzen. Das wiederum würde bedeuten, Erwägungen zu Gerechtigkeit über Bord zu werfen und das oberste Ziel, die Abschaffung der Sklaverei, würde nicht mehr die höchste Priorität bei den Gegnern der Sklaverei (oder der Libertären) genießen. Für Gegner der Sklaverei und für Libertäre würde dies bedeuten, sie würden der Verlängerung eines schweren Verbrechens zu stimmen.
Während es also für den Libertären von außerordentlicher Wichtigkeit ist, das höchste und „extreme“ Ideal zu verfolgen, macht ihn das, anders als Hayek meint, nicht zu einem „Utopisten“. Der wahre Utopist ist jemand, der eine Ordnung anstrebt, die der menschlichen Natur und den Naturgesetzen widerspricht. Eine Utopie ist eine Ordnung, die selbst dann nicht funktioniert, wenn jeder überzeugt werden könnte, sie umzusetzen. Die utopische Ordnung wäre nicht in der Lage, in der Realität zu funktionieren. Das utopische Ziel der Linken, der Kommunismus – die Abschaffung jedweder Spezialisierung und die Einführung von absoluter Gleichheit – könnte nicht funktionieren, selbst wenn jeder bereitwillig bei der Umsetzung mithelfen würde. Es funktioniert nicht, weil es nicht der menschlichen Natur entspricht. Jeder Mensch ist einzigartig und individuell in seinen Kenntnissen und Fähigkeiten. Der Kommunismus hingegen hätte einen drastischen Abfall in der Wohlstandsentwicklung zur Folge, so stark, dass weite Teile der Menschheit unmittelbar von vernichtenden Katastrophen und Hungersnöten heimgesucht würden.
Der Begriff „Utopie“ in seiner populären Verwendung vermengt zwei verschiedene Formen von Problemen, die bei der Umsetzung von Programmen entstehen, die sich radikal vom Status Quo unterscheiden. Einerseits entspringen diese Probleme aus dem Umstand, ein Programm vorzuschlagen, das der menschlichen Natur und der Beschaffenheit der Welt widerspricht und somit die Umsetzung des Programms schlicht nicht möglich ist. Dies ist die Utopie des Kommunismus. Die zweite Art von Schwierigkeiten besteht darin, genügend Menschen zu überzeugen, das Programm umzusetzen. Die erste Art von Problemen bei der Umsetzung lässt sich auf eine schlechte theoretische Grundlage, die der menschlichen Natur widerspricht, zurückführen. Die zweite Art hingegen ist einfach ein Problem des menschlichen Willens, davon genug Menschen von der Richtigkeit des Programms zu überzeugen. Die Verwendung des Begriffes „Utopie“ in abwertendem Sinne trifft daher nur auf die erste Form von Problemen zu.
Aus dem Englischen übersetzt von Arno Stöcker.
*****
[1] Hayek, Friedrich August von (1949), Die Intellektuellen und der Sozialismus, S. 15. Erschienen in: Wissenschaft und Sozialismus (2004); aus der Reihe: Friedrich A. von Hayek Gesammelte Schriften in deutscher Sprache (Abteilung A: Aufsätze, Bd. 7), Hrsg.: Bosch, A., Streit, M., Vanberg, V., Veit, R., Tübingen: Mohr Siebeck, S. 3-15. In der hier zitierten deutschen Übersetzung von 1949 wurden einige Sätze aus dem englischen Original ausgelassen. Wo dies der Fall war, wurden sie durch den Übersetzer nachübersetzt und eingefügt.
[2] Read, Leonard E. (1946), I´d Push the Button, New York: Joseph D. McGuire, S. 3. Online abrufbar unter: https://fee.org/resources/detail/id-push-the-button.
[3] Zitiert nach Pease, William H. /Pease, Jane H. et al. (1965), The Antislavery Argument, Indianapolis: Bobbs-Merrill, S. xxxv.
————————————————————————————————————————————————————————-
Murray N. Rothbard wurde 1926 in New York geboren, wo er an der dortigen Universität Schüler von Ludwig von Mises wurde. Rothbard, der 1962 in seinem Werk Man, Economy, and State die Misesianische Theorie noch einmal grundlegend zusammenfasste, hat selbst diese letzte Aufgabe, die Mises dem Staat zubilligt, einer mehr als kritischen Überprüfung unterzogen.