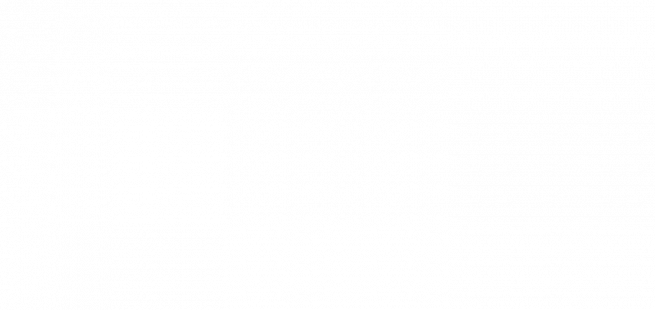„Diese Wirtschaft tötet“, sagt der Papst. Welche meint er?
1.1.2014 – Die Lesart seines Lehrschreibens, wir bräuchten mehr Staat, wird Franziskus nicht gerecht und verkehrt sein Anliegen ins Gegenteil.
von Jörg Guido Hülsmann.
Ende November erschien ein Apostolisches Schreiben, in dem Papst Franziskus zur Erneuerung von Kirche und Welt aufrief. Natürlich ist eine Erneuerung aus dem Heiligen Geist gemeint, und die Triebkraft dieser Reform sieht der Papst in der inneren Freude, die aus der Frohen Botschaft des Neuen Testaments entspringt. Daher auch der Titel seines Schreibens: Evangelii Gaudium – Freude des Evangeliums.
Aus dieser schönen Schrift ist vor allem ein Satz in die Schlagzeilen des deutschen Blätterwaldes gedrungen: „Diese Wirtschaft tötet“. In dem betreffenden Paragraphen heißt es weiter: „Es ist unglaublich, dass es kein Aufsehen erregt, wenn ein alter Mann, der gezwungen ist, auf der Straße zu leben, erfriert, während eine Baisse um zwei Punkte in der Börse Schlagzeilen macht. Das ist Ausschließung. Es ist nicht mehr zu tolerieren, dass Nahrungsmittel weggeworfen werden, während es Menschen gibt, die Hunger leiden. Das ist soziale Ungleichheit. Heute spielt sich alles nach den Kriterien der Konkurrenzfähigkeit und nach dem Gesetz des Stärkeren ab, wo der Mächtigere den Schwächeren zunichte macht. Als Folge dieser Situation sehen sich große Massen der Bevölkerung ausgeschlossen und an den Rand gedrängt: ohne Arbeit, ohne Aussichten, ohne Ausweg. Der Mensch an sich wird wie ein Konsumgut betrachtet, das man gebrauchen und dann wegwerfen kann.“ (§ 53) Ähnliche Sätze prägen die anderen Paragraphen, in denen von der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lage die Rede ist.
Das Apostolische Schreiben wurde umgehend so ausgelegt, dass es sich dabei vor allem um eine Kritik „der“ Globalisierung oder „des“ Kapitalismus handele. Diese Lesart scheint den Schluss nahezulegen, dass der ausgeprägte Etatismus, wie er heute in fast allen Ländern praktiziert wird, grundsätzlich das Gemeinwohl fördert und lediglich darunter leidet, dass er eben noch nicht weit genug geht. Zwar verbraucht der Staat schon mehr als die Hälfte des BIP, des Bruttoinlandsprodukts, aber es sollte keinesfalls weniger sein. Zwar ist schon die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft mit einem engmaschigen Netz aus Verboten und Geboten übersät, aber es braucht noch mehr. Wie bequem für unsere Parlamentarier! Welche Bestätigung für die Lehrer, Professoren und Journalisten, die genau dies Tag für Tag verkünden! Alle liegen ganz richtig, und der Papst ruft ihnen ein „Weiter so!“ zu. Doch diese Lesart wird Franziskus nicht gerecht und verkehrt sein Grundanliegen geradezu ins Gegenteil.
Zunächst einmal ist hervorzuheben, dass alle Päpste seit Leo XIII. immer streng zwischen einer positiven und einer negativen Konzeption des Kapitalismus unterschieden haben. Die positive Version bezeichnet ein Wirtschaftssystem, das „die grundlegende und positive Rolle des Unternehmens, des Marktes, des Privateigentums und der daraus folgenden Verantwortung für die Produktionsmittel, der freien Kreativität des Menschen im Bereich der Wirtschaft anerkennt“. Die negative Version liegt dann vor, wenn „die wirtschaftliche Freiheit nicht in eine feste Rechtsordnung eingebunden ist, die sie in den Dienst der vollen menschlichen Freiheit stellt und sie als eine besondere Dimension dieser Freiheit mit ihrem ethischen und religiösen Mittelpunkt ansieht“ (Johannes Paul II., Centesimus Annus, § 42).
Auch die Volkswirtschaftslehre stützt sich auf diese grundlegende Unterscheidung. Kapitalismus im strengen Sinne des Wortes gibt es nur dort, wo Privateigentum das menschliche Handeln sowohl ermöglicht (Freiheit), als auch begrenzt (Verantwortung). Wo dagegen die freie Verfügung über das rechtmäßig erworbene Eigentum gewaltsam verhindert wird, besteht Kapitalismus nur in entsprechend eingeschränktem Umfang. Das gilt besonders dann, wenn einige Leute sich gewaltsam aus dem Eigentum anderer bedienen können. Verletzungen des Privateigentums gibt es natürlich immer und überall, aber in einer freien Gesellschaft werden sie von den Bürgern im Verbund mit Polizei und Justiz bekämpft. Wir dagegen benutzen unsere Gerichte, unsere Polizei und in manchen Ländern sogar die Armee dazu, den staatlichen Willen unter Verletzungen des Privateigentums möglichst lückenlos durchzusetzen. Vom Kapitalismus im positiven Sinne haben wir uns schon lange verabschiedet. Selbst die vielgescholtenen Finanzmärkte sind mit Vorschriften übersät, die in der Regel auch peinlich beachtet werden. Eine Gesellschaft, in der praktisch alles gesetzlich reglementiert wird – von der Glühbirnenarchitektur über die Konfiguration einer Geldanlage bis zur Erziehung von Kleinkindern – kann mit Fug und Recht als etatistisch, kollektivistisch oder quasisozialistisch, bezeichnet werden. Vielleicht kann man sie auch staatskapitalistisch nennen, aber sicherlich ist sie nicht ein Reich des Laissez-Faire.
Daher versteht es sich auch keineswegs von selbst, unsere heutigen Probleme als Auswüchse der wirtschaftlichen Freiheit anzusehen. Warum liegt es nicht zumindest ebenso nahe, in ihnen den schädlichen Einfluss staatlicher Eingriffe zu erblicken? Genau das meinen auch viele katholische Sozialwissenschaftler, darunter der Autor dieser Zeilen. Die von Franziskus benannten Probleme sind zum großen Teil auf unseren uferlosen Etatismus zurückzuführen, und zwar gerade auch auf solche Eingriffe, die uns heute besonders einleuchtend erscheinen und an die wir uns in der Tat schon so sehr gewöhnt haben, dass wir ihre faulen Früchte nicht mehr wahrhaben wollen.
Das betrifft besonders den Wohlfahrtsstaat. Dieser ist so sehr Teil unserer Geschichte und unserer Lebenswelt, dass wir ihn oft kaum mehr bemerken, gar in Frage stellen. In der Schule, an den Universitäten und in den Medien werden fast ausschließlich seine vermeintlichen Vorzüge besprochen – vermutlich, um seine exorbitanten Kosten zu rechtfertigen. Auf seine kulturellen Kosten wird kaum ein Wort verwendet, dabei liegen gerade diese heute besonders deutlich auf der Hand. Sie lassen sich mit sechs Wörtern zusammenfassen: Verantwortungslosigkeit, Gleichgültigkeit, Lieblosigkeit und moralischer Relativismus.
Wer sich von einem Wohlfahrtsstaat umsorgt weiß, muss weniger selber tun, um seine Lebenswelt zu gestalten. Da der Staat uns an allen Ecken und Enden als „Problemlöser in letzter Instanz“ unter die Arme greift, ist man selber entsprechend weniger auf irgendwelche konkreten Personen angewiesen. Und umgekehrt ist es auch nicht nötig, dass man sich persönlich um andere Menschen kümmert, denn sie haben ja Vater Staat an ihrer Seite. Also tendieren wir dazu, nur mit jenen Leuten Umgang zu pflegen, die uns nützen oder die uns Freude bereiten. Für die Alten, die Kranken und die Behinderten gibt es geeignete Abstellgleise, die natürlich der Staat betreibt. Ähnliche Lösungen gibt es bei uns demnächst auch flächendeckend für Kleinkinder, die ja nun wahrlich erst einmal gar nichts nutzen und häufig auch noch nerven.
Der Wohlfahrtsstaat finanziert Frauen und Männer, die sich nicht mehr mit ihren Ehepartnern und Familien arrangieren wollen, und dadurch steigen dann eben die Scheidungsraten. Aus dem gleichen Grunde sinkt das Interesse junger Menschen am Familienleben und am sogenannten Erwachsenenleben. Der Wohlfahrtsstaat verspricht Renten und gesundheitliche Versorgung bis ans Lebensende, und dadurch sinkt bei den Bürgern die Bereitschaft (und irgendwann auch die Fähigkeit), ihr Leben in eigener Verantwortung zu führen. Es sinkt natürlich ebenso ihre Bereitschaft, aus eigenem Antrieb anderen Menschen solidarisch unter die Arme zu greifen. Es sinkt sogar das bloße Interesse am Schicksal der anderen. Warum sollten mich die Sorgen meines Nachbarn kümmern, wenn ich ihn unter den Fittichen des Staates sicher weiß?
Der größte Schaden entsteht dort, wo die staatlichen Finanzspritzen auf die Spitze getrieben werden, nämlich bei der Subventionierung der Finanzmärkte aus der Notenpresse. Hier kommen wir auf die absurdeste Ausprägung des Wohlfahrtsstaats zu sprechen: jenen Wohlfahrtsstaat für Bankiers und andere Wohlhabende, der unter dem Namen „Zentralbankwesen“ bekannt ist.
Wer von einer modernen Zentralbank umsorgt wird, kann weitgehend auf eigene Vorsichtsmaßnahmen verzichten. Er braucht praktisch kein Bargeld mehr in der Kasse zu halten, denn bei Bedarf gibt es unbegrenzten Kredit aus der Notenpresse. Er braucht auch nur noch sehr wenig Eigenkapital, denn die Zentralbank stabilisiert die Kreditmärkte, indem sie zur Not unbegrenzte Mengen an Wertpapieren kauft. (Wie sagte der EZB-Präsident Draghi das so schön: „Whatever it takes“.) Die Nutznießer der Notenpresse brauchen daher nur noch im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, aber kaum mehr aus Eigeninteresse auf die Risiken ihrer Engagements achten. Sie können sich auf die Jagd nach Gewinnen konzentrieren. Kommt es zu Gewinnen, so verbleiben sie bei der Bank. Kommen Verluste, so werden sie wie im Jahr 2008 vom Staat gedeckt, der zu diesem Zweck Kredite aus der Notenpresse erhält. Privatisierung der Gewinne und Sozialisierung der Verluste: das ist kein Kapitalismus, sondern Kumpelwirtschaft.
Aber dabei bleibt es nicht. Auch in den Fällen, in denen die Notenpresse mit großer Zurückhaltung betrieben wird, ergeben sich bedeutende wirtschaftliche und kulturelle Nachteile.
Um nur eine solche wirtschaftliche Folge zu nennen: Selbst wenn die Preise jedes Jahr auch nur um 2 Prozent steigen, kommt es unweigerlich zu „aufblähenden“ Finanzmärkten: Die Preise der Wertpapiere wachsen dann tendenziell stärker als die Preise der Realwirtschaft. Daraus ergibt sich wiederum eine Reihe von kulturellen Folgen. Zum Beispiel bedeuten aufblähende Finanzmärkte, dass es immer länger dauert, um ein bestimmtes Vermögen anzusparen. Im Jahr 1969 (noch unter dem Goldstandard des Bretton-Woods-Systems) war das Vermögen eines amerikanischen Haushalts im Durchschnitt etwa viermal so groß wie das Einkommen. Im Jahr 2007 war das Vermögen dann fast achtmal so groß.
Ein Haushalt mit durchschnittlichem Einkommen hätte 1969 vier Jahreseinkommen sparen müssen, um ein durchschnittliches Vermögen anzuhäufen. Vierzig Jahre später wären zu diesem Zweck acht Jahreseinkommen erforderlich gewesen. Die auf stabile Inflation orientierte Politik der Zentralbanken läuft somit darauf hinaus, solche (typischerweise alten) Haushalte zu bevorteilen, die bereits vermögend sind. Andererseits werden diejenigen (typischerweise jungen) Haushalte benachteiligt, die noch kein Vermögen erworben haben. Soziale Mobilität wird erschwert. Die Gesellschaft schichtet sich der Tendenz nach in Habende und Habenichtse.
Die Folgen reichen aber noch sehr viel weiter. Ein Beispiel: Da es immer länger dauert, um ein bestimmtes Vermögen zu ersparen, steigen die „Opportunitätskosten“ des Altruismus. Unentgeltliche Tätigkeiten werden also vermieden, und Spenden nehmen der Tendenz nach ab. Eine andere, besonders absurde Folge ergibt sich aus dem Umstand, dass vermögende Personen sich besonders leicht verschulden und somit den Ertrag ihrer Anlagen besonders stark hebeln können. Normalerweise sollte man erwarten, dass reiche Leute besonders viel Geld für Spenden erübrigen können. Durch unsere Geldpolitik entstehen jedoch gerade für vermögende Menschen äußerst starke Anreize, nicht nur das eigene Vermögen bis zum letzten Heller zu investieren, sondern per Kreditaufnahme auch noch die Ersparnisse anderer (ärmerer) Menschen zu nutzen. Die Welt steht auf dem Kopf!
Franziskus beschreibt unsere verkehrte Welt in diesen Worten: „Heute spielt sich alles nach den Kriterien der Konkurrenzfähigkeit und nach dem Gesetz des Stärkeren ab, wo der Mächtigere den Schwächeren zunichte macht“ (§ 53). Das trifft durchaus den Kern der Sache. Ebenso zutreffend ist es, von einem „Fetischismus des Geldes“ und von der „Diktatur einer Wirtschaft ohne Gesicht und ohne wirklich menschliches Ziel“ (§ 55) zu sprechen. Nur handelt es sich eben nicht um ein Diktat „des“ Kapitalismus. Das Diktat kommt vom Staat.
Franziskus geißelt jene „Ideologien“, die „die absolute Autonomie der Märkte und der Finanzspekulation verteidigen“ (§§ 56, 202). Dem kann wohl kaum widersprochen werden. Allerdings ist wiederum – ganz im Sinne des Papstes – zu unterstreichen, dass diese Autonomie kein Wesenszug einer wirklich freien Gesellschaft ist, sondern gerade daraus entspringt, dass die Finanzmärkte seit geraumer Zeit durch massive staatliche Eingriffe zu dieser Spekulation ermuntert werden.
Dieser Beitrag ist in DER HAUPTSTADTBRIEF Ausgabe 119 erschienen.
DER HAUPTSTADTBRIEF ist ein Informations- und Hintergrunddienst aus Berlin und erscheint als gedruckte Ausgabe im Magazinformat und als Online-Ausgabe im Internet.
—————————————————————————————————————————————————————————
Jörg Guido Hülsmann ist Professor für Ökonomie an der Universität Angers in Frankreich und Autor von «Ethik der Geldproduktion» (2007) und «Mises. The Last Knight of Liberalism» (2007). Zuletzt erschienen «Krise der Inflationskultur» (2013). Jörg Guido Hülsmann ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirates des „Ludwig von Mises Institut Deutschland“.