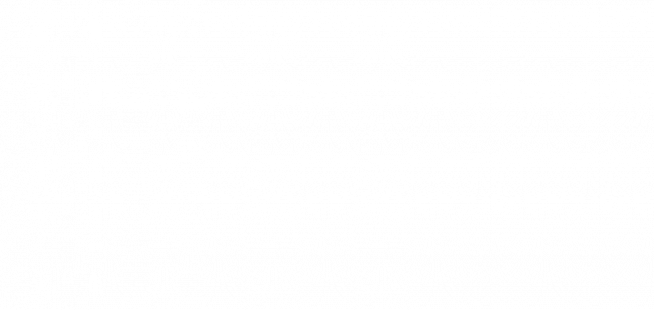Was ist optimale Geldpolitik?
1.12.2017 – von Karl-Friedrich Israel.
Die moderne Makroökonomik ist spätestens seit den Beiträgen der neuklassischen Ökonomen Finn E. Kydland und Edward C. Prescott aus den 1970er Jahren auf der Suche nach der optimalen Regel für die Geldpolitik. Vorher hatte bereits Milton Friedman (1912 – 2006) die Vorzüge einer einfachen und konstanten Geldmengenwachstumsregel analysiert. Ihm zufolge sei eine Ausweitung der Geldmenge mit konstanter Rate zwischen 3 bis 5% pro Jahr geeignet, makroökonomische Fluktuationen weitestgehend zu glätten und zu beseitigen.
Tatsächlich lässt sich zeigen, wie nach Einführung der Federal Reserve (Fed) im Jahr 1913 die Rate der Geldmengenausweitung stärker fluktuierte als zuvor. Dies legte die These nahe, dass die Zentralbankpolitik der Fed zur allgemeinen Instabilität der Volkswirtschaft, und nachfolgend insbesondere zur großen Depression, beigetragen hat. Aus der Sicht von Milton Friedman bestand die Lösung des Problems aus zwei wesentlichen Schritten.
Zum einen hielt er es für vernünftig, das Teilreservesystem und damit die Giralgeldschöpfung der Geschäftsbanken abzuschaffen. So hätte die Zentralbank eine bessere und direkte Kontrolle über die Geldmenge in der Volkswirtschaft. Zum anderen müssten Zentralbanker von aktiven geldpolitischen Interventionen Abstand nehmen. Sie sollten lediglich passiv für die konstante und relativ moderate Ausweitung der Geldmenge sorgen, denn das sorge für allgemeine Preisstabilität. Weder der eine noch der andere Schritt sind in der Praxis je umgesetzt worden.
Die Problematik einer solchen Regelbindung der Geldpolitik wurde tiefergehend von den Neuklassikern analysiert. Sie haben unter anderem auf den Inflationsbias von Zentralbanken hingewiesen. Es gäbe demnach eine natürliche Tendenz, die Geldmenge stärker auszuweiten, als es eigentlich versprochen war, da man aufgrund einer solchen monetären Überraschung realwirtschaftlich profitieren könne.
Auf lange Sicht sei eine solche Geldpolitik aber mit erheblichen Kosten verbunden. Entweder hätte man langfristig zu hohe Preisinflation, oder man müsste die Geldexpansion zurückdrosseln, um wieder zur erwünschten Preisstabilität zu gelangen. Dies wäre dann kurzfristig mit realen Einbußen in der Beschäftigung und Gesamtproduktion verbunden. Der kurzfristige Nutzen der Geldexpansion sei also immer mit längerfristigen Kosten der einen oder anderen Form verbunden. Die Neuklassiker haben damit gezeigt, wie wichtig eine feste Regelbindung ist. Für eine langfristig optimale Geldpolitik müsse man auf kurzfristige Vorteile verzichten.
In der heute gängigen Makroökonomik werden optimale Regeln der Geldpolitik innerhalb so genannter DSGE (Abkürzung für „Dynamic stochastic general equilibrium“) Modelle formal hergeleitet. Die am weitesten verbreiteten Regeln dieser Art sind Taylor Rules. Ihnen zufolge sollte der nominale Zentralbankzinssatz in Abhängigkeit des natürlichen Zinses, der Preisinflationsrate und der Produktionslücke gesetzt werden. Man ist also von einer konstanten Wachstumsrate à la Friedman abgekommen. Der Zins ist zur relevanten Steuerungsvariable geworden.
Die Produktionslücke ist die Abweichung der realisierten Gesamtproduktion von ihrem langfristigen Potential. Typischerweise liegt die realisierte Produktion in Boom-Zeiten über dem Potential. Dann sollte der Zins tendenziell erhöht werden. In Krisenzeiten liegt die realisierte Produktion hingegen unter ihrem Potential, und der Zinssatz sollte gesenkt werden, um die Wirtschaft anzukurbeln.
Der natürliche Zins entspricht dem realen Gleichgewichtszins, der sich im neuklassischen Grundmodell mit perfektem Wettbewerb und perfekter Preis- und Lohnflexibilität einstellen würde. Wenn dieser fiktive Zins nach Auffassung der Experten sinkt, aus welchen Gründen auch immer, so sollte auch der Leitzinssatz von der Zentralbank gesenkt werden, um eine allgemeine Absenkung des Zinsniveaus in der Volkswirtschaft herbeizuführen. Es sollte also Aufgabe der Zentralbanken sein, den tatsächlichen realen Zins an den vermuteten natürlichen Zins heranzuführen.
Das Problem in der Praxis ist, dass lediglich die Preisinflationsrate eine wohldefinierte und beobachtbare Größe ist. Sie ist definiert als die prozentuale Änderung eines gewichteten Durchschnitts ausgewählter Güterpreise am Markt. Allerdings sind weder der natürliche Zins noch das langfristige Produktionspotential einer Volkswirtschaft mess- oder beobachtbar. Sie müssen durch mehr oder weniger willkürliche Schätzungen gewonnen werden. Es ist somit keinesfalls offensichtlich, inwiefern eine solche Regel vor politischer Willkür schützt.
Von diesem praktischen Problem abgesehen, ist zudem auch fraglich, wie man überhaupt dazu kommt, eine solche Regel als optimal zu bezeichnen. Sie ist optimal in Bezug auf was genau?
Innerhalb moderner DSGE-Modelle werden diese Regeln als wohlfahrtsmaximierend ausgewiesen. Das heißt, dass sie die postulierte Nutzenfunktion eines repräsentativen Haushalts maximieren. Ein DSGE-Modell liefert also nicht nur eine in sich geschlossene Darstellung der Volkswirtschaft in Form eines Gleichungssystems, sondern beinhaltet darüber hinaus auch ein Kriterium für die optimale Geldpolitik. Generell gilt, dass man für jedes gegebene System ein Optimum nur dann bestimmen kann, wenn ein geeignetes Kriterium vorausgesetzt wird.
Im Grunde ist jedem klar, dass aus einem rein formalen DSGE-Modell allein keine weitreichenden Schlussfolgerungen für die politische Praxis gezogen werden können. In der Praxis besteht jedoch genau das gleiche Problem wie in der Modellwelt: Wir sind mit dem realen und überaus komplexen System einer Volkswirtschaft oder eines Währungsraums konfrontiert. Eine bestimmte geldpolitische Regel als optimal zu deklarieren, erfordert auch hier ein Kriterium und mithin Werturteile.
Spätestens seit den einflussreichen Arbeiten von Max Weber (1864 – 1920) gilt für die meisten Ökonomen jedoch der Grundsatz: Die Volkswirtschaftslehre sollte wertfrei sein. Der penible Kritiker wäre wohl geneigt darauf hinzuweisen, dass dieser Grundsatz selbst ein Werturteil darstellt. Aber das größere Problem ist, dass er niemals eingehalten werden kann, sofern sich Ökonomen anschicken, Politikempfehlungen abzugeben. Politikempfehlungen setzen ein Ziel, also einen erstrebenswerten Zustand der Volkswirtschaft, voraus. Sie beinhalten also immer ein Werturteil.[1]
So ist es eben auch mit der Frage nach der optimalen Geldpolitik. Eine Antwort auf diese Frage beinhaltet notwendigerweise ein Werturteil. Wenn dies aber so ist, auf welches Kriterium oder Werturteil könnte man sich am ehesten verständigen? Üblicherweise herrscht keine Einigkeit unter den Geldnutzern, und sie kann auch nicht ohne weiteres durch Verhandlungen erzielt werden. Wenn man also die subjektive Wertlehre ernst nimmt, so müsste man sich auf jenes Kriterium besinnen, dass den subjektiven Werturteilen jedes einzelnen gleichviel Raum lässt.
Dies ist das Kriterium der demonstrierten Präferenz. Man müsste zunächst den Geldnutzern volle Autonomie über die Wahl des Geldes lassen. Alle gesetzlichen Privilegien bestimmter Geldarten müssten aufgehoben werden. Es dürfte kein gesetzliches Zahlungsmittel geben. Es müsste also genuine Währungskonkurrenz herrschen.
Unter diesen Umständen wäre es möglich, dass sich über einen längeren Zeitraum unter den verschiedenen bestehenden Alternativen wie etwa Kryptowährungen, Edelmetallen oder Papierwährungen ein bestimmtes Geld durchsetzt, sodass es als allgemein anerkanntes Tauschmittel gelten kann. In diesem Fall könnte man sagen, dass dieses Geld unter den gegebenen Alternativen aus Sicht der Geldnutzer das Beste ist. Alle Maßnahmen vonseiten der Produzenten des frei ausgewählten Geldes, die deren Eigenschaften wie etwa seine Menge und seine physische oder digitale Form beeinflussen, können sodann als „optimale Geldpolitik“ aus Sicht der Geldnutzer bezeichnet werden.
Die etwas paradoxe Schlussfolgerung ist, dass man den gesetzlichen Sonderstatus von Zentralbanken und dem von ihnen produzierten Fiatgeld aufheben müsste, um herauszufinden, ob ihre Geldpolitik wirklich optimal ist. Der Fakt, dass die meisten Menschen dieses Geld tatsächlich als Tauschmittel nutzen, kann nicht als Nachweis einer demonstrierten Präferenz gelten, da es den Geldnutzern als gesetzliches Zahlungsmittel zu einem gewissen Grad aufgezwungen wird. Sollte sich das (Zentralbank-)Geld auch ohne gesetzliche Privilegien im Währungswettbewerb als allgemein anerkanntes Tauschmittel durchsetzen, so könnten die Zentralbanker mit dem Brustton der Überzeugung ihre Politik als „optimal“ bezeichnen.
Die Vermutung liegt allerdings nahe, dass ihre Geldpolitik unter echten Wettbewerb eine ganz andere wäre, als sie es heute ist.

[1] Hierzu sei auf den wichtigen Artikel Toward a Reconstruction of Utility and Welfare Economics von Murray Rothbard verwiesen.
——————————————————————————————————————————————————————————–
Karl-Friedrich Israel, 28, hat Volkswirtschaftslehre, Angewandte Mathematik und Statistik an der Humboldt-Universität zu Berlin, der ENSAE ParisTech und der Universität Oxford studiert. Zur Zeit absolviert er ein Doktorstudium an der Universität Angers in Frankreich.
*****
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Institut Deutschland wieder.