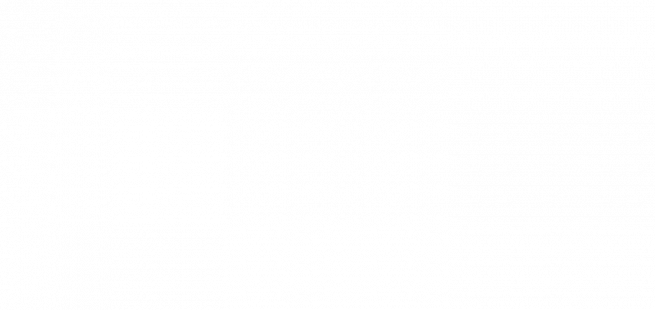Bürokratiemonster „Staat“
17.10.2016 – Bürokratie fällt nicht vom Himmel und schon gar nicht kommt sie aus dem Markt, wie die jüngste Kapitalismuskritik weismachen will. Eine Entgegnung an David Graeber.
von Jörg Guido Hülsmann.
Der amerikanische Anthropologe und politische Aktivist David Graeber beginnt sein gerade auf Deutsch erschienenes Buch Bürokratie – Die Utopie der Regeln mit der richtigen Feststellung, dass unsere westlichen Gesellschaften durch und durch bürokratisiert sind – und zwar so gründlich, dass wir es schon kaum mehr wahrnehmen. „Bürokratie“, so Graeber, „ist heute das Wasser, in dem wir schwimmen.“
Wie sind wir in diese Lage geraten? Graeber bietet eine originelle Antwort: weil wachsende Bürokratien eine notwendige Begleiterscheinung wachsender Märkte seien. Er schreibt: „Historisch sind Märkte eine Nebenwirkung staatlichen Handelns, vor allem militärischer Unternehmungen, oder sie wurden unmittelbar durch staatliche Politik geschaffen. Dies gilt zumindest seit der Erfindung der Münzprägung, die als Mittel entwickelt wurde, um Soldaten zu entlohnen.“ Er sieht hier ein „ehernes Gesetz des Liberalismus“ am Werk: „Jede Marktreform, jede Regierungsinitiative, die den Amtsschimmel bändigen und die Marktkräfte fördern will, resultiert in der Zunahme von Vorschriften, Verwaltungsarbeit und der vom Staat beschäftigten Bürokraten.“
Um Graebers These gebührend zu würdigen, lohnt es sich, das Thema zunächst im Lichte der auf Ludwig von Mises zurückgehenden ökonomischen Bürokratietheorie aufzurollen, die auch von Graeber ausdrücklich genannt wird. Mises betrachtet die Bürokratie aus volkswirtschaftlicher Sicht, als „ein Prinzip der Verwaltungstechnik und der Organisation“. Er definiert dieses Prinzip in seinem erstmals 1944 auf Englisch erschienenen Buch Die Bürokratie wie folgt: „Bürokratisch heißt die Art der Geschäftsführung, die sich an genaue Regeln und Vorschriften halten muss, welche wiederum von der Autorität einer übergeordneten Person festgelegt werden.“
Mises argumentiert, dass eine bürokratische Organisation im Falle von privatwirtschaftlichen Firmen überflüssig und sogar schädlich ist. Dagegen ist sie zur Führung staatlicher Ämter geradezu unerlässlich. Und sie wird auch zur Führung von Firmen notwendig, wenn diese in den Sog staatlicher Regulierung oder staatlicher Förderung geraten – ein Gedanke, dessen nähere Beleuchtung aus heutiger Sicht tatsächlich eine bestechende Aktualität hat.
Privatwirtschaftliche Firmen agieren innerhalb eines Geflechts aus Verträgen mit Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten. Sie kaufen und verkaufen Waren und Dienste. Ihr Erfolg wird an Geldgewinn und Geldverlust gemessen. Alle Regeln, die die Geschäftsleitung für den internen Gebrauch erlässt, sind immer nur Mittel zum Zweck – sie sind kein Selbstzweck, da ihr Nutzen sich an der Gewinnerzielung misst, und sie können jederzeit geändert werden. Irgendwelche „obersten“ Regeln sind weder nötig noch hilfreich.
Auch ist es in Firmen möglich, die Geschäftsleitung aufzuteilen, ohne dafür ein besonderes Regelwerk aufzustellen. Die einzige Maßgabe an die untergeordneten Geschäftsführer lautet dann, den Gewinn zu maximieren. Es kann ihnen völlig freigestellt werden, was sie zu diesem Zwecke entscheiden, wie sie ihre Produktion, ihre Einkaufs- und Vertriebskanäle organisieren, welche Mitarbeiter sie einstellen und entlassen und so weiter. Die Qualität ihrer Entscheidungen misst sich an den kalten Zahlen der Wirtschaftsrechnung – in Gewinnen, Verlusten und Rendite.
Ganz anders liegen die Dinge in staatlichen Ämtern: Deren Dienste werden im Gegensatz zu den Produkten von Firmen entweder gar nicht verkauft – oder sie werden auch dann erbracht, wenn sie nicht viele Kunden finden. Die Dienste von Polizei, Militär und Justiz können daher ebenso wenig an Marktpreisen gemessen werden wie die Dienste des Sozialamtes oder des Einwohnermeldeamtes. Es ist in all diesen Fällen unmöglich, den Erfolg der Amtsführung am Kriterium des Geldgewinns auszurichten.
Aus dem gleichen Grund wäre es auch nicht ratsam, die Wahl der Mittel dem Amtsinhaber zu überlassen. Man kann dem Leiter einer Polizeibehörde nicht den Auftrag erteilen, für größtmögliche Sicherheit zu sorgen, ohne gleichzeitig nähere Ausführungsbestimmungen zu erlassen. Die leitenden Angestellten von Firmen können die ihre Aufgaben betreffenden Entscheidungen auf Grundlage der Wirtschaftsrechnung treffen. In staatlichen Ämtern ist das nicht möglich. Könnte etwa ein Polizeipräsident völlig frei schalten und walten, wäre seine persönliche Willkür potentiell unbegrenzt – und die Verschwendung von Mitteln vorprogrammiert. Daher verlangt die Führung einer staatlichen Behörde die Anwendung bürokratischer Methoden. Der Amtsführung müssen die Ziele möglichst genau vorgegeben werden, und auch die anzuwendenden Mittel sind nach Umfang und Art möglichst genau zu bestimmen. Solche Regeln müssen im bürokratischen Betrieb zwangsläufig „oberste“ Regeln sein.
Bürokratische Organisationsformen haben nach Ludwig von Mises ihren guten Sinn in dem Bereich, in dem sie traditionell zur Anwendung gekommen sind: in der staatlichen Verwaltung. Nichts könnte sie in diesem Bereich ersetzen. Insbesondere ist es völlig verfehlt, öffentliche Ämter wie private Firmen führen zu wollen, indem man Managementmethoden der Privatwirtschaft einführt. Solche Versuche einer vermeintlichen „Privatisierung“ beziehungsweise „Deregulierung“ sind von Angang an zum Scheitern verurteilt. Sie führen regelmäßig zum genauen Gegenteil des angestrebten Zieles, indem sie den bürokratischen Aufwand erhöhen statt vermindern.
Ebenso wenig hat die Privatwirtschaft irgendeinen Anlass, das bürokratische Modell zu übernehmen. Und dennoch ist genau diese Bürokratisierung häufig auch in der Privatwirtschaft zu beobachten. Grund ist die staatliche Regulierungswut. Firmen müssen vielerlei soziale, ökologische, gleichstellungsbezogene und andere Vorgaben berücksichtigen, die ihnen das Gesetz auferlegt. Solche Vorschriften sind dann auch für sie „oberste“ Regeln, die sie nicht einseitig abschaffen oder ändern können. Das zwingt sie zur Übernahme bürokratischer Arbeitsweisen. Genau wie die staatlichen Bürokratien müssen sie sich an genaue Regeln und Vorschriften halten.
Die meisten staatlichen Interventionen wirken direkt repressiv. Sie verbieten und gebieten, und die Überwachung dieser Vorschriften macht den Aufbau von Bürokratien erforderlich. Aber die staatliche Regulierungswut wirkt noch auf andere Art bürokratiebildend – und zwar dann, wenn sie zunächst einmal permissiv, sprich nachgiebig und flexibel wirkt. Beispiele dafür bieten etwa das staatliche Gesundheitssystem und das staatliche Geldsystem. Der Staat gewährt dabei jeweils „kostenlose“ Leistungen, die perverse Anreize zu Fehlverhalten schaffen. Das staatliche Gesundheitssystem toleriert ungesunde Lebensweisen, indem die Gemeinschaft der Zwangsversicherten solidarisch für die Folgekosten aufkommen muss. Das Zentralbankwesen ermuntert Staat und Großbanken zu schlechtem Finanzgebaren, da auch hier die Gemeinschaft der Geldverwender in erzwungener Solidarität für die Kosten aufzukommen hat.
Die Ausschweifungen und Missbräuche, die durch das permissive Eingreifen des Staates überhaupt erst möglich werden, führen über kurz oder lang zum finanziellen Zusammenbruch der betreffenden „Systeme“. Um diesem Zusammenbruch vorzubeugen beziehungsweise ihn hinauszuzögern, wird typischerweise mit repressiven Maßnahmen nachgebessert. Den Versicherten des Gesundheitssystems wird vorgegeben, bei welchen Ärzten sie sich mit welchen Methoden behandeln lassen dürfen. Den Banken wird auferlegt, an wen und zu welchen Konditionen sie Geld verleihen dürfen, wie sie diese Kredite finanzieren dürfen und so fort. Zur Überwachung solcher Vorschriften ist dann natürlich wieder Bürokratie erforderlich.
Diese permissive Tendenz war immer schon mit staatlichen Leistungen verbunden. Sie hat sich seit Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Aufkommen des Wohlfahrtsstaates verstärkt. In der Nachkriegszeit und vor allem seit 1968 hat sie geradezu sprunghaft neue Höhen erklommen. Der permissive Staat hat einer systematischen Entkopplung von Handeln und Haftung den Weg geebnet. Kurz: Er hat zur Verantwortungslosigkeit in allen Lebensbereichen geführt, von der Gesundheit über die Kindererziehung und die Einwanderung bis zum Geld. Um dem entgegenzusteuern, wurden immer neue und immer größere Bürokratien ins Leben gerufen. Ohne Zweifel ist das ein „ehernes Gesetz“ des heutigen Etatismus.
Wie reimt sich nun diese Sicht der Dinge mit dem, was uns David Graeber in seinem Buch bietet? Graeber versteht sich als Vertreter eines marktfeindlichen „linken“ Anarchismus. Es kann somit nicht überraschen, dass ihn die ausufernde Bürokratie vor ein Problem stellt. Denn sie ist im Urteil fast aller Menschen geradezu das Gegenteil des Marktes. Wer gegen den Markt ist, ist keineswegs gleichzeitig für mehr Bürokratie. Also unternimmt er den Versuch, eine „linke“ Bürokratietheorie in Abgrenzung zu der erwähnten Theorie von Ludwig von Mises zu entwickeln – was ihm nicht gelingt. Auf den 329 Seiten seines Buches findet sich erstaunlicherweise nirgends eine genaue Definition des Wortes „Bürokratie“, und in den 26 Zeilen, die sich mit Mises befassen, sind dessen wesentliche Argumente entweder gar nicht oder falsch wiedergegeben.
In einem Wort: Graebers Buch ist eine populärwissenschaftliche Schrift, die an ihrem eigenen Anspruch scheitert. Sie liest sich kurzweilig in ihrer Mischung aus wirtschaftsgeschichtlichen Behauptungen und anekdotischen, vermeintlich repräsentativen Alltagserfahrungen – nach Quellenangaben und Belegen, die seine originellen Thesen untermauern, sucht man jedoch vergebens. Er behauptet, Märkte seien eine Nebenwirkung staatlichen Handelns, aber er liefert keinen Beweis. Zwar gibt es Teilmärkte, die ausschließlich oder weitgehend auf staatlichen Eingriffen beruhen – aktuelles Beispiel: die Finanzmärkte –, aber kann daraus der Schluss gezogen werden, Privateigentum und der Tausch von Privateigentum sei ohne staatliche Eingriffe nicht möglich? Selbstverständlich nicht – jeder Kinderspielplatz liefert den Gegenbeweis.
*****
Dieser Beitrag ist zuerst erschienen in “DER HAUPTSTADTBRIEF” – Ausgabe 138.
—————————————————————————————————————————————————————————
Jörg Guido Hülsmann ist Professor für Ökonomie an der Universität Angers in Frankreich und Senior Fellow des Ludwig von Mises Instituts in Auburn, Alabama. Er ist Mitglied der Europäischen Akademie für Wissenschaften und Künste sowie Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Ludwig von Mises Institut Deutschland. Zu seinen umfangreichen Interessen- und Forschungsgebieten zählen Geld-, Kapital- und Wachstumstheorie. Er ist Autor von «Ethik der Geldproduktion» (2007) und «Mises: The Last Knight of Liberalism» (2007). Zuletzt erschienen «Krise der Inflationskultur» (2013).
Seine Website ist guidohulsmann.com
*****
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Institut Deutschland wieder.