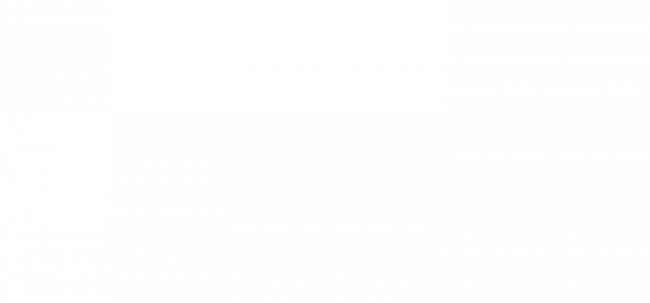Lob der Kleinstaaterei
28.2.2014 – von Björn Finke.
Auf Europa kommen finstere Zeiten zu, befürchten manche: Von Balkanisierung ist die Rede, von einem Rückfall in die Kleinstaaterei des Mittelalters. Was Kritikern so viel Angst macht, sind Unabhängigkeitsbestrebungen einiger Regionen in EU-Staaten. Im September stimmen die Schotten ab, ob sie im Vereinigten Königreich bleiben wollen. Ein Erfolg der Separatisten würde auch in Spanien oder Belgien die Debatte um die Einheit des Staates wieder anheizen. Dort gibt es unter Basken, Katalanen sowie Flamen den Wunsch nach Unabhängigkeit.
Die Regierungen in London, Madrid oder Brüssel mögen sich zu Recht gruseln bei der Vorstellung, demnächst eventuell über weniger Land, Volk und Wirtschaftskraft zu gebieten. Aber das ist nicht entscheidend für die Frage, ob Separatismus und Kleinstaaterei eine Bedrohung für Europa darstellen – oder ob sie ganz im Gegenteil sogar sinnvoll sind. Entscheidend sind die Interessen der Betroffenen, der Bürger in den Regionen. Welches Staatsgebilde trägt mehr zu Wohlstand und Sicherheit bei, ist näher dran an den Wünschen und Sorgen der Menschen: ein neu zu gründendes Mini-Land oder der bisherige große Staat?
Vor 40 Jahren noch wäre die Antwort in Europa klar zugunsten großer Gebiete ausgefallen. Staaten mit vielen Bürgern hatten wichtige Vorteile. Zwar gab es damals schon die EG, aber der gemeinsame Binnenmarkt funktionierte nicht so gut wie heute – auf dem Kontinent war Handel zwischen Staaten deutlich schwieriger als innerhalb ihrer Grenzen. Ein Land mit hoher Einwohnerzahl bot deswegen ein besseres Umfeld für Unternehmen, sie hatten einen größeren Heimatmarkt.
Doch heute spielen Grenzen in der EU keine Rolle mehr für Firmen, sie können problemlos in Nachbarländern Geschäfte treiben und müssen innerhalb der Euro-Zone zudem keine Wechselkurs-Schwankungen mehr fürchten. Für die Bürger verlieren Grenzen ebenfalls an Bedeutung; Reisen, Arbeiten oder Studieren im EU-Ausland ist viel einfacher als früher.
Das spielt Separatisten in die Hände: Dank der Perspektive, in die EU oder gar die Euro-Zone aufgenommen zu werden, verliert eine Abspaltung ihren wirtschaftlichen Schrecken. Zugleich müssen kleine Länder in Europa nicht mehr fürchten, von mächtigen Nachbarn erobert zu werden. Über Jahrtausende war Staatsgröße wichtig für die Frage, ob Bürger in Angst vor Invasionen leben müssen. Große Reiche konnten große Armeen unterhalten und kleine Länder dominieren. Heute ist ein Krieg zwischen EU-Staaten nicht vorstellbar, dank der engen Zusammenarbeit in Brüssel. Geht es um Bedrohungen von außerhalb Europas, bietet eine Mitgliedschaft in der Nato Schutz.
Die Nachteile der Kleinstaaterei haben sich in Europa also weitgehend verflüchtigt – bleiben die Vorteile: In kleineren Ländern ist die Regierung oft näher dran an den Bedürfnissen der Menschen, sie kann auf deren Vorlieben besser eingehen. Das ist ja gerade der Grund für die Unabhängigkeitsbewegungen. Viele Bürger in den abspaltungswilligen Regionen sehen sich schlecht vertreten in ihrem bisherigen Staat, sie wollen eine andere Politik, wollen ihre eigene kulturelle Identität leben. Manchen geht es auch ganz schnöde ums Geld; sie möchten nicht, dass die Zentralregierung ihre Steuern nutzt, um ärmeren Ecken in dem Land zu helfen. Das klingt nicht sonderlich sympathisch, aber Solidarität gedeiht eben nur dort, wo sich Menschen einer gemeinsamen Gruppe zugehörig fühlen. Ist dieses Gefühl nicht mehr da, empfinden die Bürger in reichen Gegenden Steuertransfers in die armen schnell als Zumutung.
Manch zerrüttete Ehe kann man nicht mehr retten, hier ist Scheidung das Beste. Gleiches gilt für Staaten: Will die große Mehrheit der Bewohner einer Region die Trennung vom Mutterland, sollte ihr das niemand verwehren.
Wobei es noch eine Alternative zur Scheidung gibt – den Föderalismus. Hierbei erhalten die Regionen eigene Parlamente und Regierungen und können über das meiste selbst bestimmen, was den Bürgern wichtig ist. Die Zentralregierung kümmert sich nur um wenige ausgewählte Themen, etwa Verteidigung und Außenpolitik. Die Regionen in Spanien, Belgien und Großbritannien haben bereits eigene Parlamente. Doch im Vergleich zu den US-Bundesstaaten besitzen sie wenig Macht, alles dreht sich um die nationalen Hauptstädte. Möchten Großbritannien, Spanien und Belgien ihre unzufriedenen Regionen halten, sollten sie ihnen also mehr Einfluss gewähren.
Und wenn das nichts ändert? Verlangt die Mehrheit trotzdem die Abspaltung, sollte sie ihren Willen bekommen. Kleinstaaterei ist nicht schlimm.
Dieser Beitrag ist zuerst am 17.2.2014 in der Süddeutschen Zeitung erschienen.
—————————————————————————————————————————————————————————-
Björn Finke: geboren 1976 in Düsseldorf, Studium der Volkswirtschaftslehre, Politikwissenschaft und Soziologie an der Universität zu Köln und der London School of Economics and Political Science (Abschluss 2002 als Master of Science in European Social Policy), danach Besuch eines Graduiertenkollegs der Universität Bremen. Außerdem Absolvent der Kölner Journalistenschule für Politik und Wirtschaft, seit 2004 bei der Süddeutschen Zeitung in München und seit 2013 SZ-Wirtschaftskorrespondent in London.