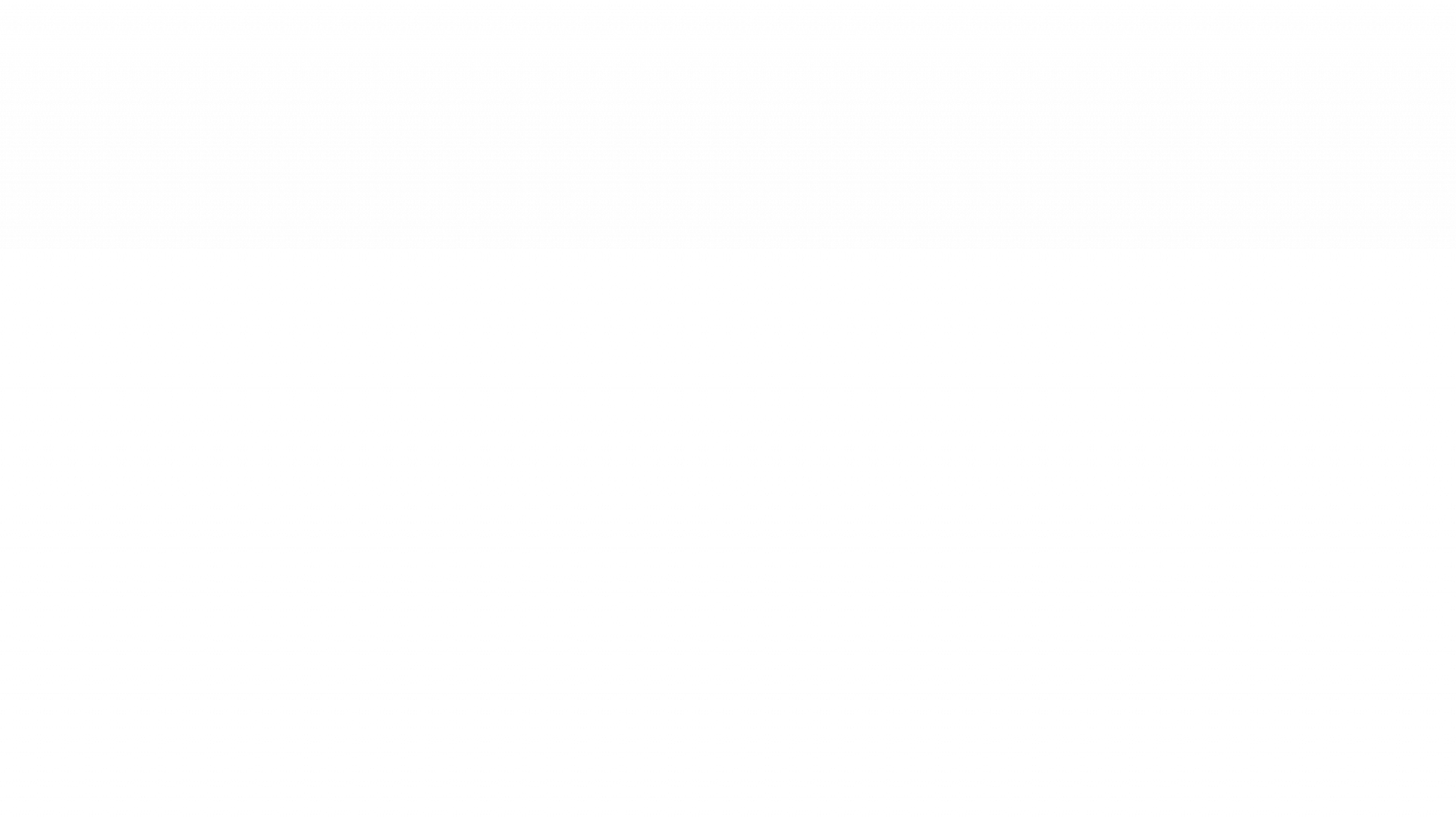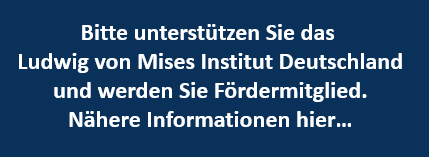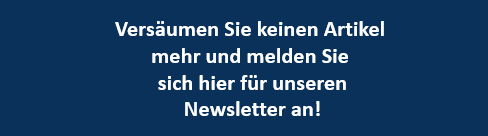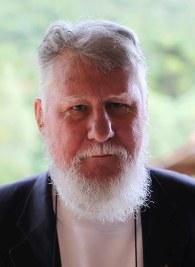Das Gesetz der Assoziation | Praxeologie IV
15. August 2025 – von Antony P. Mueller
[Jetzt HIER KLICKEN, um den Beitrag als PODCAST-FOLGE anzuhören.]
Dies ist der vierte Teil der Reihe über die Praxeologie bei Ludwig von Mises auf der Grundlage seines Werkes „Nationalökonomie. Theorie des Handelns und des Wirtschaftens“ aus dem Jahre 1940. Den ersten Teil finden Sie HIER, den zweiten Teil HIER und den dritten HIER. Im vorliegenden Teil geht es um das sogenannte „Gesetz der Assoziation“.
Das auf den britischen Nationalökonomen David Ricardo (1772 – 1823) zurückgehende „Gesetz der Assoziation“ besagt, dass die Arbeitsteilung auch dann vorteilhaft ist, wenn eine der Parteien vergleichsweise weniger produktiv ist. Diese Theorie der komparativen Kostenvorteile wird heute meist nur noch in Bezug auf den Außenhandel gelehrt, dabei sollte es aber auf jedem Schullehrplan einen herausragenden Platz einnehmen.
Die Anwendung des Prinzips der Assoziation auf den internationalen Handel stellt eine Einengung dar. Die wahre Bedeutung dieses Theorems entfaltet sich, wenn man es auf menschliche Beziehungen im Allgemeinen anwendet, also praxeologisch deutet. Jenseits der Bedeutung für den internationalen Handel enthält dieses Gesetz dann eine erkenntnistheoretische und ethisch-gesellschaftliche Dimension. Es begründet das Prinzip der menschlichen Zusammenarbeit: Eine friedliche, kooperative Ordnung, in der selbst ‚Ungleiche‘ voneinander profitieren können – nicht trotz, sondern gerade wegen ihrer Unterschiede.
Ludwig von Mises Institut Deutschland Konferenz 2025
Gesellschaft, so Ludwig von Mises (Nationalökonomie, 1940, S. 125) „ist das Zusammenhandeln, Zusammenwirken und Zusammengehen der Menschen, das in der Arbeitsteilung seinen Ausdruck findet.“ Wenn somit praxeologisch die Arbeitsteilung das Grundprinzip der Vergesellschaftung ist, so erscheint die „Arbeitsvereinigung“ als ihr Gegenstück und bezeichnet den eigentlichen Sinn von Gesellschaft. Anders ausgedrückt: Arbeitsteilung und Arbeitsvereinigung sind zwei Seiten derselben Medaille. Beide Aspekte sind nötig, um das Wesen der Gesellschaft zu bestimmen.
Die Gesamtproduktivität, und damit der Wohlstand einer Gesellschaft, erhöht sich durch Spezialisierung, die auf Arbeitsteilung beruht. Dabei ist nicht der absolute Vorteil entscheidend, dass der eine das tut, was ein anderer nicht kann, sondern der relative Vorteil. Auch diejenigen, die durchwegs weniger produktiv sind, gewinnen von der arbeitsteiligen Zusammenarbeit. Arbeitsteilung lohnt auch dann, wenn einer der Partner in allen Produktionsbereichen eine höhere Leistungsfähigkeit als der andere hat. Durch den Tausch gewinnt auch die Person mit der niedrigeren Produktivität. Wenn jeder sich auf seine komparative Stärke konzentriert und mit anderem Austausch betreibt, entsteht eine Ordnung, von der alle Beteiligten profitieren. Das allgemeine Gesetz der Assoziation als ein anthropologisches Prinzip besagt demnach, dass der Mensch aus rationalen Gründen nicht als isolierter Selbstversorger besser lebt, sondern in arbeitsteiliger Interaktion mit anderen. Aus der Vielfalt der Ungleichheit erwächst der Wohlstand. Das Gesetz der Assoziation widerlegt den Mythos, dass der marktwirtschaftliche Wettbewerb ein Nullsummenspiel sei, bei dem der Gewinn des einen den Verlust des anderen bedeutet. Vielmehr begründet dieses Prinzip die positiv-summative Logik der Marktwirtschaft, dass durch Spezialisierung und Tausch alle Beteiligten gewinnen. Unterschiede in Bezug auf Fähigkeiten und Ausstattung mit Produktionsfaktoren sind kein Hindernis, sondern vielmehr der Grund für produktive Zusammenarbeit. Man kooperiert aus Eigeninteresse. Der Markt funktioniert auf der Basis des freiwilligen Austausches. Marktbeziehungen entstehen ohne Zwang, weil das Eigeninteresse für die Zusammenarbeit sorgt.
Das Gesetz der Assoziation ist nicht nur ein ökonomisches Modell, sondern eine zivilisatorische Erkenntnis. Es beschreibt, warum friedliches Zusammenleben nicht nur moralisch wünschenswert, sondern auch wirtschaftlich vernünftig ist. In einer Welt der Knappheit und individueller Verschiedenheit zeigt es den Weg zu gegenseitigem Nutzen durch Spezialisierung und Austausch.
Ungleichheit der individuellen Fähigkeit und der geografischen Lage bedingen unterschiedliche Produktivitätsniveaus desselben Gutes.
Die arbeitsteilig verrichtete Arbeit bringt höhere Erträge als die Arbeit des für sich allein arbeitenden Einzelnen. Die Erkenntnis dieses Umstandes hat die Menschen veranlasst, die Einzelarbeit und das gesonderte Handeln durch die Arbeitsvereinigung und Arbeitsteilung, durch das Zusammenwirken und Zusammenhandeln, zu ersetzen. (S. 128)
Das Vergesellschaftungsgesetz erklärt, warum es die Einzelnen dazu treibt, sich nicht als Konkurrenten im Kampf um die Aneignung von knappen Unterhaltsmitteln zu betrachten. Dieses Prinzip erklärt, was die Menschen „fortdauernd veranlasst, sich zu gemeinsamem Handeln zusammenzuschließen“. Damit Gesellschaft entsteht, braucht es nicht eines „Gesellschaftsvertrages“. Vielmehr ist „die Kraft, die gesellschaftliche Bindung entstehen lässt und sie fortschreitend verdichtet, … menschliches Handeln, das der Einsicht in die höhere Ergiebigkeit des Zusammenhandelns und Zusammenwirkens durch Arbeitsteilung entspringt.“ (ebd.)
[(*) Mit * gekennzeichnete Links sind Partner-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, unterstützen Sie das Ludwig von Mises Institut Deutschland, das mit einer Provision beteiligt wird. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten.]
Dieser Zusammenhang lässt sich einfach an einem arithmetischen Beispiel darstellen. Wenn A, auf eine bestimmte Zeiteinheit bezogen, von Gut X 6 Gutseinheiten und von Gut Y 10 Einheiten zu erzeugen vermag, B aber nur jeweils 3 von X und 2 Einheiten von Y, dann ist A bei der Produktion von Gut X doppelt so produktiv wie A und bei der Produktion von Y fünfmal mehr als B. Bei beiden Gütern ist A demnach B bei der Produktivität haushoch überlegen. Trotzdem lohnt sich die Spezialisierung – und entsprechend der Gütertausch –, wenn jeder seine Produktionstätigkeit auf seine jeweiligen komparativen Kostenvorteile ausrichtet. Vor der Spezialisierung ergibt sich aufaddiert eine gesamte Produktion von 6 + 3 Einheiten von Gut X und von 10 + 2 Einheiten bei Gut Y, zusammen also 21 Gutseinheiten. Wenn sich nun A ganz auf die Produktion verlagert, wo er den höchsten komparativen Vorteil hat, wird er sich auf die Herstellung von Y konzentrieren und somit in derselben Zeiteinheit 20 Einheiten erzeugen können. B würde sich entsprechend auf die Herstellung des Gutes konzentrieren, wo er weniger komparative Nachteile hat, und kann durch Spezialisierung auf das Gut X eine Produktion von 6 Einheiten erbringen. Der Gesamtoutput steigt nun auf 26 gegenüber 21 Einheiten. Dieser Zuwachs geschieht ohne den Mehreinsatz der Produktionsfaktoren. Jeder arbeitet genau so lange wie vorher und auch der Kapitalbestand ist gleichgeblieben. Es gab keinen erhöhten Ressourcenverbrauch. Trotzdem hat der bloße Umstand des Tausches einen Zuwachs der Produktivität um rund 24 % gebracht. Je mehr Menschen bzw. Betriebe und ganze Länder sich dem Prozess der Spezialisierung anschließen, desto mehr steigt die Produktivität aller Beteiligten. Auch diejenigen, die in allen Bereichen weniger produktiv sind, nehmen an den Vorteilen der Arbeitsteilung teil. Wo Arbeitsteilung auch über die Grenzen hinweg herrscht, nimmt der Gesamtreichtum zu und selbst die Ärmsten sind dann weniger arm als ohne Kooperation.
Wenn und insoweit die Tatsache der höheren Produktivität der Zusammenarbeit von den Menschen erkannt wird, desto mehr drängt das Handeln des Einzelnen zu fortschreitender Vergesellschaftung. Dies geschieht nicht aus einem Trieb heraus, sondern folgt praxeologisch betrachtet aus dem Wesen des Handelns selbst. Von Geburt an ist der Mensch in die Gesellschaft eingebettet. Er bleibt mit ihr verbunden, weil er ohne die Gesellschaft die Zwecke seines Handelns nicht verwirklichen könnte. Die Rückbildung der Gesellschaft zu weniger weitgehender Arbeitsteilung wäre für die Menschen mit der Verschlechterung des Versorgungsstandes verknüpft. Deshalb ist es unsinnig, so Mises, dem Individualprinzip ein vermeintliches ‚Gesellschaftsprinzip‘ entgegenzusetzen.
In allen seinen Lebensäußerungen ist der Einzelne durch die Gesellschaft geformt. Auch sein Denken, an das gesellschaftliche Werkzeug der Sprache gebunden, ist durch das Leben in der Gesellschaft entwickelt worden. Kein Mensch kann sich daher der Gesellschaft und ihrem Einfluss entziehen. Auch der Einsiedler bleibt Gesellschaftsmensch; die Ideen, die ihn in die Einsamkeit treiben und die er in die Einsamkeit mitnimmt, sind im gesellschaftlichen Leben geformt worden. (S. 136)
In dieser Perspektive ergibt sich auch in bestimmter Weise die Rolle des Staates. Er repräsentiert den organisierten Teil der Gesellschaft, dessen ‚Legimitation‘ darin besteht, die arbeitsteilige Zusammenarbeit der Bürger zu fördern. Anders ausgedrückt: Der Staat verliert seine Legitimation in diesem Sinne, wenn er die Kooperation, z. B. durch Besteuerung und Reglementierung, erschwert oder gar, wenn die Staatsführung die Gesellschaft auf zerstörerische Ziele, wie z. B. Krieg oder Völkermord, ausrichtet. Aus praxeologischer Sicht gibt es demnach für den Staat ein definitives Kriterium. Staatstätigkeit ist insoweit ‚legitimiert‘, wie sie eine Verbesserung der gesellschaftlichen Kooperation ermöglicht (z. B. durch Kodifizierung von bestehenden Handelsregeln). Dagegen verliert der Staat seine Legitimation in diesem Sinne, wenn er die freiwillige Zusammenarbeit beeinträchtigt.
Die Praxeologie erklärt die Gesellschaftsbildung vollständig rational. Man muss nicht auf einen Gesellschaftstrieb zurückgreifen oder in mystischen Gemeinschaftslehren das Wesen der Gesellschaft zu ergründen versuchen. Die menschliche Gemeinschaftsbildung ist nicht metaphysischer Natur. „Sie ist auch nicht animalischer Natur: die Stimme des Blutes und des Bodens, das Band, das die Abkömmlinge gemeinsamer Stammeltern mit diesen und untereinander verbindet, und die mystische Verbundenheit zwischen dem Pflüger und dem Boden, den er bestellt.“ (S. 136)
Die Menschen kooperieren, weil es im Interesse jedes Einzelnen liegt, sich die Vorteile der Arbeitsteilung zunutze zu machen.
Nicht aus Liebe zu den Mitmenschen, sondern aus Liebe zu sich selbst zieht der in Gesellschaft lebende Mensch den Frieden und die einträchtige Zusammenarbeit dem unsozialen Gegeneinander vor. (S. 139)
Aber auch heute noch geistern gesellschaftliche Mythen umher, die Gewalt und Krieg preisen. Diese Stimmen verkennen nicht nur das Wesen der Gesellschaft, sondern auch die eigentliche Bedeutung des Krieges. „Die Kriegshandlungen selbst sind nicht nur asozial, sie sind antisozial.“ Der Begriff des Gesellschaftlichen trifft nicht auf Handlungen zu, „die auf Vernichtung des Lebens von Menschen gerichtet sind“. (S. 140)
In diesem Zusammenhang ist es bezeichnend, dass die wildeste Kriegstreiberei und die schlimmste Lobpreisung wilder Urtriebe oft von Personen kommen, die den Anforderungen der Herausforderung, die sie für die Menschen fordern, selbst in keinerlei Hinsicht genügen würden. Die „Apostel der Gewalt“ würden sich selbst zutiefst notleidend fühlen, „wenn sie auf die Errungenschaften der Kultur, deren Geringschätzung den Kern ihrer Lehre bildet“, verzichten müssten. Sie verbreiten ihre Botschaft im Schutz der bürgerlichen Sicherheit und dürfen ungefährdet ihre Brandreden halten, weil der Liberalismus, dem sie feindlich gegenüberstehen, es gewährt. (S. 142)
Zur Entstehung der Gesellschaft braucht es weder einen Gesellschaftsvertrag noch die Unterwerfung unter die Staatsgewalt. Gesellschaft entsteht aus rationaler Einsicht. Der Arbeitsteilung zuzustimmen, ist ein Produkt der Vernunft. Es ist die Einsicht, dass Zusammenarbeit allen Beteiligten Vorteile bringt. Aber diese Entscheidung zur Gesellschaft ist keine endgültige. Die Gesellschaft kann auch wieder zerfallen.
In Zeiten nationalistischer Tendenzen und globaler Unsicherheiten und der Verbreitung irreführender Thesen über Staat und Gesellschaft ist die Wiederentdeckung des allgemeinen Prinzips der Vergesellschaftung aktueller denn je – als ökonomische Wahrheit und als ethische Grundlage einer freien Gesellschaft. Die Praxeologie widerspricht jenen, die Menschsein und Gesellschaft in erster Linie mit Krieg, Feindschaft und Zerstörung verbinden und nicht mit Kooperation zum Nutzen aller. Die gesellschaftliche Arbeitsvereinigung und Arbeitsteilung beruhen auf dem friedlichen Sichvertragen. Nicht der Krieg, der Frieden ist der Vater aller gesellschaftlichen Dinge.
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Instituts Deutschland wieder.
Ebenfalls zur „Nationalökonomie“ von Antony P. Mueller kürzlich erschienen: „Was ist Praxeologie?“, „Grundkategorien der Praxeologie“ und „Das handelnde Individuum und die Gesellschaft. Praxeologie“.
Antony Peter Mueller ist promovierter und habilitierter Wirtschaftswissenschaftler der Universität Erlangen-Nürnberg, wo er von 1994 bis 1998 das Institut für Staats- und Versicherungswissenschaft in Erlangen leitete. Antony Mueller war Fulbright Scholar und Associate Professor in den USA und kam im Rahmen des DAAD-Austauschprogramms als Gastprofessor nach Brasilien.
Bis 2023 war Dr. Mueller Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Makroökonomie und Internationale Wirtschaftsbeziehungen, an der brasilianischen Bundesuniversität UFS. Nach seiner Pensionierung ist Dr. Mueller weiterhin als Dozent an der Mises Academy in São Paulo tätig und als Mitarbeiter beim globalen Netzwerk der Misesinstitute aktiv. Darüber hinaus ist er wissenschaftlicher Beirat der Partei „Die Libertären“.
In deutscher Sprache erschien 2024 sein Buch „Antipolitik“ (*), 2023 erschien „Technokratischer Totalitarismus. Anmerkungen zur Herrschaft der Feinde von Freiheit und Wohlstand“(*). 2021 veröffentlichte Antony P. Mueller das Buch „Kapitalismus, Sozialismus und Anarchie. Chancen einer Gesellschaftsordnung jenseits von Staat und Politik“(*). 2018 erschien sein Buch „Kapitalismus ohne Wenn und Aber. Wohlstand für alle durch radikale Marktwirtschaft“(*).
[(*) Mit * gekennzeichnete Links sind Partner-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, unterstützen Sie das Ludwig von Mises Institut Deutschland, das mit einer Provision beteiligt wird. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten.]
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Das Ludwig von Mises Institut Deutschland e.V. setzt sich seit Jahren für die Verbreitung der Lehre der Österreichischen Schule der Nationalökonomie ein. Freiheit gibt es nicht geschenkt, sie muss stets neu errungen und erhalten werden. Bitte unterstützen Sie daher das Ludwig von Mises Institut Deutschland mit einer Spende, damit wir uns weiterhin für unser aller Freiheit einsetzen können!
Spendenkonto:
Ludwig von Mises Institut Deutschland e. V.
IBAN: DE68 7003 0400 0000 1061 78
BIC: MEFIDEMM
Merck Finck A Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch
Verwendungszweck: Spende
Titel-Foto: Adobe Stock – bearbeitet