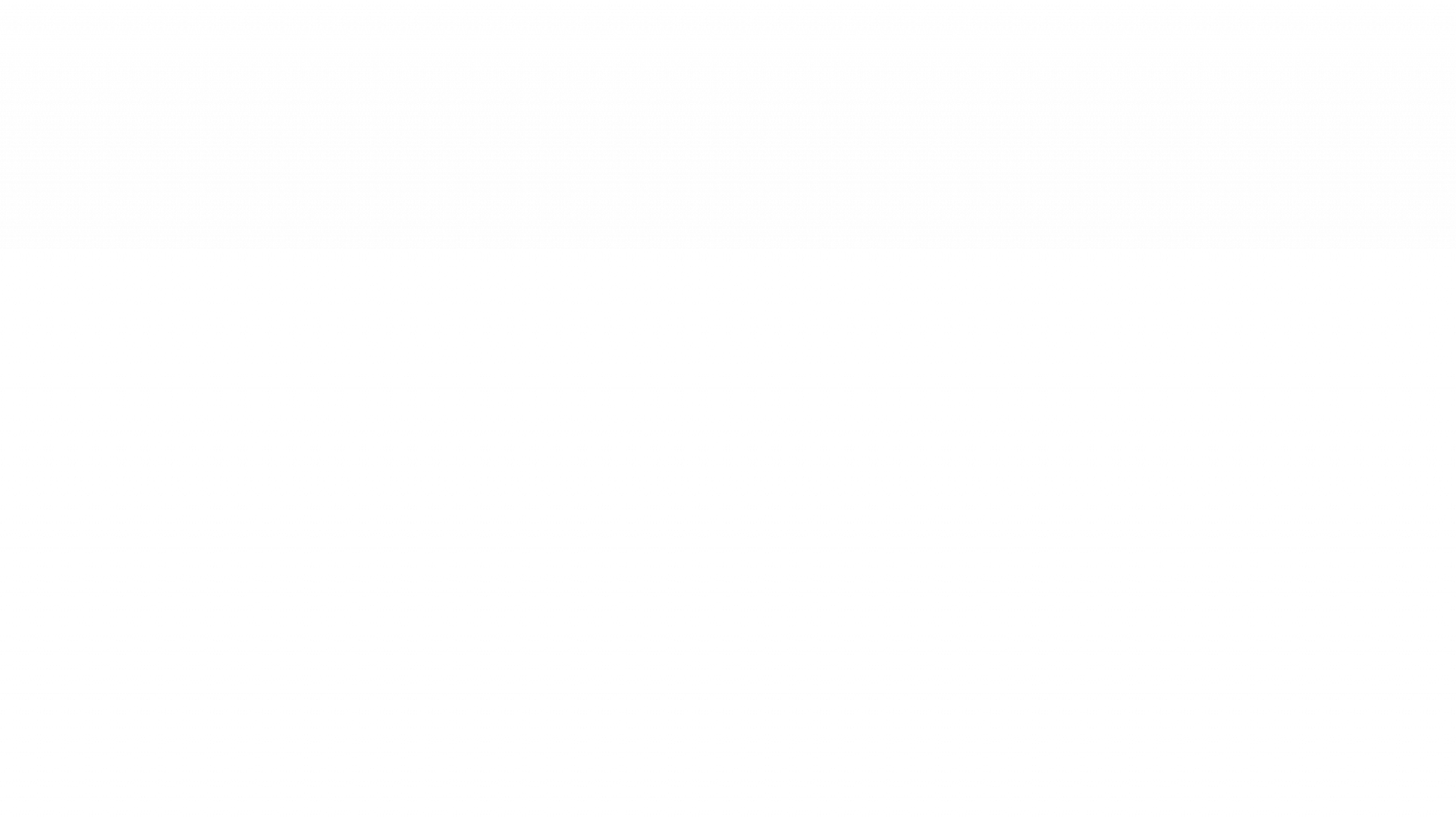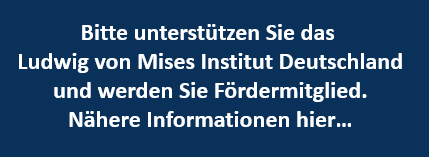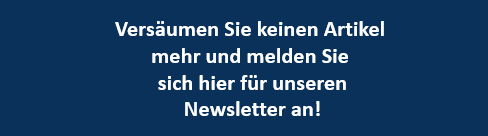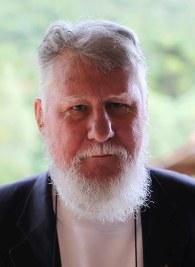Das handelnde Individuum und die Gesellschaft. Praxeologie
28. Juli 2025 – von Antony P. Mueller
[HIER KLICKEN, um den Beitrag als PODCAST-FOLGE anzuhören.]
Dies ist der dritte Teil der Abhandlung zur Praxeologie, wie sie Ludwig von Mises in seinem Werk „Nationalökonomie“ aus dem Jahr 1940 vorstellte. Den ersten Teil finden Sie HIER, den zweiten Teil HIER.
Für Ludwig von Mises besteht das Wesen der Gesellschaft im menschlichen Zusammenwirken, sie ist „Vereinigung des Handelns“. Dieses Zusammenhandeln von Menschen in einer Gesellschaft ist das Ergebnis bewussten Verhaltens.
Das Handeln, dessen Wirken die Gesellschaft gebildet hat und täglich bildet, ist auf nichts anderes gerichtet als auf Zusammenhandeln und Zusammenwirken mit anderen zur Erreichung bestimmter einzelner Zwecke. (S. 115)
Im Vergleich zur Vereinzelung bringt die Teilnahme in der Gesellschaft dem Einzelnen Vorteile, deren Grundlage die Arbeitsteilung ist. In diesem Sinne besteht Gesellschaft in der Zusammenarbeit einer Vielzahl Einzelner. Der Mensch zieht die Gesellschaft der Vereinzelung vor, weil seine Arbeit durch das Zusammenwirken mit den anderen eine höhere Produktivität mit sich bringt. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, welche Mühsal ein Dasein in der Vereinzelung mit sich brächte oder dass in dieser Form auch nur das Überleben möglich wäre.
Von seiner Geburt an ist der Mensch in die Gesellschaft eingebunden. Menschliches Leben ist immer auch Gesellschaftsleben. Praxeologisch betrachtet ist Gesellschaft aber nicht ein Wesen an sich, das eine eigene Handlungsmacht hätte. Gesellschaft besteht im Handeln Einzelner, sie steht nicht über den Einzelnen, die sie bilden, sondern entsteht durch den Tatbestand, dass die einzelnen Menschen sich zusammenfinden, um ihre jeweils eigenen Ziele besser und leichter erreichen zu können.
Handeln können nur Einzelne. Was als Kollektiv erscheint, besteht aus einzelnen menschlichen Handlungen. Das Kollektiv selbst handelt nicht, es kann gar nicht handeln, denn es ist nichts weiter als eine begriffliche Konstruktion.
Ob der Einzelne der Gesellschaft dienen solle, ist eine ebenso sinnwidrige Frage wie die, ob der Zweck der Gesellschaft im Dienst am Einzelnen bestünde. Nur Handelnde können Zwecke haben. Der Gesellschaft Zwecke und Ziele zuzuschreiben, ist Gesellschaftsmystik und beruht nicht auf rationalem Denken. Die Praxeologie durchschaut den Trug, wenn der Einzelne aufgefordert wird, „der Gesellschaft“ zu dienen, und warnt vor der Gefahr, die von solchem Anthropomorphismus ausgeht.
Wie Andreas Tiedtke in seinem „Kompass zum lebendigen Leben“ (2021) (*) zum Problem des Anthropomorphismus (Vermenschlichung) und der Hypostasierung (die sprachliche oder gedankliche Behandlung eines abstrakten Begriffs, als wäre er ein reales, eigenständiges Wesen) ausführt, bergen Anthropomorphismen und Hypostasierung die Gefahr, einem geistigen Gebilde eine unmittelbare Wirklichkeit und Wirksamkeit zuzuschreiben, die es nicht hat. Dass manche Menschen zum Beispiel vom Staat als einem ‚höheren Wesen‘ denken, ist im Sprachgebrauch so alltäglich geworden, dass man oft vergisst, dass der Staat aus Einzelnen (Individuen) besteht, die unter dem Begriff ‚Staat‘ gemeinsame Handlungspläne verfolgen. Der Staat aber ist kein Wesen aus Fleisch und Blut, sondern eine begriffliche Konstruktion.
Nur weil etwas einen Namen hat, heißt das nicht, dass es in der Realität ein Objekt oder Subjekt gibt, das Träger dieses Namens ist. (Tiedtke, S. 42)
[(*) Mit * gekennzeichnete Links sind Partner-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, unterstützen Sie das Ludwig von Mises Institut Deutschland, das mit einer Provision beteiligt wird. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten.]
Durch Anthropomorphismen und Hypostasierungen werden Gegensätze konstruiert und Konflikte beschworen, die der Wirklichkeit nicht entsprechen. Praxeologisch besteht zwischen Gesellschaft und Individuum eine Harmonie, da sie in der Kooperation auf der Grundlage der Arbeitsteilung besteht. Zu Widersprüchen kommt es, wenn man der Gesellschaft eine eigene Wesenheit zuspricht. Dann wird es so dargestellt, dass der Einzelne im Gegensatz zur Gesellschaft steht, sowohl als Täter wie auch als Opfer.
Indem Universalisten und Kollektivisten die Gesellschaft als ein Gebilde darstellen und so tun, als ob sie unabhängig vom Einzelnen existiere, gelingt es ihnen, einen Widerspruch zwischen den Interessen der Gesellschaft und denen des Einzelnen zu konstruieren. Wird die Gesellschaft als ein Gebilde gedacht, das gesondert vom Einzelnen ein eigenes Leben führt und eigene Zwecke verfolgt, können die Kollektivisten den Anspruch erheben, dass der Einzelne sich der Gesellschaft unterzuordnen und sich zu fügen habe, den Vorrang der Gesellschaft anerkennen müsse und seine eigenen Zwecke hinter der gesellschaftlichen Ordnung zurückstehen müssten.
Die metaphorische Redeweise von einer gesonderten Existenz der Gesellschaft, so als besäße sie ein eigenes Leben, hätte eigene Ziele und könne eigenständig handeln, birgt unermessliche Gefahren. Sollte der Einzelne versuchen, sich dieser eingebildeten ‚Ordnung‘ zu widersetzen, wird er als böse erklärt. Die vom Kollektivismus geforderte Unterwerfung des Einzelnen hat religiöse Dimensionen und uralte Wurzeln.
Der Kollektivismus übernimmt sein Weltbild von uralten Auffassungen, die schon dem Götterglauben der Primitiven vertraut waren und in allen Götterlehren wiederkehren: der Mensch hat einem Gesetz, das von höheren Mächten erlassen wurde, und der Obrigkeit, die diese Mächte zur Vollziehung des Gesetzes eingesetzt haben, zu gehorchen. (Mises, S. 116 f.)
Indem die menschliche Gesellschaft nicht als Menschenwerk gilt, sondern ihr ein übermenschlicher Ursprung zugesprochen wird, wird der Einzelne als ein Rad im Getriebe angesehen, das entsprechend dem konstruierten Wohl der Gesellschaft zu funktionieren hat. Dem Einzelnen wird die Fähigkeit abgesprochen, seine eigenen Interessen zu erkennen und es wird ihm untersagt, seinen eigenen Weg zu gehen. Indem die Kollektivisten die Gesellschaft hypostasieren, wird der Einzelne unmündig erklärt. Er wird zum Untertanen gemacht. Die gesellschaftszerstörende Wirkung der universalistisch-kollektivistischen Gesellschaftsauffassung entsteht zudem daraus, dass die Vorstellungen von der ‚richtigen‘ Gesellschaft nicht einheitlich sind. Es gibt verschiedene Gruppen von Kollektivisten (Linke, Rechte, Sozialisten, Konservative, Globalisten, Nationalisten und dergleichen) und jede verkündet ein anderes Dogma, wobei alle behaupten, jeweils die einzig wahre Lehre zu vertreten. Jedem Zweifel abhold, wollen die fanatisierten Gläubigen jeweils nur ihre eigene Richtung gelten lassen und dieser zum Sieg verhelfen.
Universalismus und Kollektivismus führen unausweichlich zum Kampf, der bis zur Vernichtung oder bis zur Unterwerfung des Gegners fortgesetzt wird. (S. 118)
Demgegenüber ist aus praxeologischer Sicht das Verhältnis des Einzelnen zur Gesellschaft dadurch bestimmt, dass der Mensch vernunftmäßig zu erkennen vermag, wie sehr die Arbeitsteilung ihm Vorteile bringt, die er als Vereinzelter nie erringen könnte. Das gesellschaftliche Werden besteht darin, dass die Verfolgung des Einzelinteresses eines jeden auf ‚natürliche‘ (d.h. zwanglose) Weise zur Gesellschaftsbildung führen. Die Vorteile der Arbeitsteilung kommen den Beteiligten schon gegenwärtig zu. Man braucht sich nicht für zukünftige Generationen aufzuopfern. Dass der Einzelne das Gesellschaftsleben vorzieht, kommt durch das Kalkül zustande, dass die Vorteile überwiegen und die Opfer, die auch damit verbunden sind, akzeptabel erscheinen. In diesem Sinne ist das Werden der Gesellschaft ein Produkt der menschlichen Vernunft.
[(*) Mit * gekennzeichnete Links sind Partner-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, unterstützen Sie das Ludwig von Mises Institut Deutschland, das mit einer Provision beteiligt wird. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten.]
Ludwig von Mises widerspricht der anarchistischen Auffassung, dass eine staatsfreie Gesellschaft möglich sei. Nach ihm ist die Einsichtsfähigkeit, die temporäre Vorteilsnahme durch Mord und Betrug und andere antigesellschaftliche Handlungen unterbleiben ließe, nicht vollständig vorhanden. Nicht alle Menschen besitzen die Einsichtsfähigkeit oder die Kraft, freiwillig stets sozial zu handeln. So lange, wie nicht alle Menschen über diese Vernunfteinsicht verfügten, sei ein gesellschaftlicher Zwangsapparat nötig.
Gesellschaftliches Zusammenleben und Zusammenwirken von Menschen ist daher nur im staatlichen Verbande denkbar, d.h. nur in einem Verbande, der über einen Zwangsapparat zur Unterdrückung gesellschaftsstörenden Handelns von Einzelnen oder von Gruppen verfügt. (S. 120)
Diese Überlegungen führen Ludwig von Mises zur Rolle der Demokratie. Die Regierungsgewalt soll in Übereinstimmung mit der öffentlichen Meinung ausgeübt werden und freie Wahlen sind dazu das Instrument, um Bürgerkrieg zu vermeiden. Im Sinne des Liberalismus soll der Staat so eingerichtet sein, dass die Übereinstimmung zwischen dem Willen der Regierenden und dem der Regierten auf friedlichem Wege erzielt wird. (S. 121)
Es ist jedoch falsch, die kollektivistisch-universalistische Auffassung als ‚Sozialprinzip‘ zu fassen und es der vermeintlich individualistischen Auffassung als ‚Individualprinzip‘ entgegenzusetzen. Aus praxeologischer Sicht gibt es keinen Gegensatz zwischen Individuum und Gesellschaft. Ein vermeintlicher Widerspruch entsteht erst dadurch, indem fälschlicherweise im Wege der Hypostasierung die Gesellschaft gedanklich als eine eigene Wesenheit konstruiert wird, die eigene Zwecke verfolgt.
Wenn man das Sein eines Wesens, das schon ex definitionem höher, vollkommener und edler als die Einzelnen erscheint und demgegenüber die Einzelnen ein minderes oder gar nur ein schattenhaftes Dasein führen, einmal angenommen hat, dann kann man den weiteren Schlussfolgerungen des Kollektivismus nicht mehr ausweichen. Dann haben die Zwecke des höheren Seins, der Gesellschaft, Vorrang vor denen des niedrigeren Seins, des Einzelnen, dann ist der Einzelne nur ein Seiender vermöge des Seins der Ganzheit, dann ist die Gesellschaft alles, der Einzelne nichts, dann ist jedes Mittel gut, um den aus Tollheit sich auflehnenden Einzelnen in die Schranken zu weisen. (S. 122)
Die kollektivistischen Auffassungen verkennen, dass der wesentliche Aspekt der Gesellschaft die Arbeitsteilung ist. Die Gesellschaft entsteht aus dem Willen der Menschen zur freiwilligen Zusammenarbeit, die jedem Einzelnen viel mehr Vorteile bringt, als sie an Opfern fordert. Arbeitsteilung und Arbeitsvereinigung sind ergiebiger als das Sonderhandeln als Einzelner. Diese Sachlage ergibt sich erstens aus der Ungleichheit der einzelnen Menschen, zweitens aus der ungleichen Verteilung der natürlichen Produktionsbedingungen auf der Erde und drittens daraus, dass es Arbeiten gibt, die die Kraft der Einzelnen übersteigen und nur durch Zusammenfassung der Kräfte mehrerer geleistet werden können. (S. 125)
Aus Sicht der praxeologischen Erkenntnisse weist die gegenwärtige Politik schwere Mängel auf. Anstatt darauf ausgerichtet zu sein, die Arbeitsteilung durch möglichst geringe Transaktionskosten zu fördern, belasten Steuern und Regulierungen die wirtschaftliche Zusammenarbeit der Einzelnen. Das kollektivistische Denken dominiert die Politik. Statt einer repräsentativen Demokratie herrscht der Parteienstaat. Man spricht von der ‚Staatsraison‘ und von ‚unserer Demokratie‘, ohne überhaupt zu merken, dass man damit in die Falle des Anthropomorphismus fällt und mit der Hypostasierung von Staat und Gesellschaft nicht zur Befriedung beiträgt, sondern Konflikte schürt.
Der Ursprung der Gesellschaft aus der Arbeitsteilung kennzeichnet ihr eigentliches Wesen als freiwillige Kooperation. Arbeitsteilig verrichtete Produktion bringt höhere Erträge als sie ein allein arbeitender Einzelner erbringen könnte. Weder ein ‚Gesellschaftstrieb‘ noch ein ‚Gesellschaftsvertrag‘ sind dazu nötig, dass sich die Menschen zusammenfinden, um gemeinsam zu arbeiten. Es ist die praktische Einsicht in die höhere Ergiebigkeit der Arbeitsteilung. Die Kraft, die gesellschaftliche Bindung entstehen lässt und sie fortschreitend verdichtet, ist menschliches Handeln. Gesellschaft entspringt der Einsicht in die höhere Ergiebigkeit des Zusammenhandelns und Zusammenwirkens durch Arbeitsteilung, womit auch das eigentliche Wesen des Gesellschaftlichen bestimmt ist.
Praxeologie ist nicht ‚gesellschaftsfeindlich‘ – im Gegenteil. Aus Sicht der Praxeologie sind Individuum und Gesellschaft keine Gegensätze, sondern stehen in einer fruchtbaren Wechselbeziehung, wobei der entscheidende Gesichtspunkt darin besteht, dass – im Unterschied zum Einzelnen – der Gesellschaft keine eigene Wesenheit zugesprochen werden kann. ‚Gesellschaft‘ ist ein begriffliches Konstrukt. Sie handelt nicht, sie besitzt keinen Willen und sie verfügt auch über keine eigene Macht. Inhaltlich geht es beim Gesellschaftlichen um Kooperation zwischen den einzelnen Menschen. Der Mensch lebt in der Gesellschaft, weil ihm die Arbeitsteilung Nutzenvorteile verschafft, die weit über ein Leben in der Vereinzelung hinausgehen.
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Instituts Deutschland wieder.
Ebenfalls zur „Nationalökonomie“ von Antony P. Mueller kürzlich erschienen: „Was ist Praxeologie?“, und „Grundkategorien der Praxeologie“.
Antony Peter Mueller ist promovierter und habilitierter Wirtschaftswissenschaftler der Universität Erlangen-Nürnberg, wo er von 1994 bis 1998 das Institut für Staats- und Versicherungswissenschaft in Erlangen leitete. Antony Mueller war Fulbright Scholar und Associate Professor in den USA und kam im Rahmen des DAAD-Austauschprogramms als Gastprofessor nach Brasilien.
Bis 2023 war Dr. Mueller Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Makroökonomie und Internationale Wirtschaftsbeziehungen, an der brasilianischen Bundesuniversität UFS. Nach seiner Pensionierung ist Dr. Mueller weiterhin als Dozent an der Mises Academy in São Paulo tätig und als Mitarbeiter beim globalen Netzwerk der Misesinstitute aktiv. Darüber hinaus ist er wissenschaftlicher Beirat der Partei „Die Libertären“.
In deutscher Sprache erschien 2024 sein Buch „Antipolitik“ (*), 2023 erschien „Technokratischer Totalitarismus. Anmerkungen zur Herrschaft der Feinde von Freiheit und Wohlstand“(*). 2021 veröffentlichte Antony P. Mueller das Buch „Kapitalismus, Sozialismus und Anarchie. Chancen einer Gesellschaftsordnung jenseits von Staat und Politik“(*). 2018 erschien sein Buch „Kapitalismus ohne Wenn und Aber. Wohlstand für alle durch radikale Marktwirtschaft“(*).
[(*) Mit * gekennzeichnete Links sind Partner-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, unterstützen Sie das Ludwig von Mises Institut Deutschland, das mit einer Provision beteiligt wird. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten.]
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Das Ludwig von Mises Institut Deutschland e.V. setzt sich seit Jahren für die Verbreitung der Lehre der Österreichischen Schule der Nationalökonomie ein. Freiheit gibt es nicht geschenkt, sie muss stets neu errungen und erhalten werden. Bitte unterstützen Sie daher das Ludwig von Mises Institut Deutschland mit einer Spende, damit wir uns weiterhin für unser aller Freiheit einsetzen können!
Spendenkonto:
Ludwig von Mises Institut Deutschland e. V.
IBAN: DE68 7003 0400 0000 1061 78
BIC: MEFIDEMM
Merck Finck A Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch
Verwendungszweck: Spende
Titel-Foto: Adobe Stock – bearbeitet