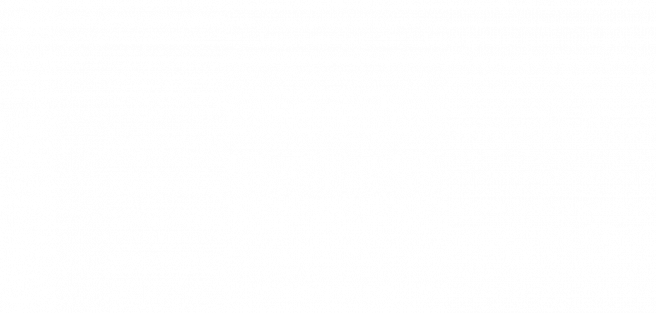Der „China-Crash“: Wie das Scheingeldsystem das Reich der Mitte zu Fall bringt
7.8.2015 – von Olivier Kessler.
Um bis zu 50 Prozent sind die Aktienmärkte in China seit Anfang Juni gefallen. Die Regierung intervenierte massiv, um den Kursverfall aufzuhalten. Dies tat sie mit den gleichen keynesianistischen Rezepten, die jeweils auch im Westen kurzfristige Besserung versprechen, längerfristig allerdings noch heftigere Erschütterungen zur Folge haben: Öffnung der Geldschleusen einerseits, sowie das Heruntermanipulieren der Zinsen andererseits. Damit wollen die Zentralbanken jeweils die Kreditvergabe der Geschäftsbanken ankurbeln. Kredite fließen primär in die Vermögensmärkte – also in Immobilien und Aktienmärkte – und vermögen dadurch diese Preise zu stützen oder sie sogar in die Höhe zu katapultieren – so wie das vor der amerikanischen Subprime-Krise 2007 beim Immobilienmarkt der Fall gewesen war.
Der Autor dieser Zeilen konnte schon vor zwei Jahren auf einer China-Reise ganze aus dem Boden gestampfte Geisterstädte begutachten, in welchen keine Menschenseele lebte. Auch sie waren Folge der angeheizten Kreditexpansion, welche ihren Ausdruck in unbewohnten Betonwüsten wiederfand – planwirtschaftliche Kapital- und Ressourcenverschwendung im großen Stil, die schon damals nichts Gutes erahnen ließen.
In China kam es zudem in Mode, mit geliehenem Geld Hebelprodukte zu kaufen. Mit sogenannten «Margin Lendings» wurde Kleinanlegern ein hoch spekulativer Handel ermöglicht. Die Folge dieser risikobehafteten Investitionen auf Pump: in die Höhe schnellende Aktienkurse. Im Zeitraum von November bis Mitte Juni wurde ein Kursplus von rund 150 Prozent erzielt – angeheizt durch die von Zentralplanern festgelegte expansive Geldpolitik.
Staatlich orchestrierte Aktienmarkt-Aufblähung
Hintergrund des Zentralbank-Aktivismus war die schwächelnde chinesische Wirtschaft, die so langsam wächst wie seit 25 Jahren nicht mehr. Offiziell wird das Wachstum zwar noch mit 7 Prozent ausgewiesen. Die Zahl gilt allerdings unter Experten als beschönigt. Die staatlich orchestrierte Aktienmarkt-Aufblähung wurde als Heilmittel gegen die abkühlende Wirtschaft gesehen. Dank den hohen Börsenkursen konnten Staatsunternehmen einfacher Kapitalerhöhungen durchführen und dadurch an neue Mittel gelangen. Zuletzt lockte die chinesische Regierung auch noch unerfahrene Kleinanleger an die Börse, um den Aktienboom weiter anzuheizen.
Ob das ein kluger Schachzug der kommunistischen Partei Chinas war, lässt sich zurecht bezweifeln. Eigentlich hätte man doch aus den Fehlern des Westens während der Finanzkrise 2007 lernen müssen. Am Himmel im Reich der Mitte ziehen düstere Wolken auf. Das gedämpfte Wirtschaftswachstum macht vielen Chinesen, die sich ihren Anteil am steigenden Wohlstand sichern wollten, einen Strich durch die Rechnung. Die Verluste der Kleinanleger und die damit verbundene Frustration könnten zu einer explosiven Stimmung und zu sozialen Unruhen im Land führen. Selbst die versiertesten Planwirtschaftler werden einen künstlich erzeugten Boom nicht für immer aufrechterhalten können.
Staatskapitalismus ist zum Scheitern verurteilt
Der chinesische Staatskapitalismus, der von westlichen Führern auch schon als Zukunftsmodell gepriesen wurde, war und ist ohnehin zum Scheitern verurteilt. Staatskapitalismus hat in Wahrheit nämlich wenig mit echtem Kapitalismus zu tun, in welchem die Märkte frei sind und die Entscheidungen über wesentliche Lebensbereiche bei den Bürgern liegen. Vielmehr ist Staatskapitalismus gleichzusetzen mit planwirtschaftlicher Lenkung – gespickt mit einigen kontrolliert eingeführten marktwirtschaftlichen Elementen. Diese neu zugelassenen marktwirtschaftlichen Einflüsse waren es denn auch, die Chinas Wohlstand innert kürzester Zeit in die Höhe katapultiert haben.
Aber solange wesentliche Bereiche zentralistisch durch die politische Klasse gesteuert werden und die Entscheidungsgewalt bei einigen wenigen, zwar gut ausgebildeten aber nicht allwissenden Bürokraten liegt, werden auch in staatskapitalistischen Systemen immer wieder Zerrüttungen auftreten, wie dies in allen sozialistischen Systemen ausnahmslos der Fall ist. Der Grund ist, dass ein oder mehrere Zentralplaner niemals die Bedürfnisse und Ziele aller ihrer Unterworfenen kennen, geschweige denn in ihren Plänen berücksichtigen können.
Nobelpreisträger Friedrich August von Hayek vertrat in seinem Bestseller «Der Weg zur Knechtschaft» die These, dass es keinen Mittelweg zwischen Wettbewerb und Planwirtschaft geben kann. Wenn der Staat nämlich einmal damit beginne, in die freie Marktwirtschaft einzugreifen, verursache er damit ungewollt mit jeder Intervention wieder neue Probleme, die er wiederum mit neuen Interventionen zu bekämpfen trachtet. Die Interventionsspirale beginnt zu drehen und erstickt nach und nach die Freiheit der Bürger und ersetzt diese durch Planwirtschaft und Regulierung – einen Zustand, den Hayek als «Knechtschaft» bezeichnete.
Geldsozialismus verursacht wiederkehrende Wirtschaftskrisen
Wie richtig Hayek mit seiner Einschätzung lag, können wir immer wieder anhand der wiederkehrenden Finanz- und Wirtschaftskrisen beobachten. Der Vorgang ist immer in etwa der gleiche:
In einem ersten Schritt kritisieren Politiker und Zentralbanker die in ihren Augen zu geringe Konsumneigung der Menschen. In anderen Worten: Dass die Menschen sich entschieden haben, heute mehr zu sparen, damit sie morgen mehr konsumieren können, passt der Classe politique nicht in den Kram. Gemäß Art. 5 des Bundesgesetzes über die Schweizerische Nationalbank muss die SNB der Konjunkturentwicklung Rechnung tragen. Sprich: Sie soll die Konjunktur «ankurbeln», indem sie die Zinsen auf ein tieferes Niveau heruntermanipuliert, als sich im freien Markt einstellen würde. Wenn die Zinsen sinken, steigt die Bereitschaft der Menschen, sich zu verschulden und zu konsumieren, während gleichzeitig der Anreiz zum Sparen sinkt. Konsumkredite werden günstiger. Für seine Ersparnisse kriegt man weniger Zinsen.
Zweitens: Sinkende Zinsen signalisieren den Unternehmern, dass nun mehr Ersparnisse vorhanden sind, d.h. dass heute weniger und dafür morgen mehr konsumiert wird. Unternehmen beginnen deshalb heute zu investieren, um Produkte und Dienstleistungen zu schaffen, die morgen verkauft werden sollen. Sind die Zinsen allerdings heruntermanipuliert worden, handelt es sich um eine kollektive Täuschung – verursacht durch den Zentralplaner. Es werden Güter für morgen geschaffen, die gar nie verkauft werden können, da nämlich weniger Ersparnisse vorhanden sind, als das tiefe Zinsniveau fälschlicherweise anzeigt. Würde die Zinsbildung dem freien Markt überlassen, wäre eine solche kollektive Täuschung nicht möglich.
Drittens: Zu einem späteren Zeitpunkt wird die gesamtwirtschaftliche Irreführung offensichtlich. Produkte bleiben in den Regalen liegen, Unternehmen fehlen benötigte Einnahmen. Sie taumeln dem Konkurs entgegen und die Wirtschaft gerät in eine Abwärtsspirale. Die Aktienkurse fallen. Das wäre der Zeitpunkt, an welchem die Fehlentwicklung – die Produktion vorbei an den Bedürfnissen der Bürger – korrigiert werden und die Wirtschaft gesunden könnte. Dies wäre zwar schmerzhaft, hat aber den Vorteil, dass sich die Produktion danach endlich wieder an den Bedürfnissen der Menschen orientieren könnte, würden wieder freie Marktzinsen zugelassen. Dann richtet sich das Angebot wieder an der echten Nachfrage aus.
Kommunistisches Manifest
Anstatt die Wirtschaft gesunden zu lassen und die Luft aus der Blase zu lassen, entschieden sich die westlichen und aktuell auch die chinesische Zentralbank dafür, wieder zurück zu Schritt eins zu gehen und die Blase weiter aufzublasen. Mit dem falschen, keynesianistisch geprägten Hinweis, dass die Wirtschaftskrise auf die zu geringe Nachfrage zurückzuführen sei, rechtfertigt man weitere Zinssenkungen und überschwemmt die Wirtschaft mit noch mehr billigem Geld. Zu allem Übel versucht man die Krise dann auch noch dem nicht existierenden Kapitalismus in die Schuhe zu schieben. Angesichts planwirtschaftlich geregelter Geldmenge und zentralistisch gesteuerter Zinsen von freier Marktwirtschaft zu reden, zeugt nicht nur von ökonomischem Dilettantismus, sondern auch von absolutem Realitätsverlust.
Jeder, der schon einmal das kommunistische Manifest gelesen hat, weiß, dass dort ausdrücklich die «Zentralisation des Kredits in den Händen des Staats durch eine Nationalbank mit Staatskapital und ausschließlichem Monopol» gefordert wird. Also ziemlich genau das, was heute in allen vermeintlich «freien Marktwirtschaften» des Westens praktiziert wird. Auch in der Schweiz. In Art. 99 der Bundesverfassung heißt es: «Das Geld- und Währungswesen ist Sache des Bundes; diesem allein steht die Ausgabe von Münzen und Banknoten zu.»
Geldmonopol des Staates als Krisenursache
Das Geldmonopol bei einer staatlichen Zentralbank hat nicht nur den Nachteil, dass sie wiederkehrende Wirtschaftskrisen produziert. Dank ihrer Möglichkeit, grenzenlos Papiergeld zu drucken und damit die Funktion des «Lender of last resort» wahrzunehmen, schafft sie auch Anreize, die jeder marktwirtschaftlichen Logik widersprechen und die den Großbanken massiv viel mehr Macht verleihen, als diese auf einem freien Markt hätten.
Dank der Zentralbank können Geschäftsbanken Gewinne privatisieren und Verluste sozialisieren. Die marktwirtschaftlichen Prinzipien von Gewinn und Verlust sowie der Eigenverantwortung werden ausgehöhlt, indem Zentralbanken den Großbanken zu verstehen geben, dass diese «too big to fail» seien und sie im Notfall gerettet würden. Eine solche Gewissheit lädt Großbanken natürlich zu risikobehafteterem Handeln ein – in der Fachsprache spricht man von «moral hazard». Dies macht Rettungsaktionen in immer größerem Ausmaß «nötig». Im selben Atemzug lässt man kleinere Banken in den Konkurs gehen. Die Bankenwelt konsolidiert sich zunehmend, was den Wettbewerb auf dem Finanzplatz in Kombination mit strikter Marktzugangsbeschränkung und Kaputtregulierung nach und nach einschränkt – zum Nachteil der Kunden.
Währungswettbewerb als Alternative
Diese Entwicklungen sind keine dem Kapitalismus inhärenten Tendenzen. Im Gegenteil. Sie sind allesamt Folgen einer sozialistischen Geldplanwirtschaft. Selbst die meisten sog. Liberalen verkennen heute diese Realitäten und erkennen nicht, dass der freie Wettbewerb beim Geld, dem Blut unserer Wirtschaft, längst ausgeschaltet oder zumindest arg eingeschränkt ist.
Es gibt allerdings eine Alternative zum heutigen staatlich erzwungenen Papiergeldsystem, zur Enteignung der Bürger durch Geldvermehrung: Wir schaffen das Währungsmonopol des Staates ab und lassen konkurrierende Währungen zu, damit die Menschen wieder eine echte Wahl haben. So würde sich voraussichtlich jenes Geld durchsetzen, dass am wertstabilsten ist und nicht kontinuierlich zwangsinflationiert wird. Wer hält sein Vermögen schon in einer Währung, die dauernd an Wert verliert?
Die Zinsmanipulation durch die Zentralbank könnte dadurch ebenfalls gestoppt werden und der marktwirtschaftliche Zins, der gesamtwirtschaftliche Ersparnisse und Investitionen miteinander in Einklang bringt, könnte sich wieder durchsetzen. Die vom sozialistischen Geldsystem verursachten Konjunkturschwankungen mitsamt künstlichen Booms und nachfolgenden Krisen könnten eingedämmt und damit menschliches Leid verhindert werden.
Wie viele Anschauungsbeispiele von gescheiterten sozialistischen Systemen brauchen wir noch, bis wir endlich etwas dagegen unternehmen? Wir brauchen ein Geldsystem für die Bürger, nicht für die Classe politique!
*****
Dieser Beitrag ist zuerst auf der Internetseite der Schweizerzeit erschienen.
Foto-Startseite: © klublu – Fotolia.com
————————————————————————————————————————————————————————
Der Autor ist stv. Chefredaktor der «Schweizerzeit» Zeitung (www.schweizerzeit.ch).