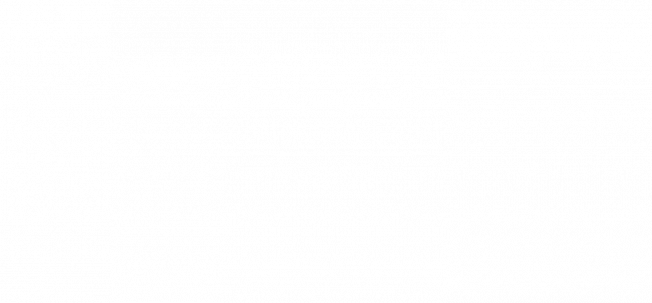Warum es dem Staat noch nicht gelungen ist, die Wirtschaft an die Wand zu fahren
20.2.2015 – von John P. Cochran.
Pierre Lemieux hat ein Buch geschrieben (Somebody in Charge: A Solution to Recession), das für jeden unverzichtbar ist, der Vorgeschichte, Ablauf und unmittelbare Nachwirkung der „Großen Rezession“ verstehen will.
Die Bedeutung des Buches geht über die unmittelbare Krisenanalyse hinaus. Lemieux legt die zugrundeliegenden Schwächen und Fehlschlüsse der gesamten keynesianischen, aktionistischen Agenda bloß, die von niederen Trieben („animal spirits“) befeuert wird, wie dem unwiderstehlichen Tatendrang derjenigen, die sich selbst einbilden, zuständig zu sein.
Er folgert, dass „die Ursachen und Nachwehen der Wirtschaftskrise von 2007-2009 auf eine tiefere zugrundeliegende Krise verweisen, bei der es sich um eine Krise der Machtbefugnis handelt.“ (p. 162). In meiner ausführlichen Besprechung seines Buches schließe ich: „Fände dieses Buch eine große Leserschaft innerhalb und außerhalb der Klassenzimmer, könnte es viel Nutzen stiften, indem es größere Teile der Öffentlichkeit auf die Tatsache stößt, dass es keiner regelnden Hand bedarf.“ Eine freie Marktwirtschaft kommt ganz gut klar, wenn man sie sich selbst überlässt, und wenn die Marktteilnehmer vergleichsweise wenig durch Staatseingriffe behindert werden. Solche wirtschaftshemmenden Eingriffe stellen u. a. die Zentralbank und die geldpolitische Fehlleitung der Produktion, bürokratische Auflagen und fehlgeleitete Regelungen dar, welche Anreize verzerren.
In der Winterausgabe 2014/15 von Regulation kommt Professor Lemieux auf dasselbe Thema zurück, wenn auch in etwas anderer Form, indem er fragt (und die Antwort liefert): „Warum wird die amerikanische Wirtschaft nicht von den Vorschriften erdrückt?“ Seine Antwort lautet: Märkte sind zäh. Vorschriften sind für Unternehmer so wie Stacheldraht, den man an einem Treppengeländer anbringt, um die Großmutter davon abzuhalten, darauf herunterzurutschen; er behindert sie, ohne ihr den Weg zu versperren. Im Zuge der Beantwortung seiner Frage liefert Lemieux auch eine Erklärung dafür, warum die Nachwehen der Krise von 2007-2009 oft als Große Stagnation bezeichnet werden. Ihm zufolge ist „Regulierung das heimliche Schwergewicht im toten Winkel“. Ich würde dies in den größeren Rahmen von Higgs Regimeunsicherheit stellen – dies nur als Spitzfindigkeit am Rande.
David Henderson und Peter Boettke liefern sowohl ein Verständnis dafür, warum Märkte zäh sind, als auch dafür, unter welchen Umständen Märkte den Wohlstand am besten mehren. Hendersons Beitrag stammt aus seinem Werk Ten Pillars of Economic Wisdom (Die Zehn Säulen wirtschaftlicher Weisheit). Die relevanteste Säule in unserem Zusammenhang, welche eingehender verstanden werden sollte, ist „Säule Nr. 10: ‚Wettbewerb ist zähes Unkraut und kein zartes Blümchen.‘“ Boettke kommt zu einem ähnlichen Standpunkt mit zwei Ergänzungen. Erstens bieten selbst kleinste wirtschaftliche Freiräume den Menschen Gelegenheit, ihr Los zu verbessern, auch unter den widrigsten Umständen. Und zweitens führen Märkte in einem geeigneten institutionellen Rahmen zu Wohlstand. Seine Zusammenfassung lautet:
Märkte sind wie Unkraut. Sie lassen sich nicht ausrotten. Märkte entstehen wo immer und wann immer Menschen Gelegenheit haben, von Tausch zu profitieren. Doch nicht alle Märkte sind gleich. Tausch auf Märkten findet zwar auch ohne Eigentumsregeln statt, doch er besitzt dann Eigenheiten, die für langfristiges wirtschaftliches Wachstum unerwünscht sind.
Märkte brauchen keine gesetzlichen Sanktionen, um zu existieren. Doch damit das Marktgeschehen als Grundlage allgemeinen wirtschaftlichen Wohlstands dienen kann, braucht es einen gesetzlichen Rahmen. Die Spielregeln sind wahrscheinlich die entscheidenste Bestimmungsgröße für Wirtschaftskraft. (S. 198)
Wenn Regulierung die Wirtschaft hemmt, aber nicht zusammenbrechen lässt, wieviel Schaden mag Regulierung dann auf lange Sicht angerichtet haben?
Gestützt auf eine Studie von John W. Dawson und John J. Seater („Federal Regulation and Aggregate Economic Growth“) antwortet Lemieux, dass in diesem Gedankenspiel die Auswirkungen gravierender wären, als man vielleicht denkt:
Dawson und Seater behaupten daher, dass das Bruttosozialprodukt der USA 2011 statt 15 Billionen Dollar 54 Billionen betragen hätte, wäre die Regulierung auf Bundesebene beim Stand des Jahres 1949 eingefroren geblieben. Anders gesagt: Der Durchschnittsamerikaner (aus Männern, Frauen und Kindern) könnte jetzt im Jahr etwa 125.000 $ mehr ausgeben, was einer guten Verdreifachung des Bruttosozialprodukts pro Kopf entspricht. Wenn das keine wirtschaftliche Pleite ist, was dann? Dawson und Seaters Schätzungen legen nahe, dass die Totale Faktorproduktivität über den gesamten Zeitraum von 57 Jahren in Mitleidenschaft gezogen wurde, wobei jedoch die nachteilige Wirkung von Mitte der 1960er bis etwa 1980 hoch war, anschließend etwas weniger nachteilig war bis Ende der 1990er und ab Anfang der 2000er wiederum sehr stark nachteilig war. (S. 15)
Insgesamt handelt es sich um einen langsamen kontinuierlichen Abstieg gegenüber dem Potential, welcher 2.000 $ pro Jahr und Kopf ausmacht.
Weitere Belege liefern Studien, die nicht nur die Wirkung von Regulierung auf das Wachstum untersuchen, sondern jene von der Staatsquote auf das Wirtschaftswachstum. Die Ergebnisse von Gwartney, Holcombe und Lawson („The Scope of Government and the Wealth of Nations“) sowie Vedder und Gallaway („Government Size and Economic Growth“) lassen darauf schließen, dass die Verluste selbst einer geringfügigen Erhöhung der Regierungsausgaben groß sind. Im Jahre 2009 schätzte ich, dass eine Erhöhung der Ausgaben von 20 % auf 22 % des Bruttosozialprodukts über eine Dekade das reale Bruttosozialprodukt pro Kopf um 4.400 $ verringern könnte, allein schon über diesen Zeitraum.
Lemieux zieht den Schluß:
Die Grenzkosten neuer Vorschriften muss mit der Regulierungsdichte zunehmen. Hinzu kommt, dass die Zementierung der Märkte, welche Regulierung hervorruft, die Anpassungskosten erhöht, welche der technische Fortschritt mit sich bringt. Der größere Raum, den die Arbeitsmarktregulierung in Europa einnimmt, könnte erklären, warum die Stagnation dort schlimmer ist als in Amerika.
Die Zähigkeit von Märkten hat die Wirkung von Regulierung gedämpft vor allem in einer reichen und teilweise immer noch flexiblen Wirtschaft, wie sie die Vereinigten Staaten haben. Dennoch ist die Annahme vernünftig, dass über die sechs Jahrzehnte seit dem Zweiten Weltkrieg Regulierung einen großen Brocken des möglichen Wohlstands verschlungen hat. Sie hat den durchschnittlichen Lebensstandard zwar nicht zurückgeworfen, doch dabei handelt es sich nur um einen Trostpreis, denn es kann schlimmer kommen, wenn der Regulierungswalze nicht zurückgeschoben wird.
Solange wir nicht die „Krise der Machtbefugnis“ lösen, setzt sich die derzeitige Stagnation wahrscheinlich auf absehbare Zukunft fort. Wie ich 2009 bereits schloß: Die Wirkung auf Wohlstand und Innovation ist bedeutend, doch „die Kosten in Form von Freiheitsverlust sind unermesslich.“
*****
Aus dem Englischen übersetzt von Thomas Leske. Der Originalbeitrag mit dem Titel Why the Government Hasn’t Yet Managed to Destroy the Economy ist am 2.2.2015 auf der website des Mises-Institute, Auburn, US Alabama erschienen
—————————————————————————————————————————————————————————–
John P. Cochran ist emeritierter Dekan der Business School und emeritierter Professor für Volkswirtschaftslehre der Metropolitan State University of Denver. Gemeinsam mit Fred R. Glahe ist er Autor von »The Hayek-Keynes Debate: Lessons for Current Business Cycle Research«, sowie Senior Fellow des Mises Institute und Mitglied des Editorial Board des »Quarterly Journal of Austrian Economics«.