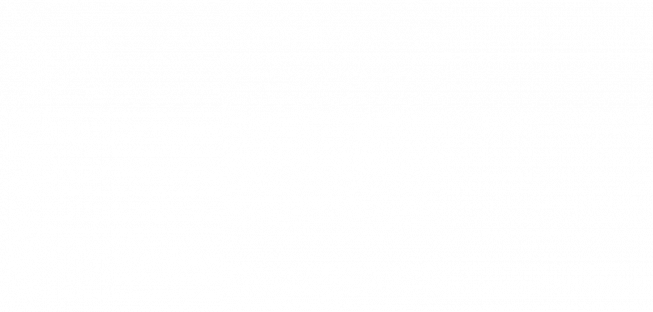„Der Staat soll nicht nur einer privilegierten Schicht dienen, sondern allen Menschen“
15.1.2018 – Interview mit S.D. Fürst Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein. Das Interview wurde am Rande der Konferenz des Ludwig von Mises Institut Deutschland am 21. Oktober 2017 in München geführt und im November zuerst auf der Internetseite des Austrian Institute of Economics and Social Philosophy veröffentlicht. Die Fragen stellte Stefan Beig.
*****
Durchlaucht, ist für Kleinstaaten wie Liechtenstein der Anreiz zur Förderung von Freihandel und freiem Unternehmertum größer?
Ja. Ein Kleinstaat ist sehr viel abhängiger von Importen als ein großer Staat, und um diese Importe bezahlen zu können, muss er exportieren können.
Ist es also prinzipiell vorteilhaft, ein kleiner Staat wie Liechtenstein zu sein?
In einer friedlichen Welt sind kleine Staaten wie Liechtenstein oder dezentrale Staaten wie die Schweiz mit direkter Demokratie in der Regel wirtschaftlich erfolgreicher. In einer nicht friedlichen Welt, in der große Staaten versuchen, kleine Staaten zu erobern, sind so kleine Staaten wie Liechtenstein sicher im Nachteil. Das gilt aber auch im Bereich der Wirtschaft. In einer friedlichen Welt mit Freihandel sind kleine Staaten oder dezentrale, große Staaten in der Regel wirtschaftlich erfolgreicher.
Die Verfassung in Liechtenstein sieht seit 1921 direktdemokratische Verfahren vor, so wie in der Schweiz. Sie sind ein deklarierter Befürworter der direkten Demokratie.
Ja. Dadurch wird die Verbindung zwischen Regierten und Regierenden enger. Die Gefahr, dass es zu einer Entfremdung oder gar zu einer Revolution kommt, wird reduziert.
Sie kritisieren in Ihrem Buch die traditionellen repräsentativen Demokratien. Warum?
Es besteht die Gefahr, dass sich der Staat nicht zu einer echten Demokratie entwickelt, sondern zu einem oligarchischen System mit demokratischer Legitimation. Dieses System besteht dann aus einer Führungsschicht von Politikern, Beamten und manchmal auch Geldgebern, die gemeinsame Interessen in wechselnden Koalitionen vertreten. So verknöchert der Staat. Die führenden Schichten haben in der indirekten Demokratie viele Einflussmöglichkeiten. Darin sehe ich eine Schwäche der traditionellen Demokratie. Das hat dazu geführt, dass indirekte Demokratien immer wieder zusammengebrochen sind und durch Diktaturen ersetzt wurden.
Sie bezweifeln, dass der heutige Staat in der Lage ist, sich zu reformieren, ohne direkte Demokratie.
Es ist schwieriger. Die führende Schicht vertritt manchmal eine andere Meinung als die Mehrheit der Stimmberechtigten. Das war auch in Liechtenstein dann und wann der Fall. Da gab es einstimmige Beschlüsse des Parlaments für ein neues Gesetz, das dann in einer Volksabstimmung abgelehnt wurde. Dasselbe kann in der Schweiz mit der direkten Demokratie ebenfalls vorkommen.
Sollen sich auch Monarchien in ihrem Bestand der Mehrheitsentscheidung unterwerfen?
In der alten Verfassung Liechtensteins gab es ein absolutes Vetorecht des Fürsten. Bei der Verfassungsreform von 2003, die ich vorgeschlagen habe und die in einer Volksabstimmung angenommen wurde, hat der Fürst kein Vetorecht für den Fall, dass die Wahlberechtigten im Fürstentum mehrheitlich beschließen, die Monarchie abzuschaffen.
„Die direkte Demokratie zuerst auf lokaler Ebene einführen“
Der Fürst kann der direkten Demokratie aber immer noch Grenzen setzen.
Es ist in jedem Fall gut, wenn man dem gewählten oder nicht gewählten Staatsoberhaupt ein Vetorecht einräumt. So schützt man die Rechte von Minderheiten. Ein Präsident oder Monarch sollte das Rückgrat haben zu sagen: Das unterschreibe ich nicht – und das dann auch zu begründen.
Sie fordern die Einführung der direkten Demokratie sowohl auf Gemeindeebene, als auch auf Bundesebene.
In meinem Buch „Der Staat im dritten Jahrtausend“ habe ich vorgeschlagen, dass man die direkte Demokratie zuerst auf der lokalen Ebene einführen soll, d.h. in Dörfern und Städten, und erst wenn die Bevölkerung damit Erfahrung gesammelt hat, auf Staatsebene. Bekanntlich kann man aus Fehlern lernen, diese sind aber auf lokaler Ebene weniger problematisch als auf Staatsebene.
Die Einführung der direkten Demokratie setzt also einen Lernprozess voraus?
Ja. Das ist sicher der vorsichtigere Weg. Auf Staatsebene sollte man meiner Meinung nach dem Staatsoberhaupt ein Vetorecht einräumen, wobei die liechtensteinische Erfahrung zeigt, dass eine Volksinitiative abgelehnt wird, wenn der Fürst vor der Abstimmung sagt, dass es seiner Meinung nach kein sehr glücklicher Vorschlag ist. Soweit ich mich erinnern kann, hat nur mein Vater einmal von seinem Vetorecht Gebrauch gemacht, und danach hat man ihn gebeten, seine Meinung zu dem Vorschlag vor der Abstimmung kundzutun.
Anreize gegen zu viel Zentralismus
Ihre Vorschläge sind weitreichend: Der Staat soll sogar das Monopol auf sein Territorium aufgeben. Das bedeutet: Selbst Gemeinden können sich durch Mehrheitsentscheidungen vom Staat lösen. Ist das durchführbar? Sollen mitten im Zentrum eines existierenden Staates gelegene Bundesländer zu neuen Staaten werden können?
Mir geht es darum, die Dezentralisierung zu fördern und nicht das Auseinanderbrechen der Staaten. In der Vergangenheit sind Staaten immer wieder auseinandergebrochen, und das war selten ein friedlicher Prozess. Das Fürstentum Liechtenstein ist einer der ältesten, wenn nicht der älteste Staat, der innerhalb seiner heutigen Grenzen überlebt hat. Es gibt ältere Staaten, aber deren Grenzen haben sich immer wieder verändert, und das waren selten friedliche Prozesse. Dezentralisierte, demokratische Rechtsstaaten oder auch kleine, demokratische Rechtsstaaten mit einer Marktwirtschaft sind in der Regel auch wirtschaftlich erfolgreicher.
Sie schlagen vor, die direkten Steuern von den Gemeinden und Ländern einheben zu lassen und die indirekten beim Staat zu belassen. Warum?
Wenn die indirekten Steuern von den Gemeinden eingehoben werden, führt das zu Wettbewerbsverzerrungen, wie in den USA. Wir hatten einen Landwirtschaftsbetrieb an der Grenze zwischen Texas und Arkansas nahe der Stadt Texarkana. In Texas ist der Alkohol sehr teuer, dafür sind andere Produkte billiger, weil es keine Mehrwertsteuer gibt. In Arkansas ist es genau umgekehrt. Das Ergebnis: Auf der einen Seite der Stadt waren Bars und Alkoholgeschäfte, auf der anderen Seite die restlichen Geschäfte. Solche Wettbewerbsverzerrungen sind unsinnig. Deswegen sähe ich indirekte Steuern lieber auf Staatsebene. Bei den direkten Steuern kann ich den Gemeinden hingegen mehr Freiheiten geben, wie sie das gestalten wollen.
In diesem Modell sehen Sie einen Anreiz gegen zu viel Zentralismus und für einen effizienteren Umgang mit Steuergeldern. Könnten Sie das kurz erklären?
Wenn die Gemeindeautonomie relativ groß ist, etwa in der Sozialgesetzgebung oder in anderen Bereichen, dann kann die Gemeinde für wichtige Projekte die direkten Steuern für eine gewisse Zeit erhöhen. Falls die stimmberechtigten Gemeindebürger damit einverstanden sind, wird das Projekt realisiert und sonst wird es abgelehnt. Entscheidet hingegen der Zentralstaat über die direkten und indirekten Steuern, werden sich die lokalen Politiker und die lokale Bevölkerung auch um Projekte bemühen, die wenig sinnvoll sind, aber vom Zentralstaat bezahlt werden. Es profitiert dann die lokale Wirtschaft von den Geldern, die der Zentralstaat lokal ausgibt, aber das führt allzu oft zu einer Verschwendung von Steuergeldern.
„Den Staat zwingen, ein guter Dienstleister zu sein“
Die „Aufrechterhaltung des Rechtsstaats und die Außenpolitik“ bezeichnen Sie als die beiden Kernaufgaben des Staats im dritten Jahrtausend. Hierbei soll der Staat sogar mit privaten Anbietern in Konkurrenz treten. Wie soll das gehen? Sollen sich private Firmen um die Aufrechterhaltung des Rechtsstaats kümmern?
Nein. Aber es gibt heute schon private Sicherheitsdienste, die z.B. für Bewachungsaufgaben eingesetzt werden und die eng mit der Polizei zusammenarbeiten.
Natürlich kann der Staat Aufgaben auslagern, etwa an Sicherheitsfirmen am Flughafen. Es ist aber ein Unterschied, ob der Staat nach wie vor Auftraggeber ist oder ob er mit privaten Anbietern konkurriert.
Es ist nicht die Frage von Auftraggeber oder Konkurrenz, sondern es geht um Zusammenarbeit. Letzten Endes muss aber der Staat entscheiden, was er auslagert.
Ludwig von Mises unterstreicht in „Die Bürokratie“: Man kann nicht Ministerien, Militär- und Polizeieinheiten so organisieren, wie ein gewinnorientiertes Unternehmen im freien Wettbewerb.
Wie erwähnt, kann man gewisse Freiräume lassen, etwa für private Sicherheitsdienste, die innerhalb des Rechtssystems agieren. Es gibt ja auch Schiedsgerichte privater Natur zwischen Unternehmen oder internationale Schiedsgerichte. Sicherlich muss ein gewisses Rechtsmonopol beim Staat bleiben. Auch die Außenpolitik ist Aufgabe des Staates. Dennoch: Der Staat sollte aus meiner Sicht theoretisch kein Monopol auf das Staatsgebiet haben. In Liechtenstein haben wir das verwirklicht. So zwingt man den Staat, ein guter Dienstleister zu sein.
Sie sprechen auch von einer Informationspflicht des Staats, gerade in der direkten Demokratie. Werden im Fürstentum Liechtenstein die Bürger über ihre Verfassung und ihre Gesetze informiert?
Ja. Wir senden jedem Bürger, wenn er großjährig wird, die Verfassung zu. Man versucht auch, sehr freizügig zu sein beim Verschicken von Gesetzen, was aufgrund unserer direkten Demokratie auch notwendig ist. Wir müssen Gesetzesentwürfe breit streuen, bevor über sie entschieden wird. Wenn man im Parlament schnell etwas durchbringen will, ohne das Volk entsprechend zu informieren, läuft man Gefahr, dass dagegen das Referendum ergriffen wird.
„Das heutige Pensionssystem wird eines Tages zusammenbrechen“
In den vergangenen Jahrzehnten wurde der Sozialstaat stark ausgeweitet. Sie beschreiben den Sozialstaat als Versuch, „das Sozialverhalten in den Dörfern und kleinen Städten aus dem Agrarzeitalter auf den Staat zu übertragen.“ Könnten Sie das erklären?
Bei den Jäger- und Sammlerkulturen, aber auch noch im Agrarzeitalter lebte man in der Regel in sehr kleinen Gemeinschaften, und da gab es in der Regel einen großen Zusammenhalt, was dazu führte, dass sich die Gemeinschaft für Alte und Kranke, sowie um die Kinder kümmerte. In den großen, zentralisierten Staaten und im Industriezeitalter ist besonders in den großen Städten dieser soziale Zusammenhalt der kleinen Gruppe weitestgehend verloren gegangen. Deshalb musste man Sozialsysteme aufbauen, was nicht immer ganz einfach war.
Halten Sie die soziale Marktwirtschaft in Deutschland und Österreich für überlebensfähig?
Als das heutige Pensionssystem von Bismarck eingeführt wurde, lag die Lebenserwartung bei 65. Heute liegt sie bei knapp 80 oder sogar noch höher. Dass das nicht mehr finanzierbar ist, ist eine Milchmädchenrechnung. Dieses System wird eines Tages zusammenbrechen, und dann braucht man ein System, das funktioniert.
In der Schweiz stand man dem System Bismarcks schon anfangs kritisch gegenüber. Bereits nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Drei-Säulen-System (staatliche, betriebliche und private Vorsorge) eingeführt.
In der Schweiz fand man, dass dafür die Gemeinden zuständig sein sollen, wie schon früher. Auch bei uns war das übrigens vorher so: Die Gemeinde war zuständig für die Armen und Schwachen und hatte Einrichtungen, in denen sie untergebracht werden konnten. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man schon die Nachteile des Systems von Bismarck gesehen. Das Dreisäulensystem wurde eingeführt. Das haben wir dann in den 1950er Jahren übernommen. Das hat eigentlich gut funktioniert.
„Bei uns finanziert der Staat für alle das gleiche Minimum“
Deutschland und Österreich haben noch immer weitgehend ein Umlagesystem.
Auf staatlicher Ebene ist das auch bei uns so, nur finanziert man damit nur das Überlebensminimum. In Österreich bekommt man hingegen als ehemaliger Beamter eine wunderbare Pension. Es ist nicht einzusehen, dass ein hoher Beamter, der ohnehin schon privilegiert war in seinen Bezügen, auch in der Pension weiterhin solche Privilegien erhält. Bei uns ist das anders: Finanziert wird vom Staat für alle das gleiche Minimum. Daneben gibt es die steuerlich begünstigten Betriebs- und Privatpensionen.
In Ihrem Buch unterstreichen Sie: Bei der Umgestaltung des Sozialstaats müsste man das Pensionssystem als Erstes anpacken. Wie sollte das gehen? Man kann nicht von heute auf morgen die Pensionen nicht mehr bezahlen.
Nein. Das muss man weiterhin. Sie könnten aber zunächst beginnen, die Pensionen einzufrieren, sodass es für neue Pensionen keinen Ausgleich mehr für die Teuerung gibt. Und dann sollten Sie mit der Veränderung bei der nächsten Generation beginnen – je früher, desto besser. Bei späteren Pensionen wird nur mehr das Minimum bezahlt, private Pensionsversicherung und Betriebspension werden gleichzeitig steuerlich bevorzugt. Es gibt ja in vielen Unternehmen schon heute Betriebspensionen. So kann man dieses Dreisäulensystem langsam installieren im Kapitaldeckungsverfahren. Bei uns ist fast alles kapitalgedeckt. Das Pensionsalter müsste man ebenfalls erhöhen.
Ihrer Meinung nach sollten die Aufgaben des Sozialstaats auf die Gemeindeebene verlagert werden. Warum?
Man hat auf der Gemeindeebene einen wesentlich besseren Überblick über echte Bedürftigkeit, versteckte Armut und ob Leute Unterstützung erhalten, die sie gar nicht benötigen.
Positive Effekte der Privatisierung des Bahnausbaus
Kommen wir zur Infrastruktur. Ein beliebtes Argument gegen die Privatisierung der Zugunternehmen lautet: Es sei für Bahnen nicht rentabel, in entlegenere Gegenden zu fahren. Nur eine staatliche Bahn garantiere hier die Anbindung.
Der Transport von Waren ist vielfach besser, billiger und flexibler mit LKWs, die genau zur gewünschten Zeit kommen. Die Bahn sollte sich auf jene Gebiete konzentrieren, in denen sie einen echten Konkurrenzvorteil hat. Das könnte sogar in jenen Bereichen, in denen es sich lohnen würde, zu Bahnausbauten führen. Man könnte die Bahn verschlanken und konkurrenzfähiger machen. Ich habe das in den USA gesehen, wo die Bahn teils in privater Hand ist.
Sie würden eine Privatisierung der Bahn begrüßen?
Ich glaube, dass man dann den Bahnausbau mehr nach der Nachfrage steuern würde. Mehr Innovation, mehr Hochgeschwindigkeitsbahnen als Konkurrenz für den Flugverkehr könnten eine interessante Folge sein. Bis zum Flughafen muss man meistens weite Wege mit dem Auto zurücklegen. Da hätte die Bahn eine interessante Marktlücke bezüglich mittlerer Strecken.
Sie könnte auch Kleinstädte miteinander verbinden. Sie vermuten in Ihrem Buch daher, dass das Elektroauto davon profitieren würde, weil es auf den städtischen Bereich beschränkt wäre.
Man könnte die Straßen entlasten. Die Umweltsituation würde sich verbessern.
Der freie Markt hätte hier keine größeren Umweltschäden zur Folge?
Ich glaube nicht. Es würde mich wundern, falls jemand die Bahn kaufen und dann wieder auf Kohle umsteigen würde.
Als erstes Ziel des Staates nennen Sie das Vermeiden von Kriegen. Warum kann aus Ihrer Sicht das von Ihnen vertretene Staatsmodell am besten den Frieden gewährleisten?
Ich habe vier Ziele oder Bedingungen aufgezählt, die ein Staatsmodell im dritten Jahrtausend erfüllen muss, um erfolgreich zu sein. Das erste Ziel ist das Selbstbestimmungsrecht auf Gemeindeebene. Das zweite Ziel ist, dass der Staat nicht nur einer privilegierten Schicht von Menschen dient, sondern allen Menschen innerhalb dieses Staates. Das dritte Ziel ist, dass der Staat den Menschen ein Maximum an Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bietet und das vierte Ziel ist, dass der Staat im Zeitalter der Globalisierung der Konkurrenz gewachsen ist. Damit werden Bürgerkriege oder Eroberungskriege sinnlos, denn es entscheidet die jeweilige Bevölkerung, in welchem Staat sie leben will und wie sie dort leben will. Dafür müssen sie das Selbstbestimmungsrecht auf Gemeindeebene einführen und die direkte Demokratie wie in Liechtenstein.
*****
Vortrag „Der Staat im dritten Jahrtausend“ von S.D. Fürst Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein
—————————————————————————————————————————————————————————-
Fürst Hans-Adam II. wurde 1945 als ältester Sohn von Fürst Franz Josef II. von und zu Liechtenstein und Fürstin Gina geboren. Er besuchte das Schotten-Gymnasium in Wien und das Gymnasium in Zuoz, danach folgte ein Studium an der Universität St. Gallen, das er 1969 mit Erlangen des Lizentiats in Betriebs- und Volkswirtschaft abschloss. Nach dem Studium widmete er sich der Reorganisation und dem Wiederaufbau des Familienvermögens. 1984 ernannte ihn sein Vater zu seinem Stellvertreter. Nach dem Tod des Vaters übernahm Fürst Hans-Adam II. am 13. November 1989 die Regentschaft. Am 15. August 2004 ernannte er seinen ältesten Sohn, Erbprinz Alois, zu seinem Stellvertreter, um ihn auf seine Thronnachfolge vorzubereiten.
*****
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Institut Deutschland wieder.
Fotos: Fürstenhaus Liechtenstein