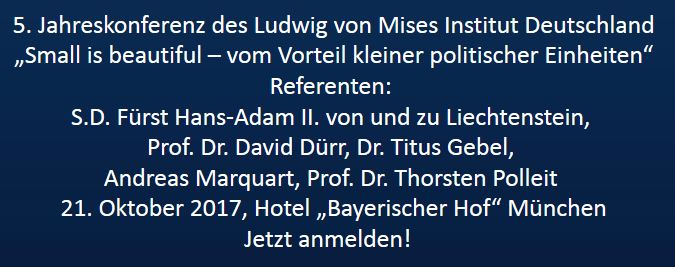Alle gewinnen, wenn die Schweiz die Schweiz bleibt
30.8.2017 – von Gerhard Schwarz
Seit Jahrhunderten geht die Schweiz auf dem europäischen Kontinent einen eigenen Weg. Besonders sichtbar gemacht hat sie dies mit dem Nein von Volk und Ständen zum Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) im Jahre 1992. Auch andere Abstimmungsergebnisse, etwa das knappe Ja zur sogenannten Masseneinwanderungs-Initiative im Jahr 2014, waren Ausdruck dieser Eigenwilligkeit. Sie ist innerhalb wie ausserhalb des Landes immer wieder Anfechtungen ausgesetzt. Klar aber ist, dass ein Beitritt der Schweiz zur EU derzeit laut Umfragen nur von 16 Prozent der Bevölkerung unterstützt wird.
Dieses runde Sechstel leidet an der Idee einer kleinen, feinen Schweiz, die sich wenig um die Weltpolitik kümmert, aber alles daran setzt, das eigene Haus in Ordnung und als Standort für Arbeit, Kapital und Wissen attraktiv zu halten. «Wir wollen doch nicht zum Monaco Europas verkommen!», schleudern sie einem entgegen und suggerieren, Monaco, San Marino oder Andorra seien keine souveränen, vollwertigen Staaten. Aber was wäre denn an diesem Monaco Europas so schrecklich? Leben die Bürgerinnen und Bürger Monacos schlecht? Und wie sieht es in Hongkong oder Singapur aus? Zwar sind beide wahrlich keine Aushängeschilder politischer Freiheiten, aber im einen Fall werden die Rechte von «aussen», von Beijing, beschnitten, im anderen vom eigenen Regime, und in den Nachbarländern sieht es nirgends besser aus. Die Integration in ein grösseres Ganzes brächte also sicher nicht mehr politische Freiheit und Mitbestimmung und kostete dazu noch einigen Wohlstand.
Will man den Willen der Mehrheit der Schweizer zur Eigenständigkeit verstehen, muss man Freiheit und Selbstbestimmungsrecht des Bürgers, die in der Schweiz zentral sind, gedanklich vom Selbstbestimmungsrecht des Staates als Ganzem trennen. Bei Letzterem geht es um die Souveränität des Landes und seine Einfluss- und Mitgestaltungsmöglichkeiten in der internationalen Politik. Wer in erster Linie dieses Handeln des Staates im Auge hat, wird das Individuum leicht vergessen und die Organisation eines Landes vielleicht sogar als lästig empfinden. Wer dagegen Freiheit und Wohlergehen des Einzelnen anstrebt, muss sich zwar auch um die Rolle des Landes in der Welt sorgen, wird aber vor allem die innere Verfassung des Staates, die Gestaltung des Zusammenlebens und der staatlichen Institutionen sowie das Verhältnis von Bürger und Staat im Auge behalten.
Lieber Monaco als China
«Cui bono?» lautet die Schlüsselfrage. Wem nützt ein unabhängiger Kleinstaat Schweiz? Und welcher Preis ist dafür zu bezahlen? Aus liberaler Sicht fällt die Antwort leicht: Die staatliche Souveränität muss für den Bürger da sein, nicht der Bürger für die Souveränität. Sie ist nur relevant mit Blick auf die Sicherung der Freiheit der Bürgerinnen und Bürger sowie die Erhaltung und Mehrung des Wohlstands. Staatliche Souveränität, die diesen Zielen dient, ist erstrebenswert. Wo dagegen der Verzicht auf sie dem Individuum mehr Freiheit und Wohlstand bringt, kann sie geopfert werden. Daher wird der liberal denkende Mensch lieber im begrenzt souveränen Fürstentum Monaco leben als in der souveränen Volksrepublik China. Auch eine formell unabhängige, de facto aber beschränkt souveräne Schweiz inmitten Europas muss aus liberaler Sicht kein Übel, sondern kann ein Segen sein, für die Bevölkerung des Landes ebenso wie für die des restlichen Europas. Wie also steht es um die Lebensfähigkeit eines solchen Kleinstaates? Und welche Rolle könnte er im Gesamtgefüge spielen?
Bis 1989 hätte sich die Frage nach der Daseinsberechtigung von Kleinstaaten nicht so eindeutig beantworten lassen. Der Glaube an «Economies of scale» beherrschte Politik wie Wirtschaft. Ernst Friedrich Schumachers «Small is beautiful» und Leopold Kohrs «Disunion now» waren Minderheitenprogramme. Inzwischen hat sich das Blatt gewendet. In der Wirtschaft rief die Tatsache, dass in der Finanzkrise vermeintlich krisenresistente Grossbanken untergegangen wären, wenn sie der Staat nicht gerettet hätte, den Charme der Kleinheit in Erinnerung. Und in der Politik, wo der Fall des Eisernen Vorhangs eine Kleinstaateninflation brachte, eilten viele Kleinstaaten von Erfolg zu Erfolg. Ob man das Pro-Kopf-Einkommen, die Wettbewerbsfähigkeit, die Innovationslust, die Lebensqualität oder gar das Glück misst, die vordersten Plätze gehören – abgesehen von den USA – Kleinstaaten. Kleinheit bedeutet Bürgernähe und Nähe zu den Problemen. Das hilft, Herausforderungen anzugehen.
Die Schweiz zählt zu den erfolgreichsten Staaten überhaupt. Sie ist wettbewerbsfähig, ihre makroökonomischen Kennzahlen sind besser und nachhaltiger als die der meisten Mitbewerber, ihre Waren und Dienstleistungen, einschliesslich der Verkehrswege, die das Land queren, sind gefragt, und sie hat sich in der Geschichte immer wieder neuen Bedürfnissen anzupassen vermocht. Zudem ist das politische System mit direkter Demokratie, Föderalismus, Milizkultur und Konkordanz ein einzigartiges Beispiel des Zusammenlebens unterschiedlicher Kulturen und Religionen in einer Willensnation. Dieses Land schafft also vieles aus eigener Kraft und könnte sich in einer Welt ohne Handelsbarrieren, Machtgefälle, Schikanen oder demonstratives Desinteresse der Grossmächte an den Kleinstaaten gut behaupten.
In der realen Welt hängt die Lebensfähigkeit allerdings nie nur von der eigenen Tüchtigkeit ab. Kleinstaaten können in Anlehnung an Schillers «Wilhelm Tell» nur in «Frieden» leben, wenn es den Nachbarn gefällt, wenn also die EU dem sperrigen Kleinstaat Schweiz mit Respekt begegnet, ihn nicht als Trittbrettfahrer oder Störenfried empfindet und ihn nicht als «quantité négligeable» behandelt. Sonst kann alle Anstrengung des Kleinstaates umsonst sein. Diese Erkenntnis hat zumal bei professionellen Schweizer Aussenpolitikern zur depressiven Überzeugung geführt, der eigenständige Weg sei, da man ja nicht wirklich autonom sei, verbaut, sodass nichts anderes übrig bleibe, als der EU beizutreten. Doch Kleinheit ist kein Grund zur Schwermut, solange man sich nicht zu sehr mit den Grossen messen will. Wenn man akzeptiert, dass Kleinheit und Eigenständigkeit neben den Nachteilen auch viele Vorteile haben, fällt es leichter, mit ihnen zu leben.
So oder so sollte klar sein, dass ein selbstständiger Kleinstaat in Europa nicht überleben könnte, wenn es die EU nicht wollte. Die Berlin-Blockade 1948/49 oder die Abhängigkeit Singapurs von Malaysia bei der Trinkwasserversorgung sind nur zwei Beispiele, die zeigen, wie es um die reale Autonomie von Kleinstaaten steht. Selbst wenn die EU ohne böse Absicht Gesetze erlässt und Institutionen schafft, die Nicht-EU-Staaten benachteiligen, kann dies für die Schweiz gravierend sein. Ihre historische und geografische Einbettung in Europa macht sie für solche Gefährdungen viel anfälliger als etwa Neuseeland oder Singapur. Ein Kleinstaat braucht ein offenes Hinterland, mit dem er sich austauschen, aus dem er Lebensnotwendiges beziehen und in das er Güter und Dienste liefern kann. Man kann dies zwar durch eine globale Diversifikation der Waren-, Dienstleistungs- und Finanzströme teilweise auffangen, aber letztlich bleibt ein Land Gefangener seiner Geografie. Erst recht schmerzhaft wäre es für die Schweiz daher, wenn sie gezielt diskriminiert würde. Es kann dafür viele Motive geben, offensichtlich unedle ebenso wie erst auf den zweiten Blick als solche erkennbare. Zu Ersteren zählte die protektionistische Absicht, den Konkurrenten im Standortwettbewerb zu schädigen, die aus Neid genährte Benachteiligung des erfolgreichen Nachbarn oder die erpresserische Erzwingung von «Wohlverhalten». Zu Letzteren könnte man den «sanften» Druck in Richtung EU-Beitritt rechnen, weil man das störrische Nichtmitglied zu seinem Glück zwingen müsse; es werde es einem später danken. Angesichts der Lage der EU handelte es sich bei dieser Begründung um Verblendung oder Heuchelei.
Vermutlich genügte es für ein gutes Gedeihen der Schweiz in kleinstaatlicher Unabhängigkeit nicht, dass sich die EU einfach korrekt verhielte. Vielmehr wäre dafür jene Grosszügigkeit, jenes Wohlwollen und jene Toleranz gegenüber dem eigenwilligen Kleinstaat nötig, die wirklich souveränen Menschen und Institutionen eigen sind. Schweizerische Interessenwahrung müsste hier ansetzen. Sie dürfte sich nicht zu schade sein, um die Gunst der EU (und ihrer Mitgliedsländer) zu werben und zu versuchen, diesen Nachbarn, in dessen Umzingelung man sich befindet, freundlich zu stimmen. Sie müsste ferner klarmachen, dass sich gesunde völkerrechtliche Beziehungen gerade in der Grosszügigkeit der Grossen gegenüber den Kleinen manifestieren. Vor allem aber müsste sie darlegen, wie sehr die Existenz eines unabhängigen Kleinstaates für beide Seiten von Vorteil ist, für den Kleinstaat und für den Staatenverbund. Unbestrittene Voraussetzung ist natürlich, dass der Kleinstaat sein Haus in Ordnung hält, den anderen nicht zur Last fällt und für den Nutzen, den er aus dem grossen Staatenverbund zieht, Gegenleistungen erbringt. Die Schweiz darf kein Schmarotzer sein. Sie darf – perception is reality – nicht einmal den Anschein erwecken, sie wolle profitieren, ohne zu zahlen. So müsste es ihr gelingen, das Wohlwollen ihrer Partner zu gewinnen.
Die EU reagiert mit grösster Strenge
Die Reaktionen Brüssels auf den Brexit-Entscheid lassen diesbezüglich jedoch Zweifel aufkommen. Leider überwiegen die Anzeichen, dass die EU das abtrünnige Land mit grösster Strenge behandeln möchte, selbst unter Inkaufnahme eigener Nachteile, damit nur ja nicht andere Mitglieder auf die Idee kommen, die Briten zu kopieren. Das wäre auch für die Schweiz keine gute Vorlage. Sollten allerdings in der EU doch die wirtschaftlichen und verteidigungspolitischen Eigeninteressen gegenüber der ideologischen Fixierung obsiegen, könnte das auch der Schweiz Chancen eröffnen. Im Gegensatz zur Schweiz integrieren sich die meisten europäischen Kleinstaaten in die EU und versuchen, durch eine verfassungsrechtlich verankerte Abtretung nationaler Souveränität an diese supranationale Institution sui generis ihre Autonomie zu sichern. Sie hoffen, durch Mitgestaltung auf die Entwicklung der EU Einfluss nehmen und so die nationalstaatlichen Interessen besser wahren zu können als in einem oft gar nicht so autonomen Nachvollzug.
Tatsächlich ist die Angst vor einem Souveränitätsverlust durch Integration kaum berechtigt. Ein teilweises Aufgehen in einem grösseren Verbund muss nicht einen Verlust an Souveränitätsrechten bedeuten, sondern kann sogar deren Absicherung darstellen – zumindest formaljuristisch. Hingegen sollte man die Bedeutung des Mitentscheidens nicht überschätzen. Das Gewicht der Kleinstaaten ist klein, und es ist ohnehin nur dann von Bedeutung, wenn nationale Interessen auf dem Spiel stehen und ein Entscheid so knapp ist, dass er sich trotz des geringen Gewichts des Kleinstaates kippen lässt. In Summe dürfte die Schweiz durch ein Mitentscheiden in der EU also wohl weniger Gestaltungsmacht gewinnen, als ihr trotz allen «autonomen Nachvollzugs» und aller Satellitisierung im Fall der Eigenständigkeit noch verbliebe.
 Wichtig wäre aber, dass sich die Schweiz und die EU bewusst würden, dass ein unabhängiger Kleinstaat Schweiz eine Rolle zugunsten des europäischen Staatenverbundes zu spielen hätte, dass er nicht in erster Linie störender Querulant wäre. Diese Rolle bestünde, erstens, in der Funktion, die auch jede Stadt für ihr Hinterland spielt, nämlich der einer zentralen Dienstleisterin, einer Anbieterin von zentralörtlichen Funktionen, etwa als Finanz- und Vermögensverwaltungsplatz, als Zentrum für Gesundheit, Wellness und Erholung, als Wissenschaftsstandort oder als Verkehrsdrehscheibe. Das können zwar andere Regionen ebenfalls leisten, auch solche, die sich innerhalb der EU befinden. Dennoch sollte man diesen Beitrag der Schweiz an Europa nicht geringschätzen.
Wichtig wäre aber, dass sich die Schweiz und die EU bewusst würden, dass ein unabhängiger Kleinstaat Schweiz eine Rolle zugunsten des europäischen Staatenverbundes zu spielen hätte, dass er nicht in erster Linie störender Querulant wäre. Diese Rolle bestünde, erstens, in der Funktion, die auch jede Stadt für ihr Hinterland spielt, nämlich der einer zentralen Dienstleisterin, einer Anbieterin von zentralörtlichen Funktionen, etwa als Finanz- und Vermögensverwaltungsplatz, als Zentrum für Gesundheit, Wellness und Erholung, als Wissenschaftsstandort oder als Verkehrsdrehscheibe. Das können zwar andere Regionen ebenfalls leisten, auch solche, die sich innerhalb der EU befinden. Dennoch sollte man diesen Beitrag der Schweiz an Europa nicht geringschätzen.
Zweitens könnte und müsste sich der unabhängige Kleinstaat Schweiz natürlich immer wieder an Projekten der EU beteiligen, die auch ihm zugutekommen. Die Schweiz würde also einiges in Europa mitfinanzieren und mitunterstützen, aber fallweise, also immer nur dort, wo es für beide Seiten sinnvoll ist. Wichtigste Rolle des eigenständigen, «abseits» stehenden Kleinstaates Schweiz wäre aber, drittens, die fast philosophische Rolle des Gegenmodells, des Massstabs, an dem man sich messen kann, in kleinen Bereichen der Politik wie in grossen Fragen der staatlichen und wirtschaftlichen Ordnung. Davon profitieren, wie im Wettbewerb der Unternehmen, die konkurrierenden Produzenten ebenso wie die nachfragenden Konsumenten. Anbieter sind in der Politik Regierungen und staatliche Verwaltungen, die durch Wettbewerb zu Innovation und Effizienz getrieben würden; Nachfrager sind Bürgerinnen und Bürger, die zu niedrigeren Steuern oder besseren Preis-Leistungs-Paketen kämen. Der Stachel im Fleisch verhindert Trägheit und Nabelschau. Ein zentraler Aspekt dieses Gegenmodells ist das politische System der Schweiz. Es umfasst einen veritablen, auch fiskalischen Wettbewerb kleinster Gebietseinheiten, nämlich von 26 Kantonen und über 2000 Gemeinden. Es basiert ferner auf der These, dass das Volk und Teilzeitpolitiker nicht irrtumsanfälliger oder dummheitsanfälliger sind als Experten und Berufspolitiker (natürlich auch nicht weniger anfällig). Und es gesteht schliesslich dem Volk weitestgehend das Recht zu, Selbstbindungen bis hin zu völkerrechtlichen Verträgen wieder zu kündigen. Um es mit Tony de Jasay zu formulieren: Diese Selbstbindungen sind wie ein Keuschheitsgürtel, zu dem die Dame selbst den Schlüssel verwaltet. Würde ihn jemand anderer verwalten, etwa ein oberstes Gericht, würde das die Dame entrechten, vor allem aber könnte niemand garantieren, dass der Schlüsselverwalter tatsächlich im Interesse der Dame (beziehungsweise des Volkes) handelt.
Eine vierte Rolle, die einem aussenstehenden Kleinstaat Schweiz zukäme, wäre die des Vermittlers. Kleine Staaten geniessen in vielen Situationen grössere Glaubwürdigkeit, weil sie keine hegemonialen Ansprüche und – angesichts der Kleinheit – auch nur kleine Eigeninteressen verkörpern. Das erlaubte es der Schweiz, weiterhin «Gute Dienste» zu leisten, jenseits aller Blockzugehörigkeiten. Vielleicht könnte der neutrale Aussenseiter sogar einmal vermitteln, wenn es innerhalb der EU zu heftigeren Auseinandersetzungen käme, eine Perspektive, die ja alles andere als unwahrscheinlich ist.
Die Schweiz als Rettungsboot
Die Schweiz könnte als Kleinstaat inmitten Europas gut überleben. Nichts spricht gegen ihre Lebensfähigkeit und Daseinsberechtigung. Zentrale Voraussetzung ist jedoch, dass sie in dieser Rolle von allen Mitspielern gewollt wird. Wenn die EU diesen Staat nicht will, kann sie ihn mit ihrer Macht verhindern. Die Vorteile eines Wettbewerbs der Systeme, und sei es einer zwischen einem Staat, der bei Einwohnerzahl und Fläche zum unteren Mittelstand zählt, und einem Staatenverbund von kontinentaler Ausdehnung und enormer Potenz, liegen zwar auf der Hand, passen aber nicht zum in Europa gängigen «mind set» der Harmonisierung. In der Schweiz ist die Idee des teilsouveränen Kleinstaates – selbstständig, aber von seinem Hinterland abhängig – aus anderen Gründen noch nicht angekommen.
Im Kalten Krieg wuchs der Schweiz dank Wirtschaftsmacht, Neutralität und geografischer Lage eine weltpolitische Rolle zu, die weit über ihre Grösse hinausging. Dementsprechend tun sich viele schwer, einzusehen und zu akzeptieren, dass nun über viele grosse Angelegenheiten, die einen selbst betreffen, andere entscheiden – ganz gleich, ob man mit am Tische sitzt oder nicht. Für sie heisst Selbstbescheidung Rückschritt und Verlust an völkerrechtlicher Würde. Die Schweiz als kleines Boot auf den Wellen des europäischen Meeres, die sie nicht beeinflussen kann, denen sie sich anpassen muss – das mag ernüchternd tönen, sollte aber nicht deprimieren. Gelegentlich helfen kleine Rettungsboote zu überleben, wenn grosse Schiffe in Stürmen, die sie nicht beeinflussen und abwehren können, in Schwierigkeiten geraten. Diese Rettung funktioniert jedoch nur, wenn das grosse Schiff und das kleine Boot eine symbiotische Beziehung pflegen und wenn das Boot nicht so fest an den Dampfer gekettet ist, dass es – wenn es gebraucht würde – mit diesem untergeht.
*****
Dieser Beitrag ist zuerst in der Basler Zeitung erschienen.
Das könnte Sie auch interessieren … ein Interview mit Konrad Hummler: Kleinstaat Schweiz – Auslauf- oder Erfolgsmodell?
—————————————————————————————————————————————————————————–
Gerhard Schwarz, geboren 1951, arbeitete 30 Jahre für die NZZ, davon 16 Jahre als Leiter des Wirtschaftsressorts und zwei Jahre als stellvertretender Chefredaktor. Sieben Jahre war er Präsident von Avenir Suisse. Heute ist er freier Publizist und Präsident der Progress Foundation, die im Juni den Sammelband «Kleinstaat Schweiz – Auslauf- oder Erfolgsmodell?» herausgab. Dieser Text basiert auf dem Beitrag «Bürgersouveränität vor Staatssouveränität», den Schwarz im Buch veröffentlichte.
*****
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Institut Deutschland wieder.
Foto Startseite: © Denys Rudyi – Fotolia.com