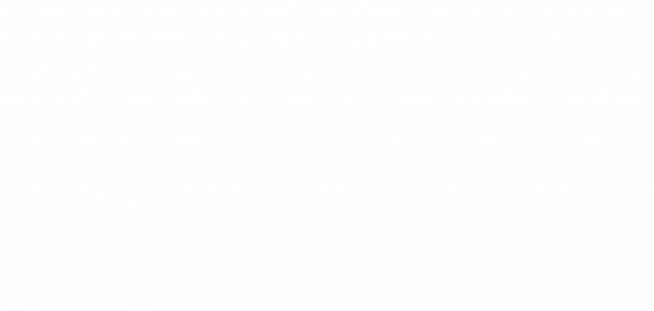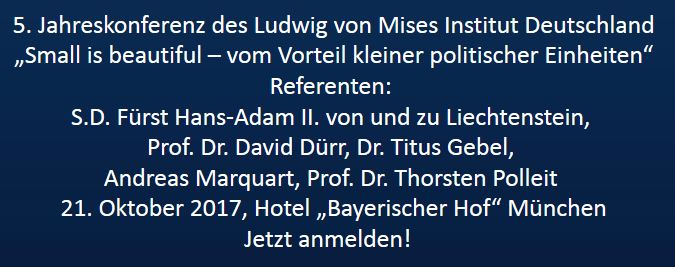Große Politik geht auch eine Nummer kleiner
22.5.2017 – Kleine, souveräne Staaten sind besser in der Lage, ihren Bürgern Freiheit, Wohlstand und Frieden zu sichern als jede Großmacht und jeder Staatenverbund
von Andreas Marquart
Im Umfeld der 60. Wiederkehr des Tages der Unterzeichnung der Römischen Verträge am 25. März 1957 und damit der Geburtsstunde der späteren Europäischen Union (EU) war von der Politik und in den Medien mehr noch als sonst zu lesen und zu hören, wie man sich die Gegenwart, vor allem aber die Zukunft der EU im Zeichen von Europamüdigkeit, wachsendem Nationalismus, Brexit und Trump vorstellt. Davon, dass wir angesichts der Krise jetzt „mehr Europa“ brauchen, war da die Rede, dass es gelte, einer engeren politischen Integration entgegenzustreben, einer föderalen Union mit weitreichenden Kompetenzen. Von der Einrichtung einer europäischen Generalstaatsanwaltschaft zur Verfolgung von Straftaten, die den finanziellen Interessen der EU schaden, ist die Rede, von einem gemeinsamen europäischen Verteidigungsfonds, von einem europäischen Ausbildungsverbund zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit.
Sehr viele mehr oder weniger Informierte scheinen sehr genau zu wissen, wie Europa am Ende aussehen muss. Sie scheinen eine genaue Vorstellung davon zu haben, wie Europa – ja, wie die ganze Welt – zu gestalten und zu organisieren ist. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie Ludwig Erhard (1897 – 1977) heute aus dem Rahmen fiele, würde er seine Stockholmer Rede vom März 1963 heute noch einmal halten. Damals sagte er:
„Es wäre aus meiner Sicht wenig glücklich, wenn wir die Welt wieder in sogenannte ‚Großräume’ aufspalten wollten, die in sich selbst Genüge zu finden versuchten. Das würde die Spannungen selbst innerhalb der freien Welt noch verstärken. Eine Vielzahl von Nationalstaaten mag im Widerstreit der Interessen zu Reibungen, zu Spannungen und, wie wir erfahren haben, selbst zu kriegerischen Verwicklungen führen. Aber je mehr größere wirtschaftliche und politische Räume mit Machtanspruch auftreten, umso gefährlicher werden zwangsläufig die Gegensätze, wenn auch nicht von Anfang an der Wille zur Verständigung, zur Versöhnung und zur Zusammenarbeit lebendig ist.“
In der Tat ist es so, dass der Weg zu weniger Politik und damit zu mehr Freiheit und Wohlstand eben nicht über größere politische Einheiten führt. Im Gegenteil: Mehr Freiheit und Wohlstand kann es nur mit weniger Staat und weniger Politik geben. Politik schafft keinen Wohlstand. Und Politik löst keine Probleme – sie ist das Problem. Dessen ungeachtet ist der Glaube an das Primat der Politik groß. Der Glaube an die politische „Machbarkeit“ ist allgegenwärtig – in der Politik selbst freilich vermutlich weit mehr als in der Bevölkerung.
Opportunismus spielt in der Politik eine wichtige Rolle, oft wird gar wider besseres Wissen gehandelt. Schließlich sind die Ziele der Partei zu beachten, nicht selten sind Versprechen einzulösen oder man muss sich revanchieren, will Kollegen nicht verärgern und, nicht zuletzt: Politiker denken an ihren langfristigen Vorteil und an zukünftige Ämter. Politiker denken dauernd an Wiederwahl – nach der letzten Wahl ist vor der nächsten Wahl. Politische Akteure leben und handeln beständig in dem Spannungsfeld zwischen dem eigenen Anspruch und dem, was den Bürgern versprochen wurde. Politik muss zwangsläufig zu Hilfsmitteln greifen, die die Motivation politischen Handelns kaschieren und dabei freizügig die geläufigen, sich der genauen Definition entziehende Begriffe „Werte“, „soziale Gerechtigkeit“, „Chancengleichheit“ und „Allgemeinwohl“ verwenden.
Allein schon die Tatsache, dass die Nachrichten zu 80 Prozent aus Politik bestehen, nährt den Glauben an das Primat der Politik tagein, tagaus aufs Neue. Was es nicht in die Nachrichten schafft, ist das ständige freiwillige millionen- und milliardenfache Zusammenwirken von Menschen. Und vieles davon würde noch besser funktionieren, wenn sich der Staat mehr heraushielte. Der Ökonom Roland Baader (1940 – 2012) hat das einmal sehr griffig formuliert, als er schrieb:
„Die politische Kaste muss ihre Existenzberechtigung beweisen, indem sie etwas macht. Weil aber alles, was sie macht, alles viel schlimmer macht, muss sie ständig Reformen machen, das heißt, sie muss etwas machen, weil sie etwas gemacht hat. Sie müsste nichts machen, wenn sie nichts gemacht hätte. Wenn man nur wüsste, was man machen kann, damit sie nichts mehr macht.“
Nun, man wäre ja schon froh, wenn sie weniger macht. Und dazu braucht es kein immer weiter vernetztes Europa – dazu braucht es kleinere politische Einheiten. Eine Volkswirtschaft in der Größe Europas mit 500 Millionen Einwohnern lässt sich nicht von oben lenken und steuern, auch wenn die Politik vorgibt, dazu in der Lage zu sein. Diese 500 Millionen Menschen – ebenso wie die rund 80 Millionen alleine in Deutschland – haben Ziele, kurzfristige, mittelfristige und langfristige. Sie haben Präferenzen, die sich permanent ändern können. Sie machen täglich neue Erfahrungen, und sie lernen dazu, sie passen ihre Ziele entsprechend an, sie definieren ständig neu, welchen Preis ihnen welche Ware oder Dienstleistung, welche Notwendigkeit und welche Bequemlichkeit wert sind. Ein jeder von ihnen besitzt ein exklusives Wissen, das sich niemals – auch nicht von den besten Statistikern, auch nicht mit den aufwändigsten Erhebungen – zusammentragen, kategorisieren und auswerten lässt.
Politik wird nur besser und weniger, wenn sie Wettbewerb ausgesetzt wird – und das geht nur über kleinere politische Einheiten. In diesem Zusammenhang ist es hilfreich, sich das Pro-Kopf-Einkommen kleiner Nationen anzusehen; denn sieben der zehn reichsten Länder der Welt sind kleine Staaten. Ebenfalls aufschlussreich: die Liste der Länder mit der höchsten wirtschaftlichen Freiheit, erstellt von der Heritage Foundation in den USA. Spitzenreiter sind Hongkong, Singapur Neuseeland und die Schweiz. Relativ weit abgeschlagen auf Rang 26 findet sich Deutschland, Frankreich nimmt gar Platz 72 ein, Italien 79.
Wirtschaftliche Freiheit entsteht umso mehr, je mehr sich eine Regierung als Dienstleister versteht und sich bemüht, eine attraktive Leistung zu bieten. Das aber hält nur für nötig, wer Mitbewerber hat. Leistet die Regierung eines Landes das aber nicht, sondern liefert ein schlechtes Bildungssystem, schlechte Straßen und mangelnden Respekt vor dem Eigentum der Bürger– dann gerät sie umso leichter unter Druck, je näher ihre Bürger zur nächsten Grenze leben. Dann werden viele Bürger nämlich mit den Füßen abstimmen; denn seinen Lebensmittelpunkt in ein verträglicheres Umfeld zu verlagern ist umso einfacher, je näher erreichbar dieses ist – zumal, wenn es im gleichen Sprach- oder Kulturraum liegt.
Gerade die Herausforderungen durch die Globalisierung sind ein Argument für Kleinstaaten. Gerade, weil die Welt immer komplexer wird, bedarf es großer Flexibilität. Und flexibel ist, wer klein ist. Große Flächenstaaten sind wie Supertanker: Sie brauchen ewig für ein Wendemanöver – und falls sie es nicht schaffen, ist der Schaden groß. Den haben dann die Bürger zu tragen in Form von Wohlstandsverlusten, wenn nicht noch Schlimmerem. Die Politik hat sich indessen abgesichert, ihre Schuld war es nicht, dass sie wenden musste, für den Schaden sieht sie sich nicht haftbar – eine Haltung, die umso schwerer umzusetzen ist, je näher Regierung und Bürger zusammenleben und je beobachtbarer, kontrollierbarer und greifbarer sie ist.
Kleine Staaten können aufgrund ihrer überschaubaren Größe besser experimentieren. Sie können eigene Fehler leichter korrigieren und Fehler, die andere gemacht haben, leichter vermeiden. Dafür aber braucht es Konkurrenz und Wettbewerb von Ideen – und jede Zentralinstanz stoppt und erstickt diesen Wettbewerb. Der Schweizer Publizist Robert Nef hat das Richtige auf den Punkt gebracht:
„Es hat sich im Lauf der Geschichte immer wieder gezeigt, dass sich sogenannt rückschrittliche Strukturen plötzlich wieder als modern und fortschrittlich erwiesen haben. Zentralisierung birgt immer auch die Gefahr einer ‚Vereinheitlichung gemäß dem neusten Stand des wissenschaftlichen und politischen Irrtums’ in sich. Keine Regierung ist davor gefeit. Lauter kleine nonzentrale Irrtümer, die gegeneinander konkurrieren, sind hingegen auf die Dauer auch in punkto Freiheitsgehalt und Lernfähigkeit im Vergleich mit einem großen, hochzentralisierten System effizienter und – nach außen und innen – weniger gefährlich.“
*****
Der Beitrag basiert auf einem Vortrag, den der Autor am 6. April 2017 bei der Vorstellung des gemeinsam mit Philipp Bagus veröffentlichten Buchs Wir schaffen das – alleine im Haus des Familienunternehmens am Pariser Platz in Berlin-Mitte gehalten hat.
Der Beitrag ist zuerst erschienen in DER HAUPTSTADTBRIEF.
——————————————————————————————————————————————————————————–
Andreas Marquart ist Vorstand des “Ludwig von Mises Institut Deutschland”. Er ist Honorar-Finanzberater und orientiert sich dabei an den Erkenntnissen der Österreichischen Geld- und Konjunkturtheorie. Im Mai 2014 erschien sein gemeinsam mit Philipp Bagus geschriebenes Buch “WARUM ANDERE AUF IHRE KOSTEN IMMER REICHER WERDEN … und welche Rolle der Staat und unser Papiergeld dabei spielen”. Im März ist sein neues Buch, ebenfalls gemeinsam mit Philipp Bagus erschienen: Wir schaffen das – alleine!
*****
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Institut Deutschland wieder.