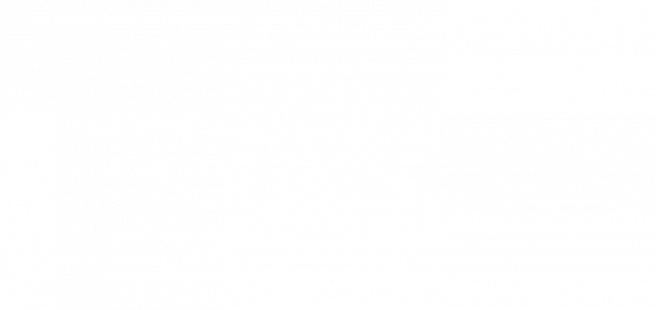Einen „echten Goldstandard“ gab es noch nie
11.5.2015 – Wenn er auch weit von einer privaten, wettbewerblichen Geldordnung und somit von »gutem Geld« entfernt war, so begünstigte der klassische Goldstandard des späten neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhunderts doch einen in der Geschichte bedeutenden Anstieg wirtschaftlichen Fortschritts. Marcia Christoff-Kurapovna gibt im nachfolgenden Beitrag einen Überblick über das internationale Währungssystem dieser Zeit.
Andreas Marquart
————————————————————————————————————————————————————————
Ein Porträt des klassischen Goldstandards
von Marcia Christoff-Kurapovna.
„Die Welt, die 1914 verschwand, schien im Nachhinein ein Paradies zu sein“, schrieb der Ökonom Cecil Hirsch im Juni von 1934 in seiner Rezension des Klassikers von R.W. Hawtrey, The Art of Central Banking (1933). Hirsch bedauerte den Verlust der weitsichtigen Zurückhaltung, die einst bei den Zentralbanken des Westens vorherrschte, und stellte die These auf, dass die modernen Zeiten „dabei fehlschlugen, das Niveau der Weisheit und Voraussicht beizubehalten, das im 19. Jahrhundert gegolten hatte.“
Diese Weisheit und Voraussicht war einmal durch eine internationale Geldkultur institutionalisiert – auf Gold basierend, bei Kredit zurückhaltend, private und öffentliche Schulden verachtend. Diese Welt betraf Zentralbanken wie die Bank of England, die Banque de France, die Schweizer Nationalbank, die frühe Federal Reserve, die Österreichisch-ungarische Nationalbank und die deutsche Reichsbank. Aber die fest verwurzelte Ideologie des harten Geldes bändigte all diese Banken. Beispielsweise besaß die Bank Rossii, die Zentralbank der Russischen Föderation, die einst eine Golddeckung von 50 bis 100 Prozent auf alle neuen Banknoten garantierte, bei der Wende zum 20. Jahrhundert die zweitgrößte Goldreserve der Welt.
„Die Länder, die gemeinsam mit dem Goldstandardsystem verbunden waren, repräsentierten zu einem gewissen Grad eine Interessens- und Verantwortungsgemeinschaft für die Aufrechterhaltung einer wirtschaftlichen und finanziellen Stabilität auf der ganzen Welt“, erzählte Adolph C. Miller, 1914 bis 1936 Mitglied des Federal Reserve Boards, im Mai 1936 in The Proceedings of the Academy of Political Science. „Die Welt des 19. Jahrhunderts entwickelte den Goldstandard, dieses außergewöhnliche Symbol der Einheit und der wirtschaftlichen Solidarität.“
Das war eine Zeit, in der sich „automatische Marktkräfte“, so wie sie von den damaligen Ökonomen bezeichnet wurden, gegen Währungsmanagement durchsetzten. Die Einlösbarkeit von Geld in (Fein)gold garantierte in gewisser Weise eine Stabilität der Wechselkurse. Kredite wurden nur soweit ausgeweitet, wie die Kapitalreserven es zuließen, und Zentralbanken waren dazu gezwungen, fixe Goldreserven gegenüber den Banknoten im Umlauf und den Einlagen zu halten.
Als Märkte die Geld-„Politik“ dominierten
Der Zahlungsverkehr in Gold regulierte die internationalen Preisbeziehungen durch Märkte, die sich selbst korrigierten: Preise stiegen, wenn es eine Einfuhr von Gold gab – wenn ein Land beispielsweise eine Schuldenzahlung eines anderen Landes erhielt (immer in Gold) oder in Zeiten wie dem Goldfieber in Kalifornien oder Australien in den 1870ern. Diese Zuflüsse führten zur Ausweitung der Kredite und zum Anstieg der Preise. Ein Goldabfluss bedeutete, dass die Kredite schrumpften und dass eine Preisdeflation folgte.
Die Effizienz dieses Standards wurde in keiner Weise von den wichtigen Zentralbanken behindert, sodass „jede wirtschaftliche oder finanzielle Störung, die irgendwo auf der Welt auftrat, die möglicherweise die Aufrechterhaltung des wirtschaftlichen Gleichgewichts gefährdete, kurzerhand durch das Wechselkurssystem gedeutet werden konnte“, schrieb Miller, das Vorstandsmitglied der Federal Reserve. „So wurde das Goldstandardsystem wirklich zu einem Regime oder zu einem Gesetz wirtschaftlicher Prosperität und einer Methode, wirtschaftliche Störungen noch im Keim zu ersticken.“
Die Bank of England, die Großmeisterin aller Zentralbanken, war der finanzielle Mittelpunkt des Universums. Ihre strenge Verwaltung der Kreditpolitik war so diszipliniert, dass England trotz der Tatsache, dass es nicht einmal die größten Goldreserven hielt, ganz oben stand. Unter dem konsistenten Glauben, dass zu einer Kreditpolitik einzig und allein der Schutz der Reserven gehört, wurde England nicht nur zum führenden Kapital-Exporteur, freien Markt für Gold und internationalem Diskont-Markt, sondern auch zum internationalen Bankier für den Handel, national wie international. In diesem Sinne stand die Welt quasi unter einem Sterling-Standard.
Die Banque de France, die klugerweise von ihrem Gründer, Napoleon, an ihre Pflichten erinnert wurde, um sicherzustellen, dass Frankreich immer ein Kreditgeberland ist, war so übersättigt mit Reserven, dass sie England am Anfang des Ersten Weltkrieges einen Kredit von 500 Millionen Franken (ca. 1,75 Milliarden heutiger Euros) vergab. Die Schweiz, möglicherweise der letzte Schlupfwinkel mit unbegrenzt haftenden Privatbankiers und strengen Schulden-Obergrenzen im „Stil des 19. Jahrhunderts“, verlangte ebenfalls hohe Standards von ihrer 1907 gegründeten Zentralbank. Schon in den 1930er Jahren hatte dieses Land größere Bankreserven als die Vereinigten Staaten; im Gegensatz zu fast jeder Währung eines westlichen Lands, wurde der Schweizer Franken nie explizit abgewertet, und das inländische Preisniveau ist das stabilste in der ganzen Welt.
Eine Zeit lang fand die disziplinierte Haltung dieser Banken ihren Weg über den Atlantik in die Vereinigten Staaten, wo die Idee einer Zentralbank lange im Gespräch stand. Der amerikanische Ökonom H. Parker Willis, der im Oktober 1913 im Journal of the Proceedings of the Academy of Politicial Science schrieb, mahnte: „Die Federal-Reserve-Banken sollen „Zentralbanken“ sein und sie sollen dem Banker das tun, was er selbst für die Öffentlichkeit tut.“
Zuerst fand der Rat Beachtung: Im September 1916, fast zwei Jahre nach ihrer Gründung am 23. Dezember 1913, arbeitete die noch junge Fed an einer Änderung ihrer Goldpolitik auf Basis einer sehr konservativen Ansicht bezüglich Krediten. Diese neue Maßnahme sollte „die übertriebene und unnötige Kreditausweitung“ einschränken, schrieb das Fed-Vorstandsmitglied Miller im Juni 1921 in einem Artikel für das American Economic Review.
Die Bank Rossii überlebte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Krimkrieg, den Russisch-Türkischen Krieg, den Russisch-Japanischen Krieg und nahe bevorstehende Balkankriege – ganz zu schweigen von dem, was noch folgen sollte – und ging gestärkt daraus hervor, mit Hilfe einer vernünftigen Finanzpolitik und massiven Goldreserven. Laut The Economist vom 20. Mai 1899 hielten die Russen 95 Millionen Pfund Sterling Gold während die Banque de France 78 Millionen Pfund Sterling hielt. (Österreich-Ungarn hielt 30 Millionen Sterling in Gold und die Bank of England hielt 30 Millionen Sterling in Gold und Silber). „Rußland arbeitete bis zum Moment der Niederlage im Krieg mit Japan (1904 – 1905) unaufhaltsam an der fortschreitenden Konsolidierung seiner Finanzen“, berichtete Karl Helfferich von der Universität Berlin bei einem Treffen der Royal Economic Society im December im Jahr 1904. „Selbst in Jahren industrieller Krisen und Mißernten wies Rußland einen Exportüberschuss auf, der bei weitem ausreichte, um die Zahlungsströme ins Ausland auszugleichen. Und zur Sicherung des Geldsystems wurde eine immense Goldreserve angehäuft und bewahrt.“
Diese Banken stützten sich reihum auf die mittelalterlichen und barocken Bankingtraditionen der Hansestädte, der Bank von Venedig und den Banken in Amsterdam. Die sofortige Zahlung „in Gütern und schwerem Gold“ war wie ein Blutschwur, der die Beziehung vom Banker zum Kunden festigte. Der Transfer von Kredit „entstand nicht aus irgendeinem Ersatz des Geldes durch Kredit“, merkte Charles F. Dunbar im April von 1892 im Quarterly Journal of Economics an, „sondern aus der einfachen Tatsache, dass der Transfer innerhalb der Bank die Notwendigkeit, bei jeder Transaktion Münzen zu zählen und sie manuell zu liefern, überflüssig machte.“
Bankiers war es untersagt, mit bestimmten Rohstoffen zu handeln und sie konnten weder Darlehen noch Kredit für den Kauf solcher Sachgüter vergeben. Sowohl Ausländern als auch den eigenen Staatsbürgern war es verboten, kreditfinanziert Silber zu kaufen, wenn sich die entsprechende Menge Geld nicht im Bankschließfach befand. Laut Dunbar wurde ein venezianisches Gesetz von 1403 bezüglich Reserveanforderungen Ende der 1800er Jahre zur Grundlage des amerikanischen Bankengesetzes bezüglich der Anlage von öffentlichen Sicherheitspapieren.
Nach dem Untergang des Bimetallismus in den 1870ern wurde Gold weiterhin von den Hauptländern der westlichen Welt (und der gut geführten Bank of Japan) für den Zahlungsverkehr genutzt. Es war das einzige Tauschmittel und das einzige uneingeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel. Es wurde zum viel gerühmten „Wertmaßstab“. Banknoten wurden einfach als Ergänzung zum Gold verwendet und genossen in der Regel nicht das Privileg, ein gesetzliches Zahlungsmittel zu sein.
Das Ende einer Ära
Diese System war sicherlich weder makellos, noch ohne periodische Krisen. Aber Zentralbanken mussten sich aufgrund der allgegenwärtigen öffentlichen Skepsis gegenüber Papiergeld besonders zurückhalten.
Wie es der Ökonom Andrew Jay Frame von der University of Chicago im Januar 1912 im Journal of Political Economy beschreibt: „Während der Panik in Großbritannien in 1847 und 1866, als Bargeldzahlungen aufgehoben waren, wurden die Schleusentore für Bargeld [von der Bank of England] geöffnet. Der Gouverneur verkündete, dass zahlungsfähige Banken unterstützt werden und die Panik war vorüber.“ Frame fügt hinzu: „Wie auch immer, dieses zusätzliche Geld und die erweiterten Kredite, die dazugehörten, fanden schnell ihr Ende, um eine Kreditexpansion zu vermeiden.“
Die Vereinigten Staaten waren ebenfalls von ihrer zurückhaltenden Attitüde überzeugt. Adolph Miller schrieb über die Maßnahmen der Federal Reserve: „Die drei Hauptelemente der Politik einer Zentralbank oder eines Systems von Reserveinstitutionen werden am klarsten offengelegt, in der Haltung gegenüber 1) Gold 2) der Währung 3) Kredit.“ Er fügte stolz hinzu: „Das Federal-Reserve-System hat [diese] Tests mit bemerkenswertem Erfolg bestanden.“
Aber nach dem Ersten Weltkrieg änderte sich die internationale Landschaft. England war nicht mehr länger das Zentrum des internationalen Finanzwesens; die Haupt-Kreditgeberländer der Nachkriegszeit waren die Vereinigten Staaten und Frankreich. Der Mechanismus des Goldstandards existierte nicht mehr. Nur die Vereinigten Staaten hatten einen vollen Goldstandard. England und Frankreich hatten einen Barrengold-Standard und andere Länder (hauptsächlich Deutschland) hatten einen Gold-Devisen-Standard.
Eine Matrix unausgeglichener Handelsbeziehungen durchtränkte die internationale Wirtschaft. Spekulative Booms in zahlreichen Ländern führten dazu, dass die Vereinigten Staaten ihre eigenen Kreditrichtlinien manipulierten, um Kredit- und Wechselkurskontrollen zu reduzieren. Dieses Vorhaben endete 1931 mit einer internationalen Finanzkrise. Bretton Woods (1944) sorgte für ein faktisches Ende des Goldstandards: Die innerstaatliche Einlösbarkeit in Gold wurde illegal und die Rolle des Goldes wurde zugunsten des Dollars stark eingeschränkt.
„Zumindest aus theoretischer Sicht war es in den alten Zeiten einfacher“, schrieb ein wehmütiger W. Randolph Burgess, Leiter der New York Federal Reserve, im Jahr 1938. „In der jetzigen seltsamen neuen Welt, in der das alte Gold seine Bedeutung verloren hat, wo ist der Pfeiler, nach dem sich der Zentralbanker richten kann? Was ist mit Gold gleichgestellt?“
Die Männer seiner Ära und des späten 19. Jahrhunderts verstanden die Bedeutung einer solchen Frage und, noch wichtiger, warum sie gestellt werden muss. Aber ihre Welt war in der Tat eine andere – eine Welt ohne „Quantitative Easing“, „Nullzinspolitik“ oder „Unknown Knowns“ in der Finanzpolitik. Und Helikopter gab es auch nicht.
*****
Aus dem Englischen übersetzt von Vincent Steinberg. Der Originalbeitrag mit dem Titel A Portrait of the Classical Gold Standard ist am 6.4.2015 auf der website des Mises-Institute, Auburn, US Alabama erschienen.
Foto-Startseite: © Steve Dean – Fotolia.com
————————————————————————————————————————————————————————
Marcia Christoff-Kurapovna schrieb für The Wall Street Journal Europe, The Economist und The Christian Science Monitor.