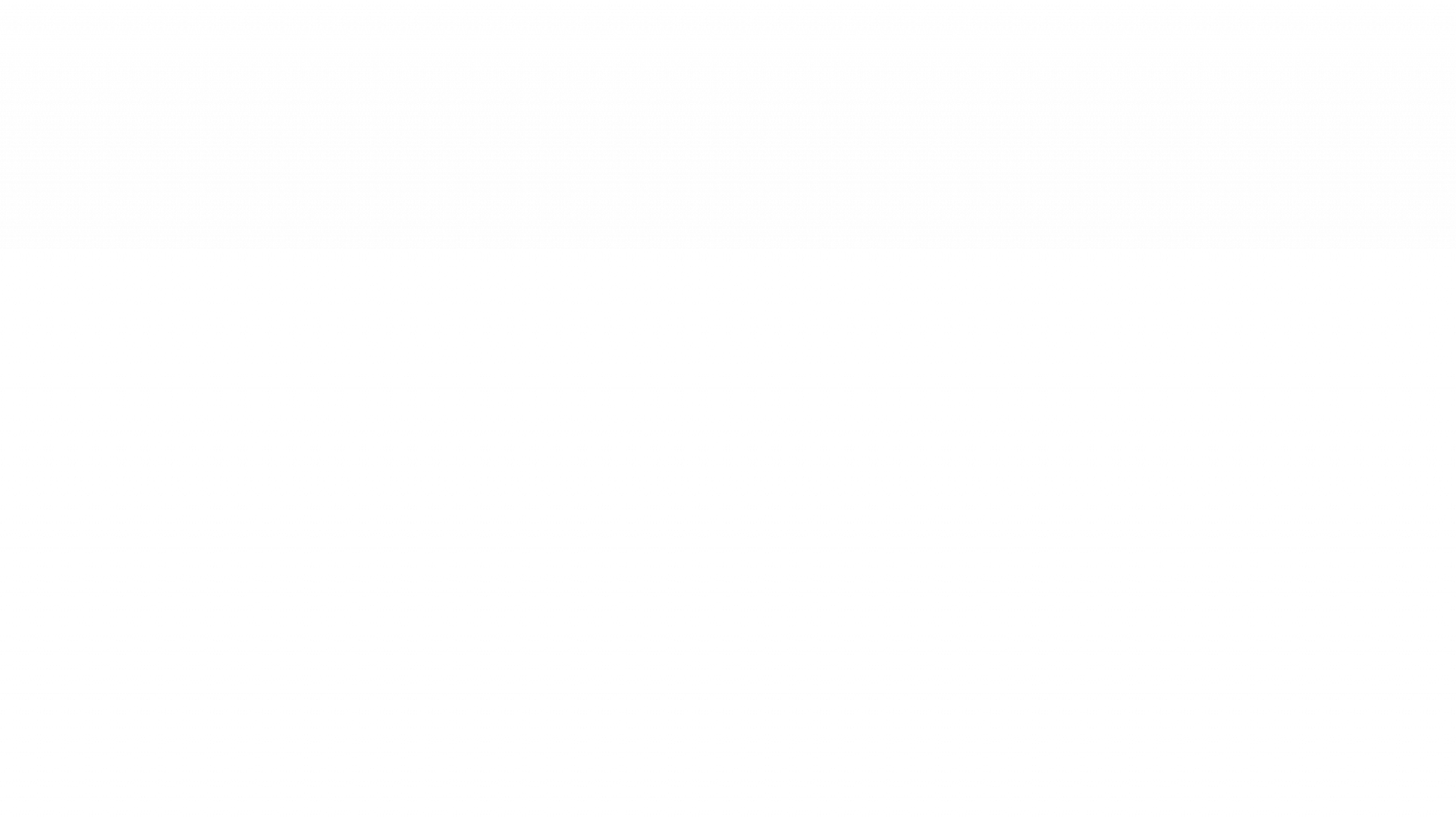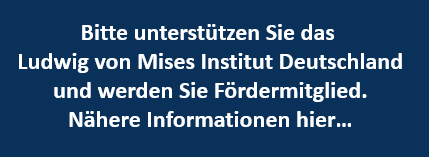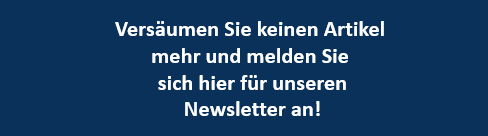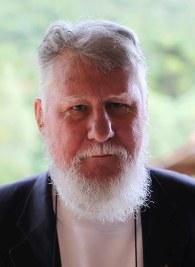Ideologie und Herrschaft | Praxeologie V
14. November 2025 – von Antony P. Mueller
[HIER KLICKEN, um den Beitrag als PODCAST-Folge anzuören.]
Dies ist der fünfte und letzte Teil über die Praxeologie, wie sie Ludwig von Mises in seinem grundlegenden Werk „Nationalökonomie. Theorie des Handelns und Wirtschaftens“ 1940 ursprünglich in deutscher Sprache präsentiert hat. Den ersten Teil finden Sie HIER, den zweiten HIER, den dritten HIER und den vierten HIER.
Das menschliche Handeln beruht auf Vernunft, aber es wäre falsch, daraus eine Vollkommenheit abzuleiten. Das menschliche Denken ist nicht perfekt und deshalb ist auch das menschliche Handeln fehlerhaft. Handeln setzt Einsicht in die Kausalität voraus und ist auf die Zukunft gerichtet. Eine absolut sichere und vollständige Kenntnis aller Ursache-Wirkung-Beziehungen ist unmöglich. Da es auf die Zukunft ausgerichtet ist, bleibt menschliches Handeln notwendigerweise spekulativ. Irrtum ist Teil des Denkens und des Handelns. Aber auch wenn der Mensch von falschen Ideen und Irrtümern geleitet wird, bleibt das Handeln im praxeologischen Sinn vernunftgeleitet.
Der Mensch strebt nach Vergesellschaftung, weil es seinen eigenen Interessen dient. Dabei muss den vielen Einzelnen, die zusammenwirken und Güter tauschen, nicht bewusst sein, dass sie dabei ein gesellschaftliches Gebilde hervorbringen. Der menschliche Antrieb ist nicht auf die Gesellschaft als Zweck gerichtet, sondern diese entsteht als Folge des menschlichen Handelns, das auf den eigenen Nutzen ausgerichtet ist. Die gesellschaftliche Zusammenarbeit wird bevorzugt, weil der Einzelne die Alternative – Krieg aller gegen alle und vollständige Isolierung – als schädlich betrachtet im Unterschied zu den Vorteilen, welche die Arbeitsteilung und ihr Gegenstück, die Arbeitsvereinigung, erbringt. Dass die Gesellschaft als Ergebnis individueller Handlungen bejaht wird, findet seinen Grund in der Vernunfteinsicht, dass sie dem Einzelnen nutzt.
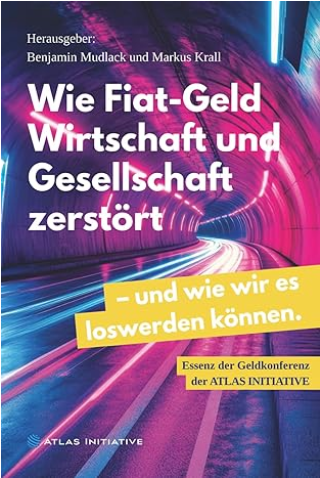
S. 99: „Warum die Welt ein neues Geldsystem braucht und wie es aussehen könnte“, Antony P. Mueller – (*) Partner-Link
[(*) Mit * gekennzeichnete Links sind Partner-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, unterstützen Sie das Ludwig von Mises Institut Deutschland, das mit einer Provision beteiligt wird. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten.]
Mit der Intensivierung der Arbeitsteilung wächst die Bedeutung der Gesellschaft und schließlich des Staates. In einer Gesellschaft gibt es nicht nur Zusammenarbeit, sondern auch „Zusammendenken“. Da alles menschliche Handeln mit dem menschlichen Denken verbunden ist, entstehen Gesellschafts- und Staatstheorien. Mit der Emergenz von Gesellschaft entstehen aus dem individuellen menschlichen Handeln heraus auch gesellschaftliche Ideologien und Ideengebäude, die ihrerseits das menschliche Handeln leiten.
Die Gesellschaft ist das Erzeugnis menschlichen Handelns. Menschliches Handeln wird von den Ideologien bestimmt. Mithin ist Gesellschaft ein Produkt der Ideologie, und nicht die Ideologie ein Produkt der Gesellschaft. (S. 166)
Indem das menschliche Handeln in der Gesellschaft von Ideen bestimmt wird, kann sie auch als Machtinstrument missbraucht werden. Gerade der Gewaltherrscher bedarf der Ideologie, um seine Untertanen gefügig zu machen. Auch der Tyrann muss sich auf das freiwillige Mitwirken von Menschen stützen können. Kein Einzelner kann auf sich allein gestellt politische Macht ausüben. Ein Gewaltherrscher kann sich nur an der Macht halten, wenn er über eine Gefolgschaft verfügt, die ihm freiwillig folgt.
Alle Herrschaft, die Dauer haben soll, muss daher ideologisch fundiert sein. Das «reale» Element, die «realen Mächte», die Herrschaft begründen und zur Ausübung von Gewalt gegenüber widerstrebenden Schwächeren befähigen, sind in letzter Linie stets geistiger Natur. (S. 168)
Als Untergebener neigt der Einzelne dazu, in der Herrschaft vor allem den Gewaltaspekt zu sehen. Er muss sich fügen, weil sonst Bestrafung droht. Aber diese Folgsamkeit verkennt, dass die Möglichkeit einer Bestrafung durch die Herrschaft ideologisch fundiert sein muss. Die untergeordneten Gefolgsleute des Systems werden zum gefügigen Werkzeug in der Hand des Befehlshabers, weil sie das Wirken der Herrschaftsmacht unterstützen oder als gegeben hinnehmen. Sie folgen, weil sie vom selben Geist erfüllt sind, der die Herrschaft erst ermöglicht. Je umfassender die Ideologie ausgeprägt ist, desto selbstverständlicher folgt der Untertan, weil er sich einen anderen Zustand jenseits der Folgsamkeit gar nicht vorstellen kann. Die Vorherrschaft einer Ideologie äußert sich darin am Schärfsten, dass sie als selbstverständlich und fraglos von den Untergebenen hingenommen wird.
Dieser Sichtweise des „Unterführers“ steht die des „Oberführers“ entgegen. Der Oberführer muss stets darauf bedacht sein, den „guten Geist“, die „Moral“, die „Loyalität“ und die „gute Gesinnung“, seiner Untertanen zu erhalten.
Denn diese geistigen Faktoren sind das einzige «reale » Moment, von dem der Fortbestand seiner Herrschaft abhängt. Sie schwindet, wenn der Geist geschwunden ist, der sie trägt. (S. 169)
Nur der Geist einer Herrschaft, ihre Ideologie, gibt der Herrschaftsmacht ihren Bestand. Das gilt auch für kriegerische Eroberungen, wenn die neue Herrschaft dauerhaft sein soll. Aber auch wenn die Gewaltherrschaft hingenommen wird und ihre Ideologie in der Breite der Gesellschaft geteilt wird, bleibt sie unrechtmäßig und steht im Gegensatz zur freiwilligen Tauschgesellschaft.
In seinem „Kompass zum lebendigen Leben“ (*) (2021, S. 201) erklärt Andreas Tiedtke diesen Sachverhalt folgendermaßen:
Selbst wenn man beiseitelässt, dass Herrschaft zwar erscheint, »als ob« sie von den Täuschenden und Drohenden (= Möchtegern-Herrschern) bewirkt wird, in Wirklichkeit aber die Einstellungen und Überzeugungen der Getäuschten und Bedrohten erst ermöglichen, was wir gewöhnlich Herrschaft nennen, so könnte es erst recht keine rechtmäßige Herrschaft geben: Denn das Täuschen, Bedrohen oder Zwingen eines anderen ohne dessen Einvernehmen ist von vornherein feindlich, dem anderen also unrecht und daher Unrecht. Es gibt keine andere Perspektive als diejenige der Einzelnen, wonach Recht und Unrecht beurteilt werden könnte.
[(*) Mit * gekennzeichnete Links sind Partner-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, unterstützen Sie das Ludwig von Mises Institut Deutschland, das mit einer Provision beteiligt wird. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten.]
Der Liberalismus ist der Gewaltherrschaft entgegengesetzt, muss aber auch ideologisch fundiert sein, um wirksam zu werden. Die liberale Ideologie, so Ludwig von Mises, besagt, dass aus der aus der Freiheit entspringenden friedlichen Kooperation der Menschen der Wohlstand entspringt.
Die Ziele, die sich die Menschen setzen und die sie durch die gesellschaftliche Kooperation zu erreichen suchen, können nur erreicht werden, wenn der gesellschaftliche Fortschritt — die Ausgestaltung der Arbeitsteilung und Arbeitsvereinigung — nicht durch Kriege und Bürgerkriege immer wieder aufs neue gestört wird. Dauernder Friede kann aber nicht gesichert werden, wenn man die Menschen ob ihres Glaubens und ob ihrer Überzeugungen und Ideologien verfolgt und wenn man ihnen verwehrt, zu denken und ihre Gedanken frei auszusprechen. (S. 174)
Diese Toleranz, die im Liberalismus angelegt ist, bedeutet jedoch nicht, dass alle Ideen und Wertungen der Menschen als gleich richtig anzusehen sind. Dieser Relativismus ist vielmehr aus der Bekämpfung des Liberalismus hervorgegangen und dient dazu, die im Liberalismus angelegte Toleranz zu bekämpfen. Der Subjektivismus der Praxeologie hat mit der relativistischen Einstellung nichts gemein. Zwar sind aus praxeologischer Sicht die Entscheidungen der Menschen über letzte Werte der Kritik entzogen; das heißt aber nicht, dass die aus diesen Werten folgenden Ideen über den Einsatz der Mittel der vernunftmäßigen Prüfung entzogen wäre. Vielmehr besteht der Grundirrtum aller antiliberalen Gesellschaftsideen – sei es des nationalen oder internationalen Sozialismus – in dem Glauben, die Entstehung der gesellschaftlichen Kooperation wäre aus dem Gewaltprinzip heraus zu erklären.
Die Staatslehre kann der Frage nicht ausweichen, wie zwischen Menschen bewusste geregelte Kooperation möglich ist, und sie kann darauf keine andere Antwort finden als die, dass die Menschen, die in einem Verband zusammenleben und zusammenwirken, in der Kooperation das Mittel erblicken, das der Erreichung der Ziele, die sie ihrem Handeln setzen, besser dient als isoliertes Nebeneinander oder feindliches Gegeneinander. (S. 178)
Dabei gilt auch, dass das gesellschaftliche Zusammenwirken von Menschen in Arbeitsteilung und Arbeitsvereinigung nicht bloß in der Organisationsform der Tauschgesellschaft denkbar ist. Es gibt auch die herrschaftliche Organisation gesellschaftlicher Arbeit.
In der herrschaftlichen Organisation der arbeitsteilenden Gesellschaft stehen nicht Wirte einander gegenüber, die geben, um zu empfangen, und empfangen, weil sie geben, sondern der Leiter und die Versorgten. Der Leiter allein handelt, wählt und entscheidet. Die Versorgten handeln nicht, sie gehorchen. Wenn sie arbeiten, arbeiten sie, weil ihnen Arbeit aufgetragen wurde. Wenn sie geben, geben sie, weil es ihnen befohlen wurde. Wenn sie empfangen, empfangen sie, weil der Leiter es so angeordnet hat. (S. 182)
Dieser Gegensatz zwischen der marktwirtschaftlichen Ordnung und der herrschaftlichen Organisation ist das gesellschaftstheoretische Grundthema seit dem 18. Jahrhundert. In den diversen Gesellschaftstheorien seit der Aufklärung erscheint diese Unterscheidung in unterschiedlichen Begriffspaaren, läuft aber stets auf dasselbe hinaus. Ob nun zwischen kriegerischen und friedlichen Nationen unterschieden wird (Adam Ferguson, 1723 – 1816, und Henri de Saint-Simon, 1760 – 1825), zwischen Militarismus und Industrialismus (Herbert Spencer, 1820 – 1903), zwischen Helden und Händlern (Werner Sombart, 1863 – 1941) oder wie bei den marxistischen Sozialisten zwischen proletarisch-sozialistischer und bürgerlich-kapitalistischer Warenproduktion, stets geht es darum, wie die Arbeitsteilung geordnet bzw. organisiert sein soll. Über die Unterschiede in der Bewertung dieser Gegensätze herrscht dabei die Übereinstimmung, dass eine dritte Möglichkeit der gesellschaftlichen Ordnung und menschlichen Kooperation nicht möglich ist. Die Wahl zwischen dem herrschaftlichen und dem tauschgesellschaftlichen Verband ist immer virulent. Auch heute ist das so.
Im herrschaftlichen Verband ist dem Handeln des Einzelnen kein anderer Spielraum offen als die Wahl zwischen Gehorsam und Auflehnung; hier gibt es kein Recht, nur eine Dienstordnung. Der Leiter erlässt die Befehle, denen der Versorgte gehorcht. Dieser hat kein Recht und keine Freiheit, es sei denn, man wolle in ressentimentvoller Verkehrung des üblichen Sprachgebrauches sagen, dass er das Recht und die Freiheit habe, den Befehlen zu gehorchen. (S. 185)
Auf der anderen Seite steht der tauschgesellschaftliche Verband:
In der Tauschgesellschaft wird das gesellschaftliche Zusammenwirken der handelnden Menschen zum Tausch zwischen Menschen, zu einem Geben an Menschen und zu einem Empfangen von Menschen. Man gibt, um zu empfangen; man leistet anderen, damit sie ihrerseits wieder eine Gegenleistung vollbringen. Diesen Tausch zwischen Menschen wollen wir den zwischenmenschlichen (interpersonellen oder gesellschaftlichen) Tausch nennen. (S. 180)
Die Sozialisten haben Unrecht, wenn sie glauben, dass die historische Entwicklung ihre Krönung im Sozialismus findet. Es gibt keine historische Zwangsläufigkeit. Aber auch die Liberalen irren, wenn sie meinen, der freiheitliche Kapitalismus würde sich wegen seiner Überlegenheit, Freiheit, Frieden und Wohlstand zu schaffen, geschichtsautomatisch durchsetzen.
Auch Mehrheiten können irregehen und die Menschheit ins Verderben stürzen. Das Vernünftige muss nicht schon darum siegen, weil es vernünftig ist. Nur wenn die Menschen so geartet sind, dass die Vernunft schließlich doch die Oberhand gewinnt, wird unsere Kultur weiter fortschreiten, werden Gesellschaft und Staat die Menschen zwar nicht glücklich, doch glücklicher machen. Ob diese Bedingung zutrifft, wird die Zukunft lehren. (S. 180)
Wenn es keinen aus der Historie hervortretenden Determinismus hin zum einen (Tauschgesellschaft) oder zum anderen (Herrschaftsverband) gibt, hängt es von der Entscheidung jedes Einzelnen ab, welcher Weg in der jeweiligen Gesellschaft beschritten wird.
Jeder Einzelne ist deshalb aufgefordert, sich zu entscheiden: Auf der einen Seite das Prinzip des herrschaftlichen Verbandes, also Befehl und Unterordnung, in welchem über Produktion und Verbrauch zentral entschieden wird und in dem der Vollzug der Entscheidungen gewaltsam durchgesetzt wird; oder die freiwillige Tauschgesellschaft, die mit Freiheit, Frieden und Wohlstand einhergeht. „Tertium non datur“, ein Drittes gibt es nicht.
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Instituts Deutschland wieder.
Ebenfalls zur „Nationalökonomie“ von Antony P. Mueller kürzlich erschienen: „Was ist Praxeologie?“, „Grundkategorien der Praxeologie“ und „Das handelnde Individuum und die Gesellschaft. Praxeologie“, „Das Gesetz der Assoziation. Praxeologie IV“
Antony Peter Mueller ist promovierter und habilitierter Wirtschaftswissenschaftler der Universität Erlangen-Nürnberg, wo er von 1994 bis 1998 das Institut für Staats- und Versicherungswissenschaft in Erlangen leitete. Antony Mueller war Fulbright Scholar und Associate Professor in den USA und kam im Rahmen des DAAD-Austauschprogramms als Gastprofessor nach Brasilien.
Bis 2023 war Dr. Mueller Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Makroökonomie und Internationale Wirtschaftsbeziehungen, an der brasilianischen Bundesuniversität UFS. Nach seiner Pensionierung ist Dr. Mueller weiterhin als Dozent an der Mises Academy in São Paulo tätig und als Mitarbeiter beim globalen Netzwerk der Misesinstitute aktiv. Darüber hinaus ist er wissenschaftlicher Beirat der Partei „Die Libertären“.
In deutscher Sprache erschien 2024 sein Buch „Antipolitik“ (*), 2023 erschien „Technokratischer Totalitarismus. Anmerkungen zur Herrschaft der Feinde von Freiheit und Wohlstand“(*). 2021 veröffentlichte Antony P. Mueller das Buch „Kapitalismus, Sozialismus und Anarchie. Chancen einer Gesellschaftsordnung jenseits von Staat und Politik“(*). 2018 erschien sein Buch „Kapitalismus ohne Wenn und Aber. Wohlstand für alle durch radikale Marktwirtschaft“(*).
[(*) Mit * gekennzeichnete Links sind Partner-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, unterstützen Sie das Ludwig von Mises Institut Deutschland, das mit einer Provision beteiligt wird. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten.]
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Das Ludwig von Mises Institut Deutschland e.V. setzt sich seit Jahren für die Verbreitung der Lehre der Österreichischen Schule der Nationalökonomie ein. Freiheit gibt es nicht geschenkt, sie muss stets neu errungen und erhalten werden. Bitte unterstützen Sie daher das Ludwig von Mises Institut Deutschland mit einer Spende, damit wir uns weiterhin für unser aller Freiheit einsetzen können!
Spendenkonto:
Ludwig von Mises Institut Deutschland e. V.
IBAN: DE68 7003 0400 0000 1061 78
BIC: MEFIDEMM
Merck Finck A Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch
Verwendungszweck: Spende
Titel-Foto: Adobe Stock – bearbeitet