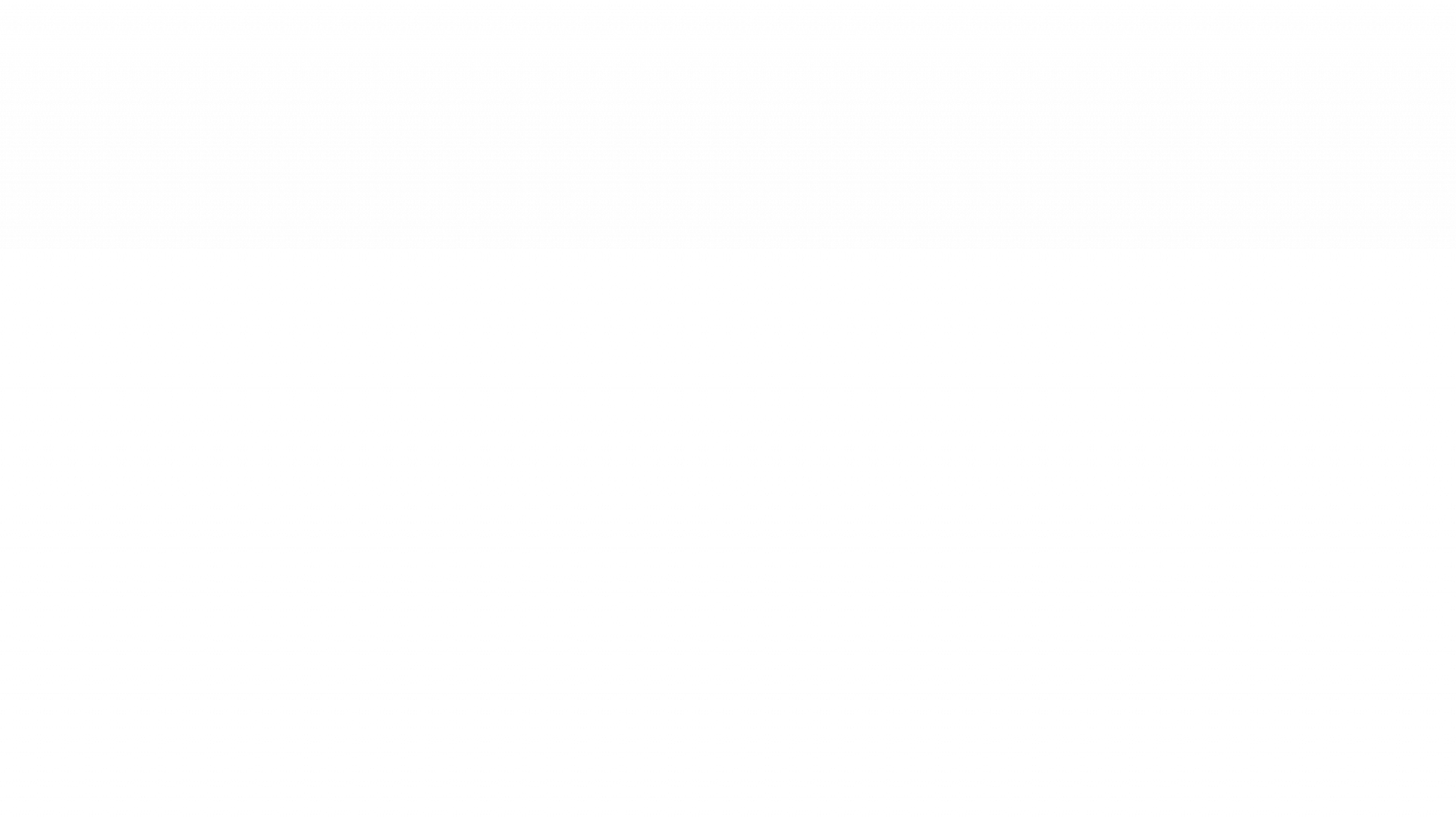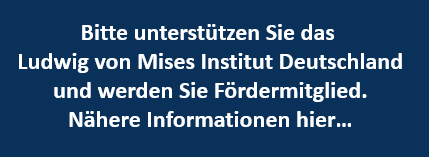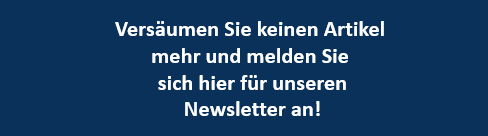Staatskultur: Wie der Staat unsere Werte kolonisiert
18. Juli 2025 – von Philipp Bagus
[HIER KLICKEN, um den Beitrag als PODCAST-Folge anzuhören.]
In westlichen Gesellschaften beobachten wir eine paradoxe Entwicklung: Formell bestehen Eigentumsrechte und politische Freiheiten weiter fort, doch kulturell befinden wir uns im Würgegriff eines neuen Totalitarismus. Nicht mit Stiefeln, sondern auf Samtpfoten schleicht sich der Einfluss des Staates in unser Denken, Fühlen und Handeln. Der Begriff der „Staatskultur“ beschreibt diesen schleichenden Prozess einer staatlich geformten Weltanschauung, die tief in unser Alltagsleben eingreift – ganz ohne offene Gewalt.
*****
Jetzt anmelden zur
Ludwig von Mises Institut Deutschland Konferenz 2025
*****
Die Kultur einer Gesellschaft entsteht nicht im luftleeren Raum. Sie ist das Ergebnis von Normen, Konventionen, Sprache, Medien, Bildung, Erziehung und Geschichten, durch die Menschen die Welt deuten. Was aber, wenn diese kulturellen Elemente nicht spontan und freiwillig entstanden sind, sondern systematisch von staatlichen Institutionen geformt wurden?
Der Staat hat ein vitales Interesse daran, seine Existenz moralisch zu rechtfertigen. Dazu nutzt er vor allem zwei Instrumente: das Bildungssystem und die Medien.
Der moderne Trend zu staatlicher Allgewalt und Totalitarismus wäre im Keime erstickt worden, wenn seine Vertreter es nicht geschafft hätten, die Jugend zu indoktrinieren und zu verhindern, dass diese mit den Lehren der Nationalökonomie vertraut wird. (Ludwig von Mises, Die Bürokratie 1944, S. 89)
Schulen vermitteln staatsnahe Ideologien, während viele Medien durch Subventionen, Zugangsvorteile oder regulatorischen Druck in staatsfreundlicher Weise berichten. Durch diese langfristige Einflussnahme entsteht eine kulturelle Hegemonie, in der staatliche Narrative als moralisch überlegen gelten.
Der Wokeismus ist ein Paradebeispiel dieser neuen Staatskultur: Unter dem Deckmantel der Toleranz werden kritische Stimmen mundtot gemacht. Begriffe wie „Hassrede“, „Diskriminierung“ oder „Fake News“ werden oft so vage definiert, dass sie zur Waffe gegen jede Abweichung von der offiziellen Linie werden können. Was als gesellschaftliche Sensibilität erscheint, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als ideologischer Konformitätsdruck – gefördert, finanziert und verteidigt vom Staat.
Die Cancel Culture ist ein Resultat dieser Entwicklung. Unternehmen, Universitäten und Medien – formal privat – agieren zunehmend im vorauseilenden Gehorsam. Sie führen eine privatisierte Zensur durch, die faktisch staatlich induziert ist. Der libertäre Reflex, dies als Ausdruck von Eigentumsrechten zu verteidigen, greift zu kurz. Denn diese Handlungen geschehen nicht in einem freien Markt, sondern in einem staatlich verzerrten kulturellen Umfeld.
[(*) Mit * gekennzeichnete Links sind Partner-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, unterstützen Sie das Ludwig von Mises Institut Deutschland, das mit einer Provision beteiligt wird. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten.]
Was tun? Libertäre müssen anerkennen, dass Kulturpolitik kein exklusives Terrain der Linken bleiben darf. Der Staat ist nie neutral. Schon seine bloße Existenz beeinflusst die Kultur. Daraus folgt: Solange der Staat besteht, sollten libertäre Kräfte jene Kultur unterstützen, die sich auch in einer freien Gesellschaft durchgesetzt hätte. Werte wie Eigentum, Eigenverantwortung, Familie, Nächstenliebe und Wahrheit verdienen Förderung – auch innerhalb staatlicher Institutionen, solange diese bestehen.
Wir leben in einer hybriden Gesellschaft. Umso wichtiger ist es, die kulturellen Voraussetzungen für eine freie Ordnung zu schaffen. Denn ohne freiheitliche Kultur ist eine freie Gesellschaft nicht dauerhaft möglich.
Der Konflikt zwischen Kapitalismus und Totalitarismus, von dessen Ausgang das Schicksal der Zivilisation abhängt, wird nicht durch Bürgerkriege und Revolutionen entschieden werden. Er ist ein Krieg der Ideen. Die öffentliche Meinung wird über Sieg und Niederlage bestimmen. (Ludwig von Mises, Die Bürokratie, S. 120 f.)
Der Kampf um die Kultur ist deshalb kein Nebenschauplatz – er ist das Zentrum der Auseinandersetzung um unsere Freiheit. Javier Milei hat gezeigt, dass dieser Kampf auch mit libertären Ideen gewonnen werden kann. Das gibt Hoffnung.
Philipp Bagus ist Professor für Volkswirtschaft an der Universidad Rey Juan Carlos in Madrid. Zu seinen Forschungsschwerpunkten Geld- und Konjunkturtheorie veröffentlichte er in internationalen Fachzeitschriften wie Journal of Business Ethics, Independent Rewiew, American Journal of Economics and Sociology u.a. Sein Buch „Die Tragödie des Euro“ (*) erscheint in 14 Sprachen. Philipp Bagus ist ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirates des Ludwig von Mises Institut Deutschland. Im September 2024 erschien sein Buch „Die Ära Milei“ (*).
[(*) Mit * gekennzeichnete Links sind Partner-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, unterstützen Sie das Ludwig von Mises Institut Deutschland, das mit einer Provision beteiligt wird. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten.]
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Instituts Deutschland wieder.
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Das Ludwig von Mises Institut Deutschland e.V. setzt sich seit Jahren für die Verbreitung der Lehre der Österreichischen Schule der Nationalökonomie ein. Freiheit gibt es nicht geschenkt, sie muss stets neu errungen und erhalten werden. Bitte unterstützen Sie daher das Ludwig von Mises Institut Deutschland mit einer Spende, damit wir uns weiterhin für unser aller Freiheit einsetzen können!
Spendenkonto:
Ludwig von Mises Institut Deutschland e. V.
IBAN: DE68 7003 0400 0000 1061 78
BIC: MEFIDEMM
Merck Finck A Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch
Verwendungszweck: Spende
Titelfoto: Adobe Stock Fotos (bearbeitet)