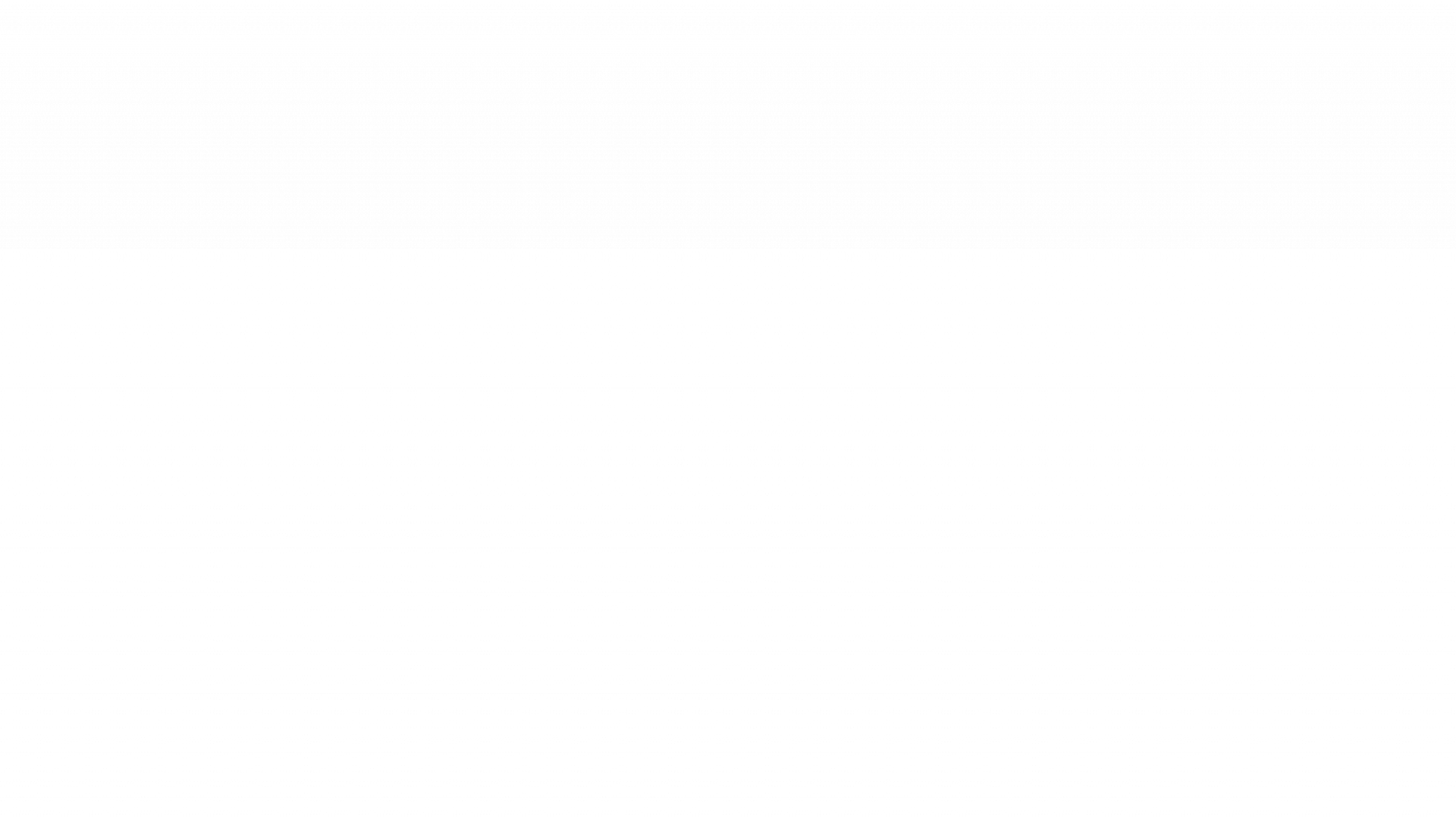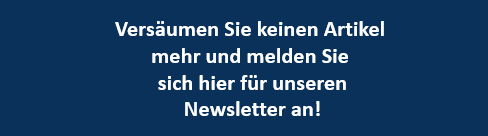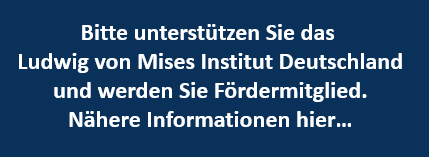Das Recht und seine Verfälschung
26. August 2022 – von David Dürr
Besprechung des Buches „Das Recht und seine Verfälschung“ von Dietrich Eckardt, hrsg. vom Aktionskreis Menschenrecht und Freiheit, Berlin 2022.
Dietrich Eckardt lässt sich nichts vormachen, er gibt erst Ruhe, wenn die Sache geklärt ist. Von eleganten Ideologien hält er nichts, dafür umso mehr von verifizierbaren Fakten. Seine Berufstätigkeit begann er nicht im Elfenbeinturm der Akademie, sondern als Monteur im Industriebau. Die theoretische Reflexion liegt ihm aber trotzdem, wie seine spätere Promotion zum Dr. phil. zeigt.
Wenn dieser Realist und Dr. phil. das Thema Recht behandelt, ist also nicht mit leichter Kost zu rechnen, nicht mit brillant hingeworfenen Oberflächlichkeiten, sondern mit nüchterner, konzentrierter und präzis strukturierter Facharbeit. Zur gleichsam protokollarischen Nüchternheit des Textes passt seine Einordnung in die Schriftenreihe des Autors namens „Protokolle der Aufklärung“, deren dritten Band das Buch bildet. Dietrich Eckardt möchte das Phänomen Recht verstehen, strukturiert seine Gedanken, schreibt diese nieder und lässt uns daran teilhaben.
… er schaut über dieses „Recht“ hinaus und kommt denn auch zum Schluss, dass die bei uns realgelebte Rechtsordnung das wahre Recht nicht wiedergibt, sondern im Gegenteil verfälscht.
Dass er nicht Jurist ist, bewahrt ihn vor dem, was einen Grossteil juristischer Fachliteratur so nutzlos macht, nämlich vor juristischer Betriebsblindheit. Für sie ist Recht einfach das, was wir unter diesem Begriff in unserer real gelebten Staatsordnung vorfinden, das heisst die staatliche Gesetzgebung sowie das staatliche Gerichts- und Justizsystem. Für Eckart wäre ein solcher Blick zu eng; er schaut über dieses „Recht“ hinaus und kommt denn auch zum Schluss, dass die bei uns realgelebte Rechtsordnung das wahre Recht nicht wiedergibt, sondern im Gegenteil verfälscht.
*****
Jetzt anmelden zur
Ludwig von Mises Institut Deutschland Konferenz 2022
*****
Die Gedankenführung des Buches geht von ihrem Anlass aus, das heisst vom Ich des Autors, das in Beziehung steht zu anderen Akteuren der Gesellschaft und deren eigenen jeweiligen Ich-Beziehungen (Teil A). Daraus bildet sich ein Beziehungsgeflecht einerseits aus Ich-Fixpunkten beziehungsweise Eigentum und anderseits Handlungsnormen für deren Gegenseitigkeit, die sich wiederum in positive Gebote und negative Verbote unterscheiden lassen. Was der nüchterne Forscher und Denker dabei vorfindet, ist nichts anderes als das, was die Rechtsgeschichte an bewährten Privatrechtsregeln vorzuweisen hat; nicht als rechtstheoretische Dogmen, sondern sozusagen als normative Realien (Teil B.1 bis B.4). So weit, so gut, vor allem auch für den Rezensenten, der als staatskritischer Rechtswissenschaftler ohnehin nur natürlich gewachsene Verhaltensgesetzmässigkeiten für wahres Recht hält.
Doch leider, so der Autor überzeugend, wird dieses natürliche Recht vielfach und grundlegend durchkreuzt durch das, was der Staat an sogenanntem „Recht“ in die Welt setzt. Als eine kritische Schnittstelle lokalisiert der Autor nebst anderen Unzulänglichkeiten die oft unsystematische Durchlässigkeit zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht, wodurch jene bewährten und natürlich gewachsenen Verhaltensgesetzmässigkeiten immer mehr durch aufgezwungene Staatsziele verdrängt werden. Damit verkommt Gerechtigkeit von einer ursprünglich austarierten Ausgewogenheit zu einer autonomen Urteilsinstanz mit entsprechendem Missbrauchspotenzial (Teil B.5 und 6).
Diese Verfälschung sieht der Autor in zahlreichen, für den etatistischen Mainstream scheinbar problemlosen Übergriffen verwirklicht, beispielsweise in der „Gesetzgebung“ genannten Befehlsgewalt …
Diese Verfälschung sieht der Autor in zahlreichen, für den etatistischen Mainstream scheinbar problemlosen Übergriffen verwirklicht, beispielsweise in der „Gesetzgebung“ genannten Befehlsgewalt des Staates, in „sozial“ begründeten, aber letztlich illegitimen Abgabepflichten und nicht zuletzt im Umstand, dass staatliche Richter auch dann zuständig sind, wenn es um Streitigkeiten mit dem Staat geht (Teil B.7).
Zusammenfassend hält es Dietrich Eckardt für möglich (und wünschenswert) das Ordnungsgefüge von Recht mit individueller Freiheit zu kombinieren; und dies ohne Rekurs auf eine letztlich ultimativ zuständige Monopolinstanz, wie sie derzeit noch der Staat ist (Teil C).
… [der Leser wird] belohnt …, wenn er schon immer das Gefühl hatte, mit diesem merkwürdigen Gespann von Recht und Staat stimme etwas nicht so ganz.
Der nüchterne, bisweilen fast technisch geschriebene Text verlangt vom Leser einiges an Stehvermögen ab. Doch wenn er durchhält, wird er belohnt; jedenfalls dann, wenn er schon immer das Gefühl hatte, mit diesem merkwürdigen Gespann von Recht und Staat stimme etwas nicht so ganz.
Prof. Dr. iur. David Dürr lehrt Privatrecht und Rechtstheorie an der Universität Zürich und ist Wirtschaftsanwalt und Notar in Basel. Studiert hat er an den Universitäten Basel und Genf sowie an der Harvard Law School. Er publiziert regelmäßig zu den Themen Privatrecht, Rechtstheorie und Methodenlehre. Nebst zahlreichen Sachbüchern und Artikeln veröffentlichte er unter anderem auch die Politsatire „Staats-Oper Schweiz – wenige Stars, viele Staatisten” (2011) sowie eine Auswahl seiner regelmäßigen anarchistischen Kolumnen bei der Basler Zeitung unter dem Titel „Das Wort zum Freitag” (2014). David Dürr ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirates des „Ludwig von Mises Institut Deutschland”.
*****
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Instituts Deutschland wieder.
Titel-Foto: Adobe Stock