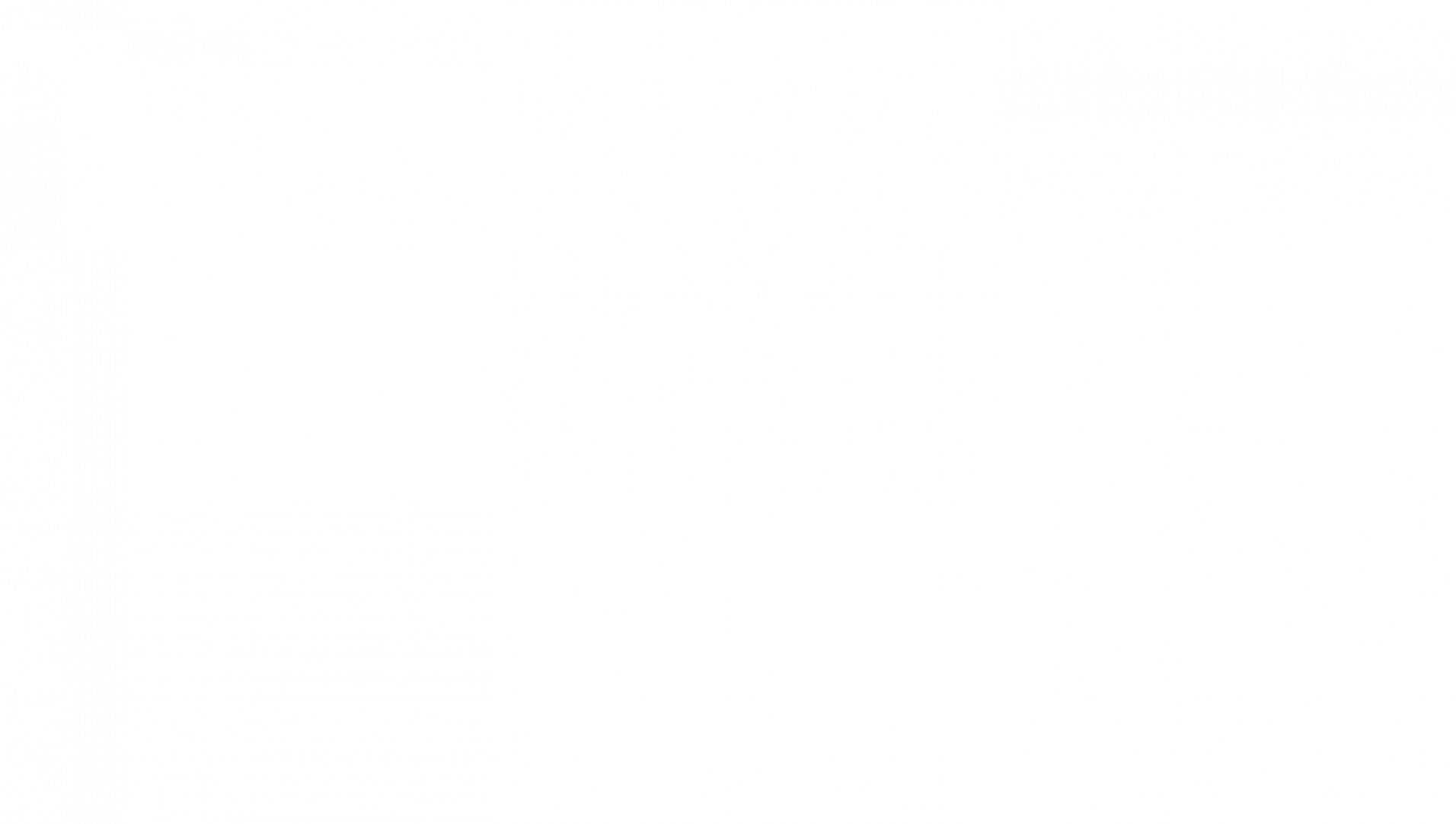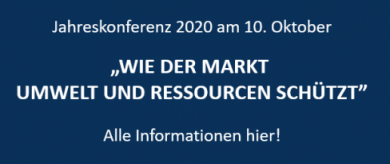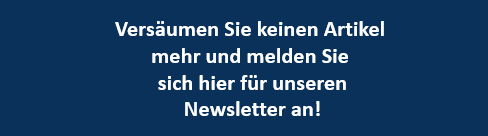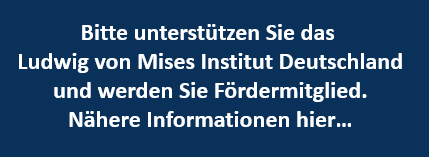Falsche Lehren aus der Großen Depression
18. September 2020 – Die ultraexpansive Geldpolitik der Zentralbanken ist gefährlich. Sie wird oft mit Hinweis auf die Wirtschaftskrise der 1930er Jahre legitimiert. Dabei werden aber die falschen Schlüsse gezogen.
von Olivier Kessler

Olivier Kessler
Aus Fehlern soll man lernen. Es scheint aber, dass gerade bei der verheerendsten wirtschaftlichen Katastrophe des letzten Jahrhunderts – der Grossen Depression – inkorrekte Schlussfolgerungen gezogen wurden. So wird heute bei vielen Ökonomen die Meinung vertreten, die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre wäre durch eine expansivere Geldpolitik zu verhindern gewesen. Mit dem Hinweis auf diese vermeintliche Lehre aus der Jahrhundertkrise wird auch die ultraexpansive Geldpolitik der heutigen Tage legitimiert. Man will eine weitere Katastrophe schliesslich um jeden Preis verhindern.
Doch wer die Zahlen zu den Geldaggregaten aus der Zeit der Grossen Depression unter die Lupe nimmt – wie etwa der Ökonom Murray Rothbard («America’s Great Depression») -, erkennt, dass in den Jahren vor und zu Beginn der Krise entgegen dem vermeintlichen «wissenschaftlichen Konsens» gar keine restriktive, sondern eine expansive Geldpolitik vorherrschte. Während der vorausgehenden Boom- und Übertreibungsphase von 1921 bis 1929, in der erst die Voraussetzungen für die nachfolgende Korrektur geschaffen wurden, ist die Geldmenge in den USA von 45,3 auf 73,3 Milliarden Dollar ausgeweitet worden. Das ist ein Wachstum von durchschnittlich 7,7 Prozent pro Jahr oder 62 Prozent in nur acht Jahren.
Vermögensgütermärkte beachten
Die enorme Inflation blieb – genauso wie heute – deshalb von vielen unbemerkt, weil sie sich nicht in den Konsumgüter-, sondern in den Vermögensgütermärkten abspielte, wo das neue Geld zuerst ankommt. Wie seine heutigen Jünger, so erkannte auch John Maynard Keynes – der Apologet einer expansiven Geldpolitik in Krisenzeiten schlechthin – diese Zusammenhänge nicht. Vielmehr lobte er die Federal Reserve (Fed) ausdrücklich für ihre «gute Preisstabilitätspolitik», obwohl die Aktien- und Immobilienpreise regelrecht explodierten.
Näher an der Realität war Ludwig von Mises mit seiner Konjunkturtheorie, die er in seinem 1912 erschienenen Werk «Theorie des Geldes und der Umlaufmittel» beschrieben hatte. Mises argumentierte, dass eine expansive Geldpolitik die relativen Preise verzerre und damit zu einer Fehlallokation von Ressourcen führe – je stärker die Geldmengenausweitungen, desto gravierender die Verzerrungen. Das dadurch fehlgeleitete Kapital entpuppe sich früher oder später als Fehlinvestition und müsse abgeschrieben werden, was wiederum zu Korrekturen an den Märkten und zu folgenreichen Wirtschaftscrashs führe. Genau dies ist in der Grossen Depression passiert.
Doch anstatt zuzulassen, dass sich das fehlinvestierte Kapital möglichst rasch reallozieren kann und die Bedürfnisse der Menschen so wieder effizient befriedigt werden können, intervenierte die US-Notenbank mit aller Kraft. In der Crash-Woche vom Oktober 1929 fügte die Fed den Nationalbankreserven in einem bis dato historisch beispiellosen Akt weitere 300 Millionen Dollar hinzu. Sie verdoppelte in dieser letzten Oktoberwoche ihr Staatsanleihenportfolio, was dem System weitere 150 Millionen Dollar hinzufügte, und gewährte den Mitgliederbanken zusätzliche 200 Millionen Dollar. Eine solche Geldpolitik als «restriktiv» zu bezeichnen, entbehrt jeglicher Grundlage.
Nicht nur die erste Crash-Woche, sondern auch die ersten Krisenjahre waren von einer expansiven Geldpolitik geprägt, wie die Studie belegt. Rothbard meinte:
Anstatt eine gesunde und rasche Liquidation unsolider Positionen zu ermöglichen, war es das Schicksal der Wirtschaft, weiterhin durch staatliche Massnahmen gestützt zu werden, was ihre Krankheit nur verlängerte.
Rothbard zeigt in seiner Studie, dass erst die deflationären Effekte gegen Ende der Krise – wie etwa die zahlreichen Bankenpleiten – zu einer Besserung der Wirtschaftslage führten. Kurz gesagt: Eine expansive Geldpolitik verursacht und verlängert Wirtschaftskrisen, eine nichtexpansive Geldpolitik hingegen trägt zu einem gesunderen Verlauf der Wirtschaft und zur Heilung von Krisen bei.
Zinsaverse Staaten
In diesem Lichte ist die gegenwärtige ultraexpansive Geldpolitik der Zentralbanken gefährlich; auf eine Kursänderung zu hoffen, wäre wohl aber naiv – zumal es sich bei diesen um politisch eingeführte Institutionen handelt, die im Interesse der hochverschuldeten und deshalb zinsaversen Staaten agieren. Anlass zur Hoffnung geben hingegen der sich intensivierende Geldwettbewerb und die voranschreitende technologische Entwicklung: So trug etwa die Entstehung des Bitcoins oder anderer privater Kryptowährungen dazu bei, dass neue globale und dennoch dezentrale Währungen zur Verfügung stehen, deren Geldmengen begrenzt sind und nicht von einigen wenigen Machthabern manipuliert werden können.
Je mehr sich die Wirtschaft auf bessere Alternativen verlagert, desto weniger ist eine expansive Geldpolitik überhaupt noch möglich und desto weniger anfällig dürfte sie für staatlich induzierte Übertreibungen und Krisen werden.
*****
Dieser Beitrag ist am 26.8.2020 zuerst in der Neuen Zürcher Zeitung erschienen.
Olivier Kessler ist Direktor des Liberalen Instituts in Zürich und Mitherausgeber des Buchs «Explosive Geldpolitik. Wie Zentralbanken wiederkehrende Krisen verursachen».
*****
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Institut Deutschland wieder.
Foto: Adobe Stock