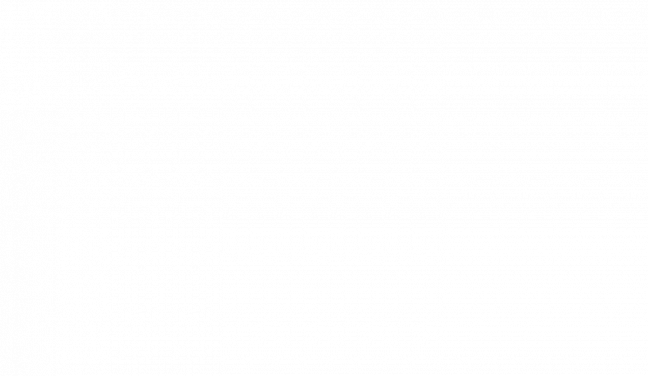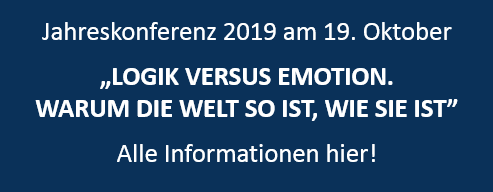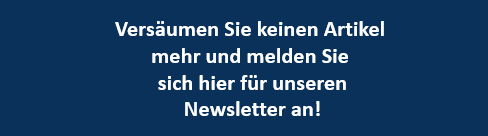Keynes und die Karikatur des Sayschen Gesetzes in der modernen Makroökonomik: Ein verhängnisvoller Strohmann
26. Juni 2019 – von Karl-Friedrich Israel

Karl Friedrich Israel
Jedes Jahr hören unzählige Studenten der Volkswirtschaftslehre im Grundkurs Makroökonomik die Geschichte von John Maynard Keynes und seiner vermeintlichen Widerlegung der klassischen Ökonomik. Keynes habe 1936 in seiner Allgemeinen Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes ein für alle Mal bewiesen, dass das Herzstück der klassischen Ökonomik, das „Saysche Gesetz“, keine allgemeine Gültigkeit besitze.
Dass er sich in seiner Argumentation einer hanebüchenen Karikatur dieses Gesetzes bediente, wird geflissentlich übergangen. Keynes hatte sich lediglich einen Strohmann aufgebaut, der leicht umzuschubsen war. Er wurde dem französischen Klassiker Jean-Baptiste Say, nach dem das Gesetz benannt ist, in keiner Weise gerecht. Leider haben sich nur die wenigsten Ökonomen seit Keynes die Mühe gemacht, einmal genauer nachzuschauen. Kaum einer hat Say im Original gelesen. Man kennt ihn nur als den Strohmann, für den Keynes ihn verkaufte.
Um das Problem nachvollziehen zu können, müssen wir ein wenig ausholen. Im dritten Kapitel der Allgemeinen Theorie führt Keynes das Konzept der wirksamen oder effektiven Nachfrage ein. Sie beschreibt in seinem System den Schnittpunkt einer aggregierten Nachfragefunktion und einer aggregierten Angebotsfunktion. Man hätte dieses Konzept also mit gleicher Berechtigung auch effektives Angebot nennen können. Aber Keynes wollte von Anfang an die Nachfrage in das Zentrum der Analyse rücken.
Aggregiert heißt in diesem Zusammenhang gesamtwirtschaftlich. Die Nachfrage- und Angebotsfunktion beziehen sich also auf den Wert aller in der Volkswirtschaft produzierten Güter und Dienstleistungen zusammen. Im wirtschaftlichen Gleichgewicht, also im Schnittpunkt beider Funktionen, gleicht das aggregierte Angebot der aggregierten Nachfrage. Dieses Gleichgewicht bestimmt nach Keynes das Beschäftigungsniveau. Die zentrale keynesianische Idee ist nun, dass das Beschäftigungsniveau im Gleichgewicht nicht zwingend mit Vollbeschäftigung einhergehe. Es kann also (unfreiwillige) Arbeitslosigkeit im Gleichgewicht geben, wenn die effektive Nachfrage zu gering ist. In einer solchen Situation wären keine Marktkräfte vorhanden, die der Arbeitslosigkeit entgegenwirken. Sie wäre beständig und würde nicht von allein sinken. Man müsse also durch politische Eingriffe die effektive Nachfrage stimulieren.
Keynes bemerkt sehr richtig, dass die klassische Ökonomik eine andere Ansicht vertrat. Ihr zufolge ist eine erhöhte Arbeitslosigkeit immer Ausdruck eines ökonomischen Ungleichgewichts. Daher gäbe es auch immer Marktkräfte, die der Arbeitslosigkeit entgegenwirken. Nach klassischem Verständnis herrsche im Gleichgewicht also Vollbeschäftigung.
Keynes bestreitet die klassische Lehre, die eine fehlerhafte Sicht auf das Verhältnis von aggregierter Nachfrage und aggregiertem Angebot vertrete. Sie seien in der klassischen Theorie, so behauptet Keynes, immer identisch, also im Gleichgewicht, unabhängig vom Beschäftigungsniveau. Es gäbe demnach nicht einen einzigen Punkt, in dem sich die aggregierte Nachfrage und das aggregierte Angebot schneiden, sondern die beiden Funktionen liegen gewissermaßen übereinander. Es sei genau diesem Umstand geschuldet, dass es in der klassischen Theorie immer auch ein Gleichgewicht gäbe, das mit Vollbeschäftigung einherginge. Dieses Gleichgewicht würde durch Lohnanpassungen auf dem Arbeitsmarkt auch immer erreicht werden. Es braucht also keine Politikeingriffe, um Vollbeschäftigung zu erlangen. Laut Keynes stünde in der klassischen Theorie das Gleichgewicht von aggregiertem Angebot und aggregierter Nachfrage – also die effektive Nachfrage – der Vollbeschäftigung in keiner Weise im Wege.
Genau um diese Behauptung zu stützen und damit implizit zu suggerieren, dass die klassische Theorie nicht im Stande wäre das Phänomen der Arbeitslosigkeit zu erklären, kommt die keynesianische Karikatur des Sayschen Gesetzes zum Einsatz. Keynes schrieb: „Seit den Zeiten von Say und Ricardo haben die klassischen Ökonomen gelehrt, daß das Angebot seine eigene Nachfrage schafft.“ (S. 16).[1] Nur ein wenig später setzt er dann zur vollen Kritik an:
Die klassische Doktrin, die kategorisch durch die Behauptung “das Angebot schafft seine eigene Nachfrage” ausgedrückt zu werden pflegte und die aller orthodoxen Wirtschaftstheorie weiterhin zugrunde liegt, schließt aber eine besondere Annahme über das Verhältnis dieser zwei Funktionen ein [der aggregierten Nachfrage und des aggregierten Angebots]. Denn „das Angebot schafft seine eigene Nachfrage” bedeutet, daß f(N) [die aggregierte Nachfrage] und j(N) [das aggregierte Angebot] bei allen Werten von N [dem Beschäftigungsniveau] einander gleich sind, das heißt auf allen Niveaus der Produktion und der Beschäftigung, und daß, wenn Z (=j(N)) der Zunahme von N entsprechend zunimmt, D (=f(N)) um die gleiche Summe wie Z zunehmen muß. Mit andern Worten, die klassische Theorie nimmt an, daß der aggregierte Nachfragewert (oder Erlöß) sich immer dem aggregierten Angebotswert anpaßt, so daß, was immer der Wert von N sein mag, der Erlös D einen Wert annimmt, der gleich ist dem aggregierten Angebotswert Z, der zu N gehört. Das heißt, die effektive Nachfrage wird nicht durch einen einzigen Gleichgewichtswert bestimmt, sondern besteht aus einer unendlichen Reihe von Werten, die alle gleich zulässig sind, und die Menge der Beschäftigung ist unbestimmt, soweit ihr nicht durch die marginale Nutzeneinbuße durch Arbeit eine obere Grenze gesetzt wird.
Wenn das der Fall wäre, würde der Wettbewerb unter den Unternehmen immer zu einer Ausdehnung der Beschäftigung führen bis zu dem Punkt, an dem das Angebot der Produktion als Ganzes aufhört, elastisch zu sein, das heißt, wenn eine weitere Zunahme des Wertes der effektiven Nachfrage nicht mehr von einer Zunahme der Produktion begleitet sein wird. Das ist offenbar dasselbe wie Vollbeschäftigung. […] Das Gesetz von Say, nach dem der aggregierte Nachfragewert der Produktion als Ganzes dem aggregierten Angebotswert aller Produktionsmengen gleich ist, ist somit das Äquivalent der Behauptung, daß einer Vollbeschäftigung kein Hindernis im Wege steht.
Laut Keynes waren Jean-Baptiste Say und alle anderen Klassiker also der Meinung, dass das Angebot sich die eigene Nachfrage schaffe, genauer gesagt, dass das aggregierte Angebot sich seine aggregierte Nachfrage schaffe. Wäre dies tatsächlich das Saysche Gesetz, wäre es offenkundig falsch. Natürlich ist es nicht richtig, dass jedes Angebot automatisch eine Nachfrage für sich hervorruft. Um das zu verstehen, muss man kein Ökonom sein. Aber Say hat nichts dergleichen behauptet. Keynes macht sich die „Widerlegung“ der klassischen Theorie so einfach wie möglich. Dieser verhängnisvolle Strohmann ist ein Vergehen an der wissenschaftlichen Redlichkeit und trotzdem bedienen sich seiner bis heute unzählige Ökonomen.
Selbst einige der renommiertesten Ökonomen reduzieren das Saysche Gesetz heute noch auf Keynes‘ Karikatur: „Jedes Angebot schafft sich seine Nachfrage selbst.“[2] In dieser Form braucht es gar keine Widerlegung. Man kann sich einfach über die Klassiker hinwegsetzen, mit einem überlegen-mitleidigen Lächeln ob ihrer ungeheuren Naivität: Sie liegen ja eindeutig falsch, also warum diskutieren wir hier überhaupt noch? Es braucht halt Staatseingriffe für die Vollbeschäftigung.
Mitnichten. Liest man Say aufmerksam, wird sehr schnell klar, dass sein Argument ein ganz anderes war. Say hat sich gar nicht mit der aggregierten Nachfrage und dem aggregierten Angebot im keynesianischen Sinne auseinandergesetzt. Das Saysche Gesetz lässt sich auf dieser Ebene weder verstehen noch richtig zusammenfassen. Es ging Say vielmehr um die individuelle Nachfrage und das individuelle Angebot von ganz verschiedenen Gütern und Dienstleistungen.
Say schrieb in seinem Traité d’économie politique, dass das Angebot eines bestimmten Gutes auf dem Markt gleichsam eine Absatzmöglichkeit für andere Güter bietet.[3] Es verkörpert also gleichzeitig eine Nachfrage für andere Güter. Er schrieb nicht, dass man jedes beliebige Gut auf dem Markt veräußern kann, weil sich jedes Angebot auf mysteriöse Weise seine Nachfrage selbst schaffe. Aber er betonte, dass jedes Angebot auf dem Markt nur deshalb gemacht wird, weil der Anbieter andere Güter und Dienstleistungen nachfragen möchte. Hätte er kein Bedürfnis nach anderen Gütern, bräuchte er auch nichts anbieten. Das Angebot eines Gutes kommt nur deshalb zustande, weil der Anbieter auch eine Nachfrage nach anderen Gütern hat. In diesem Sinne kann es gesamtwirtschaftlich betrachtet keine Situation geben, in der die Nachfrage zu klein ist und deshalb stimuliert werden müsse.
Das heißt aber natürlich nicht, dass ein wirtschaftliches Ungleichgewicht unmöglich ist. Es kann sehr wohl eine Situation geben, in der zu viele Güter einer bestimmten Sorte produziert und angeboten werden und zu wenige Güter einer anderen Sorte. Say streitet lediglich ab, dass es eine allgemeine Überproduktion von Gütern geben könne, ohne dass gleichzeitig auch eine allgemeine Nachfrage bestehe. Das Problem ist immer eine Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage von bestimmten Gütern, nicht von Gütern im Allgemeinen.
In einer Wirtschaftskrise wird demnach nicht allgemein zu viel produziert. Es wird lediglich von bestimmten Gütern zu viel produziert, für die die Nachfrage relativ gering ist. Und von anderen Gütern wird zu wenig produziert, für die die Nachfrage relativ hoch ist. Nicht die allgemeine Überproduktion ist das Problem, sondern die Fehlallokation in den Produktionsbemühungen. Deshalb lässt sich das Problem auch nicht mit politischen Interventionen zur Nachfragestimulation beheben. Die allgemeine Nachfrage ist ohnehin schon da. Das Problem ist, dass die relativen produzierten Gütermengen nicht mit den Bedürfnissen und Präferenzen der Käufer im Einklang sind. Schafft man durch politische Interventionen nun einen künstlichen Absatzmarkt für die Güter, die andernfalls keine Käufer fänden, so perpetuiert man das Problem und blockiert den Anpassungsprozess. Das Problem verhärtet sich und die Produktionsbemühungen werden nicht in die richtigen Bahnen gelenkt.
Keynes hatte das Saysche Gesetz verhohnepiepelt und keinesfalls widerlegt. Sein Strohmann geistert seither durch die Grundlagenlehrbücher der VWL.[4] Peter Bofinger schreibt etwa:
Im 18. und 19. Jahrhundert gingen die meisten Ökonomen davon aus, dass die Nachfrage immer ausreichend groß sei, um das gesamte vorhandene Angebot auch abzusetzen. Am deutlichsten wurde dies durch den französischen Ökonomen Jean Baptiste Say (1826-96) zum Ausdruck gebracht, der der Auffassung war, dass sich das Angebot immer auch seine Nachfrage schaffe.[5]
Dass Bofinger den Bindestrich zwischen Jean und Baptiste vergisst und sich auch beim Geburts- und Todesjahr um etwa ein halbes Jahrhundert vertut (eigentlich 1767-1832), würde Say ihm wahrscheinlich noch verzeihen. Das kann schon mal vorkommen.[6] Für den Rest würde er sich im Grabe drehen.
Der keynesianische Strohmann versinnbildlicht außerdem ein großes Problem mit den in der modernen Makroökonomik so weit verbreiteten Aggregationsverfahren. Betrachtet man die Summe aller Geldausgaben als die aggregierte Nachfrage, so wird man in einer Wirtschaftskrise natürlich feststellen, dass die aggregierte Nachfrage „zu klein“ ist. Sie ist in der Tat kleiner als es sich viele Produzenten erhofft hatten. Auf der aggregierten Ebene liegt der Schluss nahe, dass die Nachfrage insgesamt zu schwach ist, und das aggregierte Angebot, gegeben der Nachfrage zu groß. Man übersieht dabei aber, dass es sich um relative Ungleichgewichte handelt. Die Nachfrage ist in bestimmten Sektoren zu niedrig und in anderen zu hoch. Dort kann sie aber, gegeben der Verteilung der Produktionsbemühungen, nicht bedient werden.
Richtig verstanden hieße eine schwache allgemeine Nachfrage nichts anderes als dass die noch zu befriedigenden Bedürfnisse der Menschen schwach sind. Das wäre in der Tat kein Problem, sondern ein überaus wünschenswerter Zustand.
[1] Siehe Keynes (2006 [1936]): Die Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes, Berlin: Duncker & Humblot.
[2] Siehe Carl Christian von Weizsäcker „John Maynard Keynes: Der Bezwinger der Weltwirtschaftskrisen“, in der Frankfurter Allgemeinen, 20.07.2013.
[3] Er schrieb: „On voit donc que le fait seul de la formation d’un produit ouvre, dès l’instant même, un débouché à d’autres produits.“ Siehe Say (2011 [1803]): Traité d’économie politique, Paris: Institut Coppet, S. 89.
[4] Siehe etwa das weltweit am meisten verwendete Lehrbuch von Paul Samuelson und William D. Nordhaus (2007): Volkswirtschaftslehre, Landsberg am Lech: mi-Fachverlag, S. 962.
[5] Peter Bofinger (2011): Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, München: Pearson Studium, S. 342.
[6] Zumal Bofinger hier immerhin die Lebensdaten eines engen Verwandten verwendet. Er verwechselt Großvater Jean-Baptiste Say (1767-1832) mit dessen Enkelsohn Jean-Baptiste Léon Say (1826-1896), der auch Ökonom war, aber eher dafür bekannt ist, dass er mehrfacher Finanzminister Frankreichs war.
Dr. Karl-Friedrich Israel hat Volkswirtschaftslehre, Angewandte Mathematik und Statistik an der Humboldt-Universität zu Berlin, der ENSAE ParisTech und der Universität Oxford studiert. Er wurde 2017 an der Universität Angers in Frankreich bei Professor Dr. Jörg Guido Hülsmann promoviert. An der Fakultät für Recht und Volkswirtschaftslehre in Angers unterrichtete er von 2016 bis 2018 als Dozent. Seit Herbst 2018 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Wirtschaftspolitik an der Universität Leipzig.
*****
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Institut Deutschland wieder.
Foto: © Anshuman – Fotolia.com