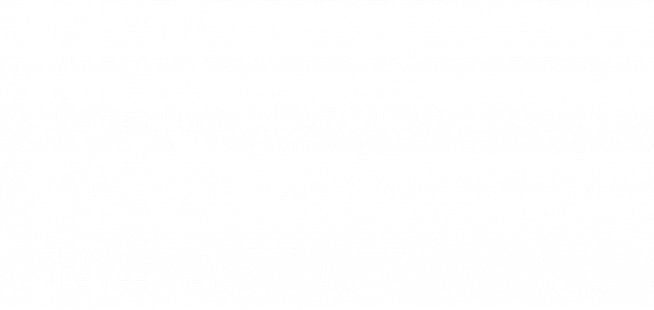Zentralbanken sind Geschöpfe der Machtpolitik, nicht der ökonomischen Vernunft
1.2.2017 – von Karl-Friedrich Israel.
In einer Zeit, in der Zentralbankreformen in aller Munde sind, ist es wichtig sich, auch der fundamentaleren Frage nach der Notwendigkeit von Zentralbanken überhaupt zu widmen. Im Jahre 1936 publizierte Vera C. Smith (spätere Lutz) ihre Doktorarbeit The Rationale of Central Banking, die sie unter der Betreuung von Friedrich August von Hayek (1899-1992) an der London School of Economics geschrieben hatte. Smith studierte die ökonomischen Kontroversen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts um das Zentralbankwesen in Frankreich, Belgien, Deutschland, England, Schottland und den Vereinigten Staaten von Amerika.
Smith gab klar und deutlich zu verstehen, dass Zentralbanken nicht die Folge natürlicher Entwicklungen im Finanzsektor waren, sondern immer aus staatlichen Sonderrechten heraus entstanden sind. Es gibt hier also Rechtfertigungsbedarf. Sie identifizierte fünf Hauptargumente für das Zentralbankwesen aus ökonomischer Sicht. Auch wenn die Smithsche Analyse einen Goldstandard zugrunde legte, ist es durchaus aufschlussreich, diese Argumente noch einmal aus heutiger Sicht zu studieren, mehr als 80 Jahre später. Hat irgendeines dieser Argumente eine überzeugende oder gar definitive Rechtfertigung für Zentralbanken geliefert?
Die Gleichverteilung von Risiko
Das erste Argument ist folgendes. In einem System freier Banken, das insgesamt durchaus stabil sein könnte, würde es immer auch die Gefahr der Insolvenz einzelner Banken geben. Sollte eine Geschäftsbank die Notenausgabe über den eigenen Goldreserveanteil anheben, so geht sie das Risiko eines Bankrotts ein. Die Banknoten bleiben allerdings nicht ausschließlich in den Händen der direkten Kunden dieser Bank, sondern werden im Tausch auch an Dritte weitergegeben. Die Halter der Noten zum Zeitpunkt des Bankrotts tragen die Kosten. Es ist allerdings anzunehmen, dass das Risiko nicht gleichmäßig auf alle Marktakteure verteilt sein wird. Gerade jene, die, aus welchen Gründen auch immer, die Extrakosten der Diskriminierung zwischen den Noten solventer und insolventer Banken nicht tragen können, werden am schwersten betroffen sein. Darum sollte der Staat eingreifen und für eine Harmonisierung der Notenausgabe sowie eine Gleichverteilung des Ausfallrisikos sorgen. Dies kann durch die Monopolisierung der Notenausgabe, also die Gründung einer Zentralbank, erreicht werden.
Das Gegenargument der Anhänger eines freien Bankensystems beläuft sich auf die Feststellung, dass zwar tatsächlich eine Gleichverteilung des Risikos durch Zentralbanken erreicht werden würde, gleichzeitig aber das Risiko insgesamt tendenziell ansteige – eine Feststellung also, die nicht einfach so vom Tisch zu weisen ist.
Überproduktion von Banknoten und exzessive Kreditausweitung
Das historisch wichtigste Argument für Zentralbanken bezieht sich auf die Gefahren der Überproduktion von Banknoten und der exzessiven Kreditausweitung. Dies mag dem modernen Leser als durchaus paradox erscheinen.
 Diesem Argument zufolge würde es in einem freien Bankensystem für jede einzelne Bank einen starken Anreiz geben, die eigenen Zinssätze abzusenken und die Kreditmenge auszuweiten, um Marktanteile für sich zu erobern. An einem bestimmten Punkt in diesem Prozess werden Goldreserven das Land verlassen, und die Banken müssen von einer weiterer Kreditausgabe Abstand nehmen, um die eigenen Reserven zu schützen. Dies würde eine Wirtschaftskrise nach sich ziehen.
Diesem Argument zufolge würde es in einem freien Bankensystem für jede einzelne Bank einen starken Anreiz geben, die eigenen Zinssätze abzusenken und die Kreditmenge auszuweiten, um Marktanteile für sich zu erobern. An einem bestimmten Punkt in diesem Prozess werden Goldreserven das Land verlassen, und die Banken müssen von einer weiterer Kreditausgabe Abstand nehmen, um die eigenen Reserven zu schützen. Dies würde eine Wirtschaftskrise nach sich ziehen.
Es wurde also behauptet, dass ein freies Bankensystem mit sehr viel stärkeren Fluktuationen im Geld- und Kreditangebot einhergehen würde. Zentralbanken als Monopolisten könnten das exzessive Kreditangebot sowie das Wechselspiel von inflationären und deflationären Episoden verhindern und damit die gesamte Volkswirtschaft stabilisieren.
Das Argument stützt sich letztlich auf die Verneinung der Frage, ob die gegenseitige Kontrolle der freien Geschäftsbanken durch ein Clearing-Verfahren ausreiche, eine kritische Menge von Geschäftsbanken dazu zu veranlassen, auf die kurzfristigen Gewinne der exzessiven Kreditmengenausweitung zu verzichten. Doch wie Smith anmerkte, gibt es historische Beispiele, etwa aus Schottland, Kanada, und Suffolk (Massachusetts), die zeigen, dass ein System der wettbewerblichen Notenausgabe funktionieren kann und ausreichende Anreize setzt, von der exzessiven Ausgabe von Umlaufsmitteln abzusehen.
Der Kreditgeber der letzten Instanz
Ein weiteres, sehr bedeutendes Argument ist jenes vom Kreditgeber der letzten Instanz. Die grundlegende Idee ist, dass Zentralbanken Wirtschaftskrisen, die in jedem System möglich sind, abmildern könnten, aufgrund ihrer speziellen Privilegien und dem größeren Vertrauen der Öffentlichkeit in die Noten der Zentralbanken. Wenn Geschäftsbanken dazu gezwungen werden, die weitere Notenausgabe zu verweigern, um die eigenen Reserven zu schützen, weil immer mehr Kunden die Banknoten in Gold eintauschen wollen, könnten Zentralbanken einspringen und eine Deflationsspirale verhindern, weil Zentralbanknoten höhere Akzeptanz genössen. Im schlimmsten Fall könnte die Konvertibilität ausgesetzt werden, wie es zahlreiche Male geschehen ist. Zentralbanken können somit Liquiditätsengpässe überbrücken und schlimmere Krisen vermeiden.
Das entsprechende Gegenargument wurde unter anderem von Ludwig von Mises (1881-1973) hervorgebracht. Wenn es einen aktiven Kreditgeber der letzten Instanz gibt, so wird dies als eine Rahmenbedingung in die Entscheidungen der Geschäftsbankiers einfließen und sie dazu anhalten, größere Risiken einzugehen und den Reserveanteil weiter abzusenken. Somit wird das System als Ganzes fragiler.
Darüber hinaus haben alle drei bisher besprochenen Probleme ihre gemeinsame Wurzel im Teilreservesystem. Mit einer Volldeckung, wie sie unter anderen von Fisher, Friedman, einigen Austrians, sowie den Befürwortern des Vollgeldes in der Schweiz und Deutschland vorgeschlagen wurde, könnten sie nahezu komplett aus der Welt geschafft werden. Trotzdem bleiben zwei weitere Argumente, die von besonderer Wichtigkeit aus heutiger Sicht sind.
Zentralbanken als Mittel der internationalen Kooperation
Das vierte Argument betont, dass durch Zentralbanken eine internationale Kooperation in der Geldpolitik möglich wird. Die Idee der Kooperation und Harmonisierung lag nicht zuletzt auch der Gründung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) im Jahre 1930 zugrunde. Dennoch ist es natürlich die Existenz von Zentralbanken selbst, die überhaupt erst Geldpolitik möglich macht. Die entscheidende Frage ist aber, welche Art der Geldpolitik verfolgt werden sollte, was uns zum letzten Argument führt.
Rationale Geldpolitik
Das letzte Argument gewann an Beachtung in der Zeit nach dem ersten Weltkrieg und ist in der Tat das wichtigste Argument aus heutiger Sicht. Traditionell war es das Anliegen der meisten Geldreformer, automatische Anpassungsmechanismen in das Finanzsystem einzuführen. Dem fünften Argument zufolge sei es jedoch vorteilhaft, eine aktive und rationale Politik der Geld- und Kreditmengenkontrolle zu betreiben, die sich an „wissenschaftlichen Kriterien“ orientiert. Dafür wäre eine Zentralbank unerlässlich. Die Hauptwerkzeuge der Geldpolitik wären die Setzung des Leitzinses und Offenmarktgeschäfte.
Die Absetzung des Goldstandards und der Übergang in ein Fiatgeldsystem hat den Zentralbankern selbstverständlich noch mehr Möglichkeiten an die Hand gegeben und hat den Glauben an eine aktive Steuerung der Geldmenge weiter gestärkt. Jedes Argument oder wissenschaftliches Kriterium der Geldpolitik, das Geldmengenexpansion eines bestimmten Umfangs erfordert, ist zumindest implizit auch ein Argument für Fiatgeld und a fortiori für Zentralbanken.
Das erste wissenschaftliche Kriterium war das der Preisstabilität. Die Geldmenge sollte demnach mit der Rate des reellen Wirtschaftswachstums ausgeweitet werden, sodass das allgemeine Preisniveau konstant bleibe. Doch wie Vera Smith anmerkte, ist dieses Kriterium „sowohl theoretisch fragwürdig als auch hoffnungslos verfehlt in der Praxis.“
Die moderne Makroökonomik, die sich erst nach 1936 entwickelte, hat für noch stärkere Geldmengenausweitung geworben, indem man das Kriterium der stabilen Inflationsrate an die Stelle des stabilen Preisniveaus gesetzt hat. Dennoch wurde bisher keine einzige Studie herausgegeben, die auch nur ansatzweise als eine Art Prüfung der allgemeinen ökonomischen Vorteile von Inflation angesehen werden kann. Insbesondere hat keine Studie bislang gezeigt, dass die Probleme des moralischen Risikos, des erhöhten systemischen Risikos, der perversen Umverteilung von Unten nach Oben, sowie der nichtnachhaltigen, inflationsgetriebenen Booms in irgendeiner Art und Weise durch die möglichen Vorteile der Inflation aufgewogen werden.
Dass Zentralbanken auch zumindest individuelle oder gruppenbezogene Vorteile liefern, liegt auf der Hand. So hat Leland Yeager in seinem Vorwort zur Liberty Fund Ausgabe des Buches von Smith treffend darauf hingewiesen, dass Zentralbanken heutzutage nicht zuletzt auch deshalb wertgeschätzt werden, weil sie prestigereiche und komfortable Beschäftigung bieten, unter anderen für promovierte Ökonomen. Es ist eben doch nichts so schlecht, dass es nicht auch was Gutes hätte.
Fazit
Es ist selbstverständlich wünschenswert eine rationale Geldpolitik zu betreiben, wenn es denn überhaupt eine geben muss. Wer könnte gegen Rationalität und Vernunft sein? Dennoch hat bisher kein Ökonom eine überzeugende und umfangreiche Rechtfertigung der politikgesteuerten Implementierung monetärer Stimuli geliefert. Zentralbanken bleiben ein Geschöpf der Machtpolitik, nicht der ökonomischen Vernunft.
————————————————————————————————————————————————————————
Karl-Friedrich Israel, 28, hat Volkswirtschaftslehre, Angewandte Mathematik und Statistik an der Humboldt-Universität zu Berlin, der ENSAE ParisTech und der Universität Oxford studiert. Zur Zeit absolviert er ein Doktorstudium an der Universität Angers in Frankreich.
*****
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Institut Deutschland wieder.