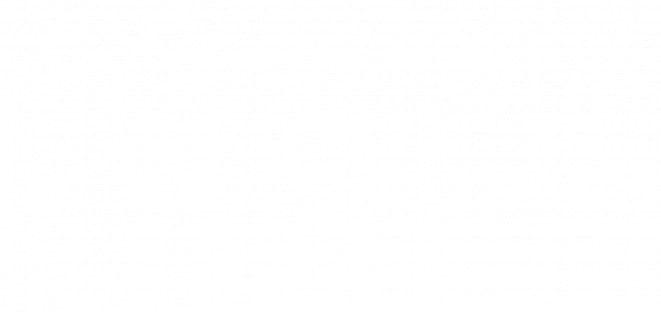Die Cambridge-Cambridge-Kontroverse über den Kapitalbegriff und ihre Bedeutung für die Österreichische Schule
6.1.2017 – von Eduard Braun.
Es gab in der Geschichte der Volkswirtschaftslehre drei große Debatten über die Frage, wie der Begriff des Kapitals zu fassen sei und welche Rolle er in dieser Wissenschaft spielen solle. In den ersten beiden Auseinandersetzungen stellte die Österreichische Schule der Nationalökonomie die zentralen Akteure auf jeweils einer der beiden Seiten. In der ersten Debatte am Ende des 19. Jahrhunderts war es hauptsächlich Eugen von Böhm-Bawerk (1851-1914), der die Österreicher vertrat, in der zweiten, die in den 1930er Jahren stattfand, war es hauptsächlich Friedrich von Hayek (1899-1992). Die dritte Debatte in den 1950er und 1960er-Jahren erfolgte dann allerdings im wesentlichen ohne Beteiligung von österreichischer Seite. Die Kombattanten waren einerseits Volkswirte aus der englischen Universität Cambridge, die später unter dem Namen „Neo-Ricardianer“ firmierten, und andererseits bekannte neoklassische Ökonomen aus dem amerikanischen Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge, Massachusetts. Da die Beiträge dieser letzten Debatte gerade auch aus Sicht der Österreichischen Schule bedeutsam sind, jedoch leider nicht durch Allgemeinverständlichkeit glänzen, versucht der vorliegende Artikel, die damals diskutierte Kernfrage herauszuarbeiten, wobei bewußt auf die Wiedergabe einiger Details verzichtet wird.
*
Es ist eine der ältesten und meistdiskutierten volkswirtschaftlichen Fragen, warum es denn eigentlich einen Zins gebe, also ein arbeitsloses Einkommen, das aus dem Geld zu fließen scheint, ohne daß doch Geld selbst produktiv ist. Platon und Aristoteles, aber auch die älteren Scholastiker wie Thomas von Aquin haben den Zins noch weitestgehend verworfen. Erst in der Neuzeit hat sich der Gedanke durchgesetzt, daß der Zins die Entlohnung für einen Produktionsfaktor sein könnte, nämlich das Kapital. Die Begründung der These, daß das Kapital entlohnt werden muß wie jeder andere Produktionsfaktor auch, war und ist natürlich keineswegs einheitlich. Manche behaupteten, Kapital entstehe durch Abstinenz vom Konsum, weswegen der Zins eine Art Entschädigung für Konsumverzicht sei. Andere betonten die höhere Produktivität der Arbeit, wenn sie durch Kapitalgüter wie z.B. Maschinen unterstützt wird, um den Zins zu begründen. Bekanntlich gibt es auch Stimmen, die das Kapital als Ausbeutungsinstrument verstehen, das es den Kapitalisten erlaubt, den Arbeitern den Mehrwert ihrer Tätigkeit abzupressen. Zwar gesteht diese Sicht der Dinge dem Kapital nicht zu, ein Produktionsfaktor zu sein; trotzdem begründet sie den Zins als einen Ausfluß des Kapitals, sieht letzteres also als einen Faktor, dem der Zins zuzurechnen ist.
In der ersten Debatte über das Kapital ging es dann auch um die Frage, wie das Konzept des Kapitals denn überhaupt zu definieren sei. Eugen von Böhm-Bawerk vertrat dabei die Auffassung, Kapital sei zusammengesetzt aus zahlreichen, unterschiedlichen Gütern, die sich nicht ohne weiteres addieren lassen. Schmelzöfen, Sicheln und Stecknadeln seien zwar allesamt Kapitalgüter, jedoch so verschieden voneinander wie Äpfel und Birnen, die sich ja bekanntermaßen auch nicht vergleichen, d.h. auf einen gemeinsamen Nenner bringen lassen. Kapital sei demnach keine einheitliche Masse, sondern gleiche eher einer Struktur aus heterogenen Kapitalgütern. Zwar gab Böhm-Bawerk noch weitere Gründe für die Existenz des Zinssatzes an, eines seiner wesentlichen Argumente war es jedoch, daß Kapital es ermöglicht, langfristige Produktionsprozesse – Produktionsumwege, wie er es nannte – in Angriff zu nehmen, die produktiver seien als kurzfristige. Als Beispiel läßt sich ein Fischer anführen, der entscheiden muß, ob er mit der bloßen Hand fischen oder lieber vorher einen Kescher bauen will. Letzteres dauert zwar zunächst einmal länger, da der Fischer ja erst einmal den Kescher, also ein Kapitalgut, herstellen muß, führt aber auf lange Sicht zu einem höheren Ertrag an Fischen.
 Böhm-Bawerk ging davon aus, daß sich dieses Beispiel verallgemeinern läßt, daß also eine Einführung längerer Produktionsumwege mit Hilfe von neuen Kapitalgütern, insbesondere natürlich Maschinen aller Art, die Produktivität grundsätzlich erhöht. Ein Mehr an Kapital geht demnach mit längeren Produktionsprozessen und folglich mit einem größeren und wertvolleren Produktionsausstoß einher. Diese Vergrößerung der Produktion läßt sich dem Kapital zurechnen und erklärt, warum der Zins als Entlohnung für Kapital bezahlt wird.
Böhm-Bawerk ging davon aus, daß sich dieses Beispiel verallgemeinern läßt, daß also eine Einführung längerer Produktionsumwege mit Hilfe von neuen Kapitalgütern, insbesondere natürlich Maschinen aller Art, die Produktivität grundsätzlich erhöht. Ein Mehr an Kapital geht demnach mit längeren Produktionsprozessen und folglich mit einem größeren und wertvolleren Produktionsausstoß einher. Diese Vergrößerung der Produktion läßt sich dem Kapital zurechnen und erklärt, warum der Zins als Entlohnung für Kapital bezahlt wird.
Die Heterogenität der Kapitalgüter ist zentral für Böhm-Bawerks Zinserklärung. Es gibt Kapitalgüter, die die Produktionswege verlängern, und solche, die das nicht tun. In Zeiten von Hochseefischerei und Schleppnetzen können zusätzliche Kescher nicht mehr als produktionswegverlängernd betrachtet werden. Es kommt auch darauf an, ob sich neue Kapitalgüter in die bereits bestehende Kapitalstruktur eingliedern und diese so verändern, daß die Produktionsprozesse länger werden.
Die neoklassischen Gegner Böhm-Bawerks im ersten Streit um den Kapitalbegriff behaupteten nun genau das Gegenteil, nämlich daß sich Kapitalgüter sehr wohl addieren lassen und es somit durchaus angeht, von Kapital als einer homogenen Masse zu sprechen. Wie so oft läßt sich auch diese Position der Neoklassiker mit ihrem Fokus auf das Gleichgewicht erklären. Außerhalb des Gleichgewichts, so ihr Argument, mag die Heterogenität der Kapitalgüter und die Länge der Produktionsumwege durchaus eine Rolle spielen. Im Gleichgewicht jedoch sind alle Koordinationsprobleme innerhalb der Kapitalstruktur gelöst. Eine Wartezeit wegen längerer Produktionsprozesse gibt es daher im Gleichgewicht ebenfalls nicht. Zusätzliches Kapital führt hier sofort und automatisch zu einer höheren Produktion.
Nun läßt sich über dieses Problem herrlich streiten, und in der zweiten Debatte über den Kapitalbegriff ging es um eine sehr ähnlich gelagerte Frage, nur daß Friedrich Hayek die Heterogenität des Kapitals nicht wegen ihrer Rolle in der Erklärung des Zinses verteidigte, sondern weil er sie als Bestandteil seiner Konjunkturtheorie benötigte. Für das Verständnis der dritten Debatte ist vor allem wichtig,daß es schon in der ersten um die Frage ging, wie Kapital zu definieren sei, wenn ihm der Zins zugerechnet werden soll.
*
Nun gibt es unterschiedliche Meinungen dazu, wer die ersten beiden Debatten gewonnen hat, die Österreicher oder die Neoklassiker. Wenn man sich die dritte, d.i. die Cambridge-Cambridge-Kontroverse anschaut, fällt allerdings auf, daß sich die späteren Neoklassiker sehr wohl auch in der Tradition Böhm-Bawerks sahen. Paul Samuelsons (1915-2009) bekannter Artikel „A summing up“[1], in dem er die Niederlage der Neoklassiker einräumte, enthält bereits auf der ersten Seite eine graphische Darstellung der Produktionsumwege, die offensichtlich auch dazu dienen soll, Samuelsons eigene Position zu illustrieren.
Im großen und ganzen sah man der neoklassischen Kapitaltheorie diesen Bezug auf Böhm-Bawerk jedoch nicht an. Besonders in der sogenannten Wachstumstheorie wurde Kapital als ein Produktionsfaktor verstanden, der sich aus einer homogenen Masse an Kapitalgütern zusammensetzt. Aufgrund ihrer Beschränkung auf das Gleichgewicht sahen die Neoklassiker kein Problem darin, die unterschiedlichsten Güter in einen Topf zu werfen und zu dem Produktionsfaktor Kapital zu aggregieren. Die Entlohnung des Faktors Kapital ergebe sich nun wie diejenige aller anderen Produktionsfaktoren, nämlich aus seiner Grenzproduktivität, das heißt aus dem zusätzlichen Produktionsertrag, der resultiert, wenn alle anderen Produktionsfaktoren konstant gehalten werden und nur die Menge des Kapitals variiert wird. Kurz, so wie sich die Höhe des Lohnes erklären läßt durch das, was der letzte noch angestellte Arbeiter zur Produktion beiträgt, läßt sich auch die Gewinnrate durch den zusätzlichen Ertrag der letzten noch eingesetzten Kapitaleinheit erklären.
Dieser Zusammenhang war es, der von den Neo-Ricardianern, allen voran von Joan Robinson (1903-1983) und Pierro Sraffa (1898-1983) in der Cambridge-Cambridge-Kontroverse angegriffen wurde. Sie argumentierten, daß es unmöglich sei, den Zins (eigentlich die Gewinnrate; zur Vereinfachung kann man aber auch vom Zins sprechen) als das Produkt eines Produktionsfaktors Kapital aufzufassen. Bei dem Faktor Arbeit gehe es ja noch an, diesen in einzelne physische Einheiten zu zerlegen und sich die Grenzproduktivität eines einzelnen Arbeiters oder einer einzelnen Arbeitsstunde anzuschauen. Beim Kapital, das aus völlig unterschiedlichen und unvergleichbaren Kapitalgütern zusammengesetzt ist, sei das jedoch unmöglich. Wenn die neoklassische Wachstumstheorie die physisch unterschiedlichsten Güter unter dem Begriff des Kapitals zusammenfaßt, so die Argumentation der Neo-Ricardianer, dann kann sie das nur, indem sie einen gemeinsamen Nenner für all‘ diese Güter findet. Dieser Nenner kann nur der Preis dieser Güter sein. So grundverschieden eine Stecknadel und ein LKW auch sein mögen, ihre Preise kann ich sehr wohl zusammenzählen und erhalte trotzdem eine aussagekräftige Größe. Genau so kann ich das auch für sämtliche Kapitalgüter einer Volkswirtschaft machen, um einen einheitlichen, zahlenmäßigen Ausdruck für den Produktionsfaktor Kapital zu bekommen.
Den Knackpunkt der neo-ricardianischen Argumentation bildet nun folgende Überlegung: Der Weg, die Aggregation der heterogenen Kapitalgüter zu einem homogenen Faktor Kapital zu erreichen, indem man einfach die Preise zusammenzählt, führt unweigerlich in ein Paradoxon. Dies wird deutlich, wenn man versucht, den Zins als ein Produkt des so bestimmten Kapitals zu erklären, wie es die Neoklassiker tun. Die Preise der Güter, aus denen sich das Kapital zusammensetzt, sind nämlich ihrerseits von der Höhe des Zinses abhängig.
Am deutlichsten wird das, wenn man die moderne Preistheorie zugrunde legt. Der Preis eines Kapitalgutes ergibt sich demnach als der abdiskontierte Wert seiner zukünftigen Erträge. Je mehr ein Gut in der Zukunft abzuwerfen verspricht, desto teurer ist es logischerweise heute. Die zukünftigen Erträge fließen dabei aber nicht eins zu eins in die heutige Bewertung ein. 100 Euro, die ich im nächsten Jahr verdienen kann, sind heute nicht 100 Euro wert. Bei einem Zinssatz von sagen wir 10 Prozent könnte ich mir die 100 Euro im nächsten Jahr ja auch dann schon sichern, wenn ich im laufenden Jahr nur 90,91 Euro anlege. In anderen Worten, bei einem Zinssatz von 10 Prozent wird ein Kapitalgut, das im nächsten Jahr einen Ertrag von 100 Euro abzuwerfen verspricht, in diesem Jahr einen Preis von ca. 90,91 Euro haben. Nun kann der Zins natürlich auch bei 5 Prozent liegen. Dann hätte das in Frage stehende Gut heute einen Preis von ca. 95,24 Euro. Oder bei 20 Prozent, dann würde es heute 83,33 Euro kosten.
Wir sehen, der Preis eines Kapitalgutes hängt von der Höhe des Zinssatzes ab. Es stellt einen logischen Zirkel dar, nun zu versuchen, den Zins als ein Produkt des Kapitals herzuleiten, denn um die Größe des Kapitals zu erhalten, muß ich ja schon den Zinssatz kennen, da ich ansonsten die Preise der Kapitalgüter gar nicht bestimmen kann. Ich setze also logisch schon den Zinssatz voraus, den ich eigentlich erst bestimmen möchte.
Aber auch wenn wir uns, ähnlich den Neo-Ricardianern, an der alten, klassischen Preistheorie orientieren und den Preis eines Gutes als die Summe seiner Produktionskosten ansehen, landen wir in diesem logischen Zirkel. Denn auch die Kosten eines Kapitalgutes sind nicht vom Zinssatz unabhängig. Die Produktionskosten setzen sich grob zusammen aus den Löhnen, die man den Arbeitern zahlen muß, und den Kosten für die Nutzung der Maschinen, Werkzeuge und anderen Kapitalgüter, die man eben auch zur Produktion von Kapitalgütern benötigt. Letzteres sind aber nichts anderes als Kosten der Kapitalnutzung, also in anderen Worten Zinsen. Auch in diesem Fall stellen die Zinsen eine Komponente dar, welche die Größe des Kapitals beeinflußt, und es ist daher unmöglich, das so bestimmte Kapital als Erklärungsgrund für die Existenz und die Höhe des Zinssatzes zu benutzen.
Die Cambridge-Cambridge-Debatte hat gezeigt, daß die Praxis der Neoklassiker, von einem homogenen Produktionsfaktor Kapital auszugehen und aus diesem den Zins zu erklären, zu einem Paradoxon führt. Der Zins scheint demnach weniger aus dem Kapital zu fließen, als vielmehr eine Ursache für den Wert des Kapitals zu sein.
*
Wie bereits betont wurde, lief die besagte Debatte im wesentlichen ohne Beteiligung der Österreichischen Schule der Nationalökonomie ab. Trotzdem läßt sich aus dem Streit einiges ziehen, das auch für Volkswirte dieser Richtung von nicht geringer Bedeutung ist. Insbesondere ist klar geworden, daß der Versuch, Kapital einfach als einen physisch definierten Produktionsfaktor zu betrachten, der neben die Arbeit und den Boden gestellt werden kann, in eine Sackgasse führt. Offenbar wird der Wirklichkeit Gewalt angetan, wenn man den Zins aus körperlichen Gegenständen, d.h. den Kapitalgütern fließen lassen will.
In einem anderen Artikel auf dieser Seite habe ich bereits darauf hingewiesen, daß auch einige Mitglieder der Österreichischen Schule dazu neigen, das Kapital als physischen Produktionsfaktor zu definieren. Mit diesem Vorgehen treten aber leider zentrale Eigenschaften der Marktwirtschaft in den Hintergrund, die im üblichen Sprachgebrauch eben gerade mit dem Wort Kapital bezeichnet werden. So wird in unserem Wirtschaftssystem fast die gesamte Produktion von Unternehmen organisiert, die auf Kapital im Sinne von Finanzkraft basieren. Karl Marx hat hierfür die passende Formel gefunden:
Geld – Ware – Geld‘
Unternehmen sind auf Geldkapital gegründet, und sie produzieren oder handeln mit Waren, um ihr Geldkapital zu mehren.
Ludwig von Mises hat dann später gezeigt, daß nur auf Grundlage der in dieser Formel schematisierten Geldrechnung, mit der die Rentabilität des in Unternehmen angelegten Kapitals bestimmt wird, eine wirtschaftliche Verwendung der gesellschaftlichen Ressourcen erreicht werden kann. Kapital wird hierbei nicht verstanden als ein physisches Aggregat von Maschinen und Werkzeugen, sondern als eine Institution der Geldrechnung, die der Organisation der Produktion in der Marktwirtschaft zugrunde liegt und garantieren soll, daß das produziert wird, was die Konsumenten wollen, und dabei möglichst wenig Ressourcen verschwendet werden. Der Verlauf der Cambridge-Cambridge-Debatte sollte als Ansporn betrachtet werden, diesen von Carl Menger begründeten und von Ludwig von Mises weitergeführten Ansatz weiter zu verfolgen.
[1] Paul A. Samuelson: A Summing Up, in: The Quarterly Journal of Economics 80 (4), Nov. 1966, S. 568-583
*****
Eduard Braun ist Referent beim Ludwig von Mises Seminar 2017:
„Die Österreichische Schule der Nationalökonomie – Gegenpol zur Hauptstrom-Volkswirtschaftslehre“

————————————————————————————————————————————————————————
Dr. Eduard Braun hat im Jahr 2011 bei Professor Dr. Jörg Guido Hülsmann an der Universität Angers (Frankreich) promoviert und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Professor Dr. Mathias Erlei, Abteilung für Volkswirtschaftslehre, an der Universität Clausthal-Zellerfeld, (http://www.wiwi.tu-clausthal.de/index.php?id=430).
Zuletzt erschien sein Buch Finance Behind the Veil of Money.
*****
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Institut Deutschland wieder.