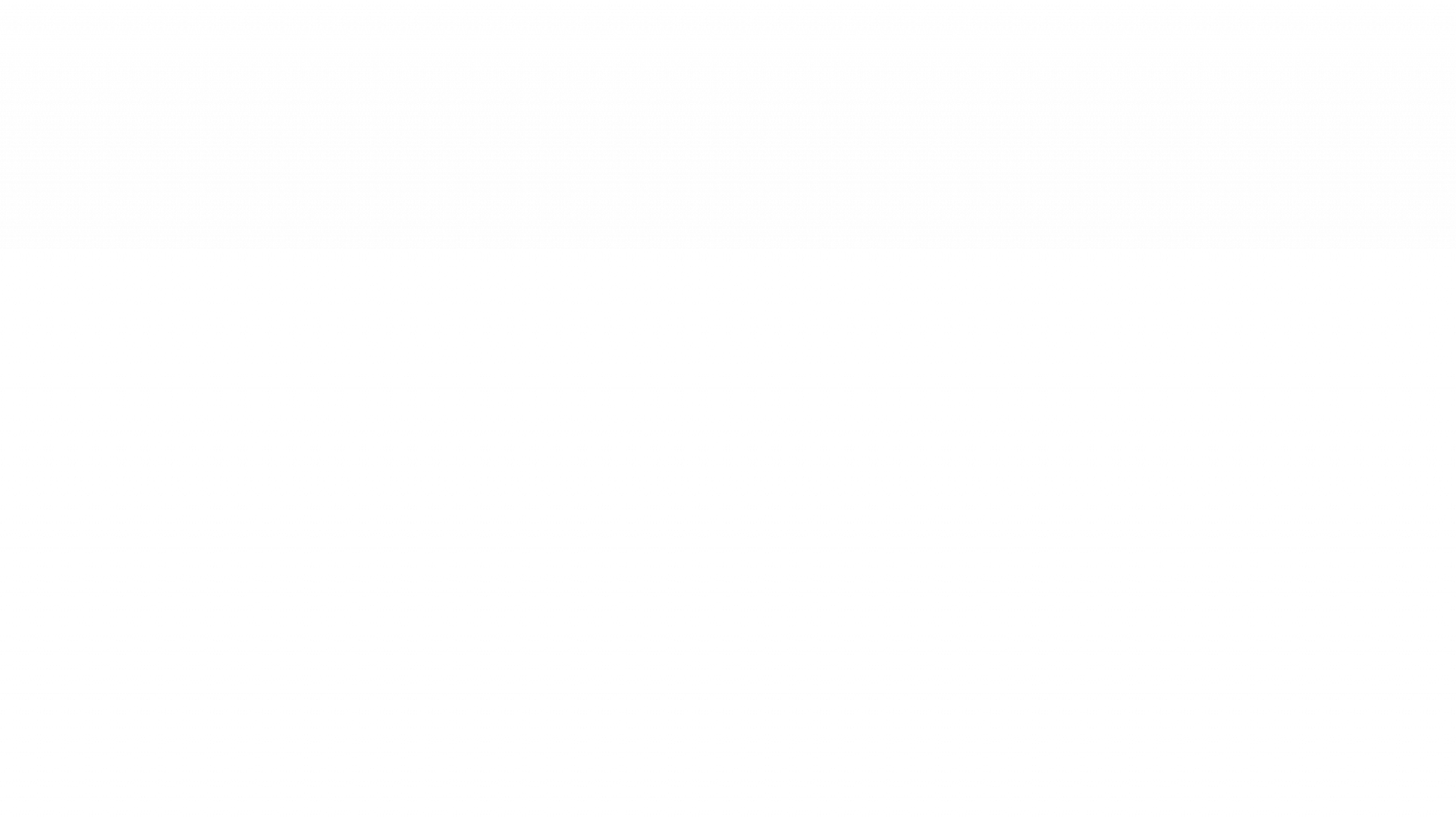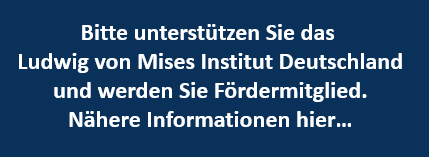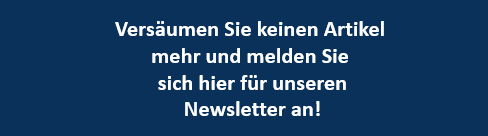„Kulturkampf“: Das Ringen um die öffentliche Meinung
Mises Original
26. September 2025 – von Ludwig von Mises
Im Folgenden lesen Sie einen Auszug aus Ludwig von Mises „Erinnerungen“ (2. Auflage 2014), und zwar das VII. Kapitel „Der Erste Weltkrieg“ (S. 40 – 43).
Ich habe hier weder vom Krieg noch von meinen persönlichen Erlebnissen im Kriege zu sprechen. Ich befasse mich in dieser Schrift nicht mit militärischen Fragen und mit den politischen nur so weit, als es der Zweck der Darstellung unumgänglich erfordert.
Der Krieg kam als Ergebnis der Ideologie, die seit Jahrhunderten von allen deutschen Kathedern verkündet worden war. Die Professoren der Wirtschaftsfächer hatten bei der geistigen Vorbereitung des Krieges wacker mitgeholfen. Sie mussten nicht erst umlernen, um im «geistigen Leibgarderegiment der Hohenzollern» ihren Mann zu stellen. Schmoller verfasste das berühmte Manifest der 93 (11. Oktober 1914), ein anderer Ordinarius, Schumacher, der dann nach Berlin als Nachfolger Schmollers berufen wurde, redigierte das Annexionsprogramm der sechs Spitzenverbände. Sombart schrieb Händler und Helden. Franz Oppenheimer konnte sich in Anpöbelung der «Unkultur» der Franzosen und Engländer nicht genug tun. Man trieb nicht mehr Volkswirtschaftslehre, sondern Kriegswirtschaftslehre.
Der Krieg kam als Ergebnis der Ideologie, die seit Jahrhunderten von allen deutschen Kathedern verkündet worden war. Die Professoren der Wirtschaftsfächer hatten bei der geistigen Vorbereitung des Krieges wacker mitgeholfen.
Auch im Lager der Feinde ging es nicht besser zu. Doch dort gab es viele, die es vorzogen zu schweigen; Edwin Cannan sah es als Pflicht der Nationalökonomen an, zu protestieren.
[(*) Mit * gekennzeichnete Links sind Partner-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, unterstützen Sie das Ludwig von Mises Institut Deutschland, das mit einer Provision beteiligt wird. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten.]
Ich habe in den ersten fünfzehn Monaten des Krieges kaum die Zeitung lesen können. Später wurde es etwas besser, und am Ende des Jahres 1917 stand ich nicht mehr im Felde, sondern arbeitete in Wien in der Kriegswirtschaftsabteilung des Kriegsministeriums. Ich habe in diesen Jahren nur zwei kleine Aufsätze verfasst. Der eine, über die Klassifikation der Geldtheorie, ging später in die zweite Auflage der Geldtheorie über. Der andere, «Vom Ziel der Handelspolitik», wurde von mir bei der Abfassung des im Jahre 1919 veröffentlichten Buches Nation, Staat und Wirtschaft verwendet. Es war ein wissenschaftliches Buch, doch seine Absicht war politisch. Es war ein Versuch, die deutsche und österreichische öffentliche Meinung der nationalsozialistischen Idee – sie trug damals noch keinen besonderen Namen – abspenstig zu machen und ihr zu empfehlen, den Wiederaufbau durch demokratisch-liberale Politik anzustreben. Man hat meine Arbeit nicht beachtet, das Buch wurde kaum gelesen. Doch ich weiß, dass man es später lesen wird. Die wenigen Freunde, die es heute lesen, zweifeln nicht daran.
Gegen Ende des Krieges habe ich in einer nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Zeitschrift, die der Verband österreichischer Banken und Bankiers für seine Mitglieder herausgab, einen kurzen Aufsatz über die Quantitätstheorie erscheinen lassen. Die Behandlung des Inflationsproblems wurde von der Zensur nicht geduldet. Mein zahmer, akademischer Aufsatz wurde von ihr beanstandet; ich musste ihn nochmals umarbeiten, ehe er erscheinen durfte. Im nächsten Hefte gab es auch sofort Erwiderungen, eine davon, soweit ich mich entsinnen kann, von jenem Bankdirektor Rosenbaum, der den Federnschen Volkswirt finanzierte.
Im Sommer 1918 habe ich in einem vom Armeeoberkommando eingerichteten Kurs für Offiziere, die der Truppe vaterländischen Unterricht erteilen sollten, einen Vortrag über «Kriegskostendeckung und Kriegsanleihen» gehalten. Auch da versuchte ich, den inflationistischen Tendenzen entgegenzutreten. Der Vortrag wurde nach stenografischer Mitschrift gedruckt, ohne dass mir die Gelegenheit geboten war, die Korrekturbogen zu lesen.
Die Erfahrungen der Kriegszeit haben meine Aufmerksamkeit auf ein Problem gelenkt, das mir von Tag zu Tag immer wichtiger erscheint, ja, das ich als das Haupt- und Grundproblem unserer Kultur bezeichnen will.
Die großen Fragen der Wirtschafts- und Sozialpolitik können nur von denen begriffen werden, die die nationalökonomische Theorie voll beherrschen. Ob Kapitalismus, ob Sozialismus, ob Interventionismus das geeignete System gesellschaftlicher Kooperation darstellt, kann man nur entscheiden, wenn man die schwierigsten Aufgaben der Nationalökonomie zu meistern weiß. Doch die politische Entscheidung wird nicht von den Nationalökonomen getroffen, sondern von der öffentlichen Meinung, d.h. von der Gesamtheit des Volkes; die Mehrheit bestimmt, was geschehen soll. Das gilt von jedem System der Regierung. Auch der absolute König und der Diktator können nur so regieren, wie die öffentliche Meinung es verlangt.
Ob Kapitalismus, ob Sozialismus, ob Interventionismus das geeignete System gesellschaftlicher Kooperation darstellt, kann man nur entscheiden, wenn man die schwierigsten Aufgaben der Nationalökonomie zu meistern weiß.
Es gibt Schulen, die diese Probleme einfach nicht sehen wollen. Der orthodoxe Marxismus glaubt, dass der dialektische Prozess der geschichtlichen Entwicklung die Menschheit unbewusst den notwendigen Weg, d. h. den Weg, der zu ihrem Heil führt, einschlagen lässt. Eine andere Spielart des Marxismus meint, dass die Klasse nie irren könne. Der Rassenmystizismus behauptet dasselbe von der Rasse: Die Eigenart der Rasse wisse die richtige Lösung zu finden. Die religiöse Mystik – auch dort, wo sie in weltlichem Gewande erscheint, z.B. im Führerprinzip – vertraut auf Gott: Gott werde seine Kinder nicht verlassen und durch Offenbarung oder durch die Entsendung von begnadeten Hirten sie vor dem Unheil bewahren. Doch alle diese Auswege versperrt uns die Erfahrung, die zeigt, dass verschiedene Lehren vorgetragen werden, dass auch innerhalb der einzelnen Klassen, Rassen und Völker Meinungsverschiedenheiten bestehen, dass verschiedene Männer sich mit verschiedenen Programmen um das Führeramt bewerben und dass verschiedene Kirchen mit dem Anspruch auftreten, Gotteswort zu verkünden. Man müsste blind sein, wollte man behaupten, dass die Frage, ob Kreditausweitung wirklich den Zinsfuß dauernd ermäßigen kann, durch die Berufung auf die Dialektik der Geschichte, auf das unbeirrbare Klassenbewusstsein, auf die rassische oder völkische Eigenart, auf Gotteswort oder auf das Gebot eines Führers eindeutig beantwortet werden kann.
Die Liberalen des 18. Jahrhunderts waren von einem grenzenlosen Optimismus erfüllt: Die Menschen sind vernünftig, und darum muss schließlich die richtige Meinung zum Siege gelangen. Das Licht wird die Finsternis verdrängen; die Bestrebungen der Finsterlinge, das Volk in Unwissenheit zu erhalten, um es leichter beherrschen zu können, werden den Fortschritt nicht aufhalten können. So schreitet die Menschheit, von der Vernunft aufgeklärt, einer immer höheren Vervollkommnung entgegen. Die Demokratie mit ihrer Gedanken-, Rede- und Pressefreiheit bietet Gewähr für den Erfolg der richtigen Doktrin: Lasst die Massen entscheiden, sie werden schon die zweckmäßigste Wahl treffen.
Wir können diesen Optimismus nicht mehr teilen. Der Gegensatz der wirtschaftspolitischen Doktrinen stellt an die Urteilskraft weit schwierigere Anforderungen als die Probleme, die die Aufklärung im Auge hatte: Aberglaube und Naturwissenschaft, Tyrannei und Freiheit, Privileg und Gleichheit vor dem Gesetze.
Die Massen müssen entscheiden. Gewiss, die Nationalökonomen haben die Pflicht, ihre Mitbürger aufzuklären. Doch was soll geschehen, wenn die Nationalökonomen dieser dialektischen Aufgabe nicht gewachsen sind und von den Demagogen bei den Massen ausgestochen werden? Oder wenn die Massen zu wenig intelligent sind, um die Lehren der Nationalökonomen zu erfassen? Muss man nicht den Versuch, die Massen auf den richtigen Weg zu führen, als aussichtslos ansehen, wenn man die Erfahrung machen konnte, dass Männer wie J. M. Keynes, Bertrand Russell, Harold Laski und Albert Einstein nationalökonomische Probleme nicht zu begreifen vermochten?
Muss man nicht den Versuch, die Massen auf den richtigen Weg zu führen, als aussichtslos ansehen, wenn man die Erfahrung machen konnte, dass Männer wie J. M. Keynes, Bertrand Russell, Harold Laski und Albert Einstein nationalökonomische Probleme nicht zu begreifen vermochten?
Man verkennt, worum es hier geht, wenn man von einem neuen Wahlsystem oder von der Ausgestaltung der Volksbildung Hilfe erwartet. Mit den Vorschlägen zur Abänderung der Wahlordnung will man einem Teil des Volkes die Berechtigung, bei der Wahl der Gesetzgeber und der Regierung mitzuwirken, einschränken oder ganz entziehen. Doch das wäre keine Lösung. Wenn die von einer Minderheit bestellte Regierung die Massen gegen sich hat, wird sie sich auf die Dauer nicht zu behaupten vermögen. Sie wird, wenn sie sich weigert, der öffentlichen Meinung zu weichen, durch eine Revolution gestürzt werden. Der Vorzug der Demokratie liegt gerade darin, dass sie die Anpassung des Regierungssystems und des Regierungspersonals an den Willen der öffentlichen Meinung in friedlicher Weise ermöglicht und damit den ungestört ruhigen Fortgang der gesellschaftlichen Kooperation im Staate gewährleistet. Es handelt sich hier nicht um ein Problem der Demokratie, sondern um weit mehr: um ein Problem, das unter allen Umständen und unter jeder denkbaren Verfassungsform auftritt.
Man hat gesagt, dass das Problem in der Volksbildung und Volksaufklärung liege. Doch man gibt sich argen Täuschungen hin, wenn man glaubt, dass man durch mehr Schulen und Vorträge und durch Verbreitung von Büchern und Zeitschriften der richtigen Meinung zum Siege verhelfen könne. Man kann auf diesem Wege auch Irrlehren Anhänger werben. Das Übel besteht gerade darin, dass die Massen geistig nicht befähigt sind, die Mittel zu wählen, die zu den von ihnen angestrebten Zielen führen. Dass man dem Volke fertige Urteile durch Suggestion aufdrängen kann, beweist, dass das Volk keines selbständigen Urteils fähig ist. Das ist gerade das, was die große Gefahr birgt.
So war auch ich zu jenem hoffnungslosen Pessimismus gelangt, der schon seit langem die besten Männer Europas erfüllte. Wir wissen heute aus den Briefen Jacob Burckhardts, dass auch dieser große Geschichtsschreiber sich keinen Illusionen über die Zukunft der europäischen Kultur hingab. Dieser Pessimismus hatte Carl Menger gebrochen, und er beschattete das Leben Max Webers, der mir in den letzten Monaten des Krieges, als er ein Semester an der Wiener Universität lehrte, ein guter Freund geworden war.
Es ist Temperamentsache, wie man in Erkenntnis einer unabwendbaren Katastrophe lebt.
Es ist Temperamentsache, wie man in Erkenntnis einer unabwendbaren Katastrophe lebt. Im Gymnasium hatte ich, dem alten Humanistenbrauche folgend, einen Vers Vergils zu meiner Devise erwählt: Tu ne cede malis sed contra audentior ito. Diesen Spruch habe ich mir in den bösesten Stunden des Krieges in Erinnerung gerufen. Immer wieder hatte es da Situationen gegeben, aus denen vernünftige Überlegung keinen Ausweg mehr zu finden wusste; doch ein Unerwartetes trat dazwischen, das die Rettung brachte. Ich wollte auch jetzt den Mut nicht sinken lassen. Ich wollte alles das versuchen, was der Nationalökonom versuchen kann. Ich wollte nicht müde werden zu sagen, was ich für richtig hielt. So beschloss ich, ein Buch über den Sozialismus zu schreiben. Ich hatte schon vor dem Kriege diesen Plan erwogen; nun wollte ich ihn ausführen.
Immer wieder hatte es da Situationen gegeben, aus denen vernünftige Überlegung keinen Ausweg mehr zu finden wusste; doch ein Unerwartetes trat dazwischen, das die Rettung brachte. Ich wollte auch jetzt den Mut nicht sinken lassen.
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Instituts Deutschland wieder.
Ludwig von Mises (1881 – 1973) hat bahnbrechende und zeitlose Beiträge zum systematischen Studium in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaft geleistet. Vor allem hat er die wissenschaftstheoretische Begründung für das System der freien Märkte geliefert, das auf unbedingter Achtung des Privateigentums aufgebaut ist, und er hat jede Form staatlicher Einmischung in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben als kontraproduktiv entlarvt und zurückgewiesen.
„Jeder trägt einen Teil der Gesellschaft auf seinen Schultern,” schrieb Ludwig von Mises, „niemandem wird sein Teil der Verantwortung von anderen abgenommen. Und niemand kann einen sicheren Weg für sich selbst finden, wenn die Gesellschaft sich im Untergang befindet. Deshalb muss sich jeder, schon aus eigenem Interesse heraus, mit aller Kraft in den geistigen Kampf begeben.“
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Das Ludwig von Mises Institut Deutschland e.V. setzt sich seit Jahren für die Verbreitung der Lehre der Österreichischen Schule der Nationalökonomie ein. Freiheit gibt es nicht geschenkt, sie muss stets neu errungen und erhalten werden. Bitte unterstützen Sie daher das Ludwig von Mises Institut Deutschland mit einer Spende, damit wir uns weiterhin für unser aller Freiheit einsetzen können!
Spendenkonto:
Ludwig von Mises Institut Deutschland e. V.
IBAN: DE68 7003 0400 0000 1061 78
BIC: MEFIDEMM
Merck Finck A Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch
Verwendungszweck: Spende
Titel-Foto: Adobe Stock – bearbeitet