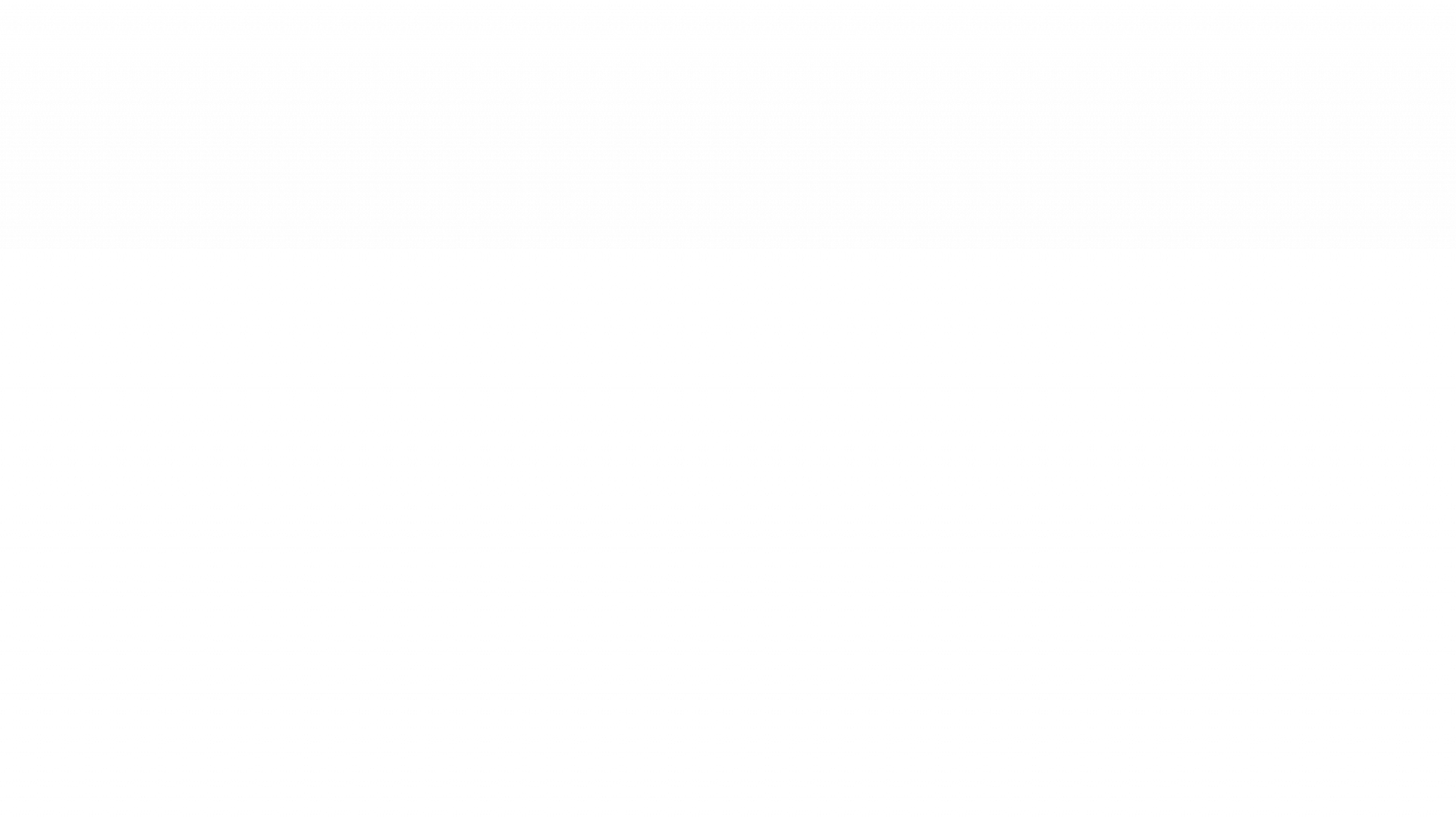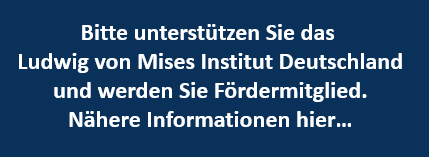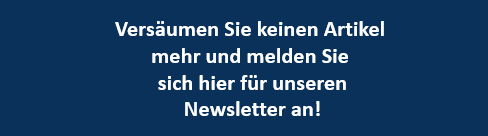Frankreichs Staatsfinanzen. Eurokrise 2.0
ZWEIFEL AN FRANKREICHS KREDITQUALITÄT WACHSEN. DIE NÄCHSTE EUROKRISE STEHT VOR DER TÜR
15. September 2025 – von Thorsten Polleit
[HIER KLICKEN, um den Beitrag als PODCAST-Folge anzuhören.]
Der Staat vermag aus dem Einkommen der Wirte Teile für die Bestreitung seiner Ausgaben herauszuziehen, er vermag für solche Verwendung auch Kapitalsteile zu enteignen oder zu leihen. Doch ist es unmöglich, dass er auf die Dauer für die Verzinsung der Schulden aufkommt.
(Ludwig von Mises, 1881 – 1973, in „Nationalökonomie“ (1940), S. 216)
Wer kennt es nicht, das Märchen „Des Kaisers neue Kleider“, 1837 vom dänischen Schriftsteller Hans Christian Andersen veröffentlicht. Ein eitler Kaiser geht Betrügern auf den Leim. Sie versprechen ihm ganz besondere Kleider — und sagen, dass die Personen, die dumm oder nicht gut genug für ihr Amt seien, die Kleider nicht sehen könnten. Die Betrüger stecken das Geld des Kaisers ein, gaukeln vor, für ihn Kleider zu schneidern und anzupassen. Doch aus Angst, als dumm oder unfähig dazustehen, trauen sich weder der Kaiser noch sein Hofstaat zu sagen, dass sie die Kleider nicht sehen können.
Ludwig von Mises Institut Deutschland Konferenz 2025
Als der Kaiser sich jedoch öffentlich in seinen neuen Kleidern zeigt (die es gar nicht gibt), ruft ein kleines Mädchen auf einmal: „Aber er hat ja nichts an!“ Das gesamte Volk stimmt ein, und die Wahrheit kommt ans Licht — dass der Kaiser nichts anhat. So wie in „Des Kaisers neue Kleider“ geht es auch zuweilen auf den Finanzmärkten zu: Obwohl es Fehlentwicklungen gibt, die für alle seit langem erkennbar sind, bleiben die Konsequenzen zunächst aus. Doch irgendwann, ausgelöst durch irgendwas, gerät der Stein dann ins Rollen, fliegt der Schwindel auf, tritt zutage, was zutage treten muss.
Das jüngste Beispiel ist Frankreich: Die Zweifel an der Kreditqualität der zweitgrößten Volkswirtschaft im Euroraum wachsen. Das zeigt sich unübersehbar in den steigenden Renditen für französische Staatsanleihen gegenüber der Rendite für deutsche Schuldpapiere: Zu Beginn 2025 lag der Zinsabstand im Laufzeitbereich von zehn Jahren bei etwa 50 Basispunkten. Nachdem S&P Global Ratings im März 2025 Frankreichs Kreditqualität herabgestuft hatte (auf AA-/A-1+), stieg der Zinsabstand gegenüber Deutschland auf 70 bis 80 Basispunkte. Im August stieg der Zinsabstand weiter auf knapp 90 Basispunkte — ein Niveau, das letztmalig im Zuge der Eurokrise 2012 zu beobachten war.
Gründe für das wachsende Misstrauen gegenüber Frankreichs öffentlicher Finanzlage finden sich zuhauf. Eine Art Auslöser war die jüngste Ankündigung von Premierminister François Bayrou, eine Vertrauensabstimmung am 8. September 2025 durchzuführen. Mittlerweile ist das eingetreten, was viele erwartet haben: Regierungssturz. Frankreich bekommt den fünften Regierungschef in zwei Jahren. Die Chance, dass Neuwahlen zu einer in dem Sinne wirkungsvollen Regierung führen, dass Frankreich seine maroden Staatsfinanzen in den Griff bekommt beziehungsweise bekommen will, ist sehr gering.
Man muss sich nicht in aller Tiefe mit der französischen Partei- und Regierungspolitik beschäftigen, wenn man das ganze Ausmaß der aktuellen Krisenlage verstehen will. Dazu reicht schon der Blick auf zwei wichtige Kennzahlen.
Die erste Kennzahl ist Frankreichs Defizit im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP). So hat die Neuverschuldung in den letzten 45 Jahren immer weiter zugelegt. In 2024 lag das Defizit bereits bei 5,8 Prozent des BIP, für 2025 werden (konservativ geschätzt) etwa 6,1 Prozent erwartet. Wenn im Zeitablauf die Neuverschuldung stärker steigt, als das BIP zulegt, dann ist die Folge: Die öffentliche Schuldlast steigt relativ zum BIP über die Jahre hinweg an.
Damit sind wir bei der zweiten Kennzahl: 1980 betrug die Staatsverschuldung relativ zum BIP noch 21,2 Prozent des BIPs, nach nahezu stetigem Anstieg lag sie 2024 bei 114 Prozent. Man erkennt: Frankreichs Staatsfinanzen führen, wenn der Trend fortgeführt wird, geradewegs und übrigens auch schneller als in anderen Euro-Volkswirtschaften, in die Überschuldung — beziehungsweise mit nun steigenden Refinanzierungszinsen wird eine Überschuldungssituation für Frankreich immer wahrscheinlicher.
Nun mag der Leser fragen: Warum gerät gerade Frankreich ins Fadenkreuz der Finanzmärkte? Steht Italien mit einem Schuldenstand von 135,3 Prozent nicht viel schlechter da? Nun, Italiens Defizit-pro-BIP-Quote lag 2024 „nur“ bei 3,6 Prozent, und vor allem zeigt Italien keinen so dramatischen Trend in Richtung immer höherer Defizitquoten, wie er in Frankreich (seit Jahr und Tag) zu beobachten ist.
Wohlgemerkt: Wachsende Zweifel an Frankreichs Staatsfinanzen können selbstverständlich überschwappen auf andere Euro-Staaten, und Italien könnte durchaus der nächste Dominostein sein, der „umfällt“. Damit geriete natürlich sogleich auch das Euro-Bankensystem ins Trudeln, weil die Euro-Banken und Euro-Staatsschulden eng miteinander verwoben sind.
Es stellt sich die Frage: Was sind die Folgen, wenn die Finanzmärkte die französische Kreditqualität immer weiter anzweifeln? Nun, die Rendite auf Frankreichs Staatsanleihen steigt dann weiter. Das wiederum verteuert die Kreditkosten und verschlechtert damit Frankreichs Schuldentragfähigkeit — und die Renditeforderungen der Investoren bei französischen Staatsanleihen steigen noch weiter.
Um hier den Weg in den Staatsbankrott noch abwehren zu können, müssten die Franzosen ihre Neuverschuldung (drastisch) zurückführen: Der Staat muss weniger ausgeben und/oder mehr einnehmen (durch Privatisierungen, Steuern, durch weitere Enteignungen der Bürger). Hoffnungsvoll kann man nicht sein: In den letzten 45 Jahren haben die Franzosen ihren Staatshaushalt nicht einmal ausgeglichen, sind den Weg in immer höhere Defizit- und Schuldenquoten im Verhältnis zum BIP gegangen.
In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass mittlerweile die französischen Staatsausgaben relativ zum BIP bei etwa 57 Prozent angekommen sind — man ist damit de facto im (Neo-)Sozialismus gelandet. Frankreichs Staatsschulden belaufen sich dabei auf 3.350 Mrd. Euro. Der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM), 2012 ins Leben gerufen, reicht sicherlich nicht aus, Frankreich aus der Patsche zu helfen: Er verfügt über ein Kreditvergabevolumen von „nur“ 700 Mrd. Euro (mehr zum ESM hier).
Eine Finanzkrise Frankreichs wird daher wohl die Europäische Zentralbank (EZB) auf den Plan rufen — und das wissen vermutlich auch alle französischen Politiker und Parteien, und entsprechend gering ist auch ihr Reformeifer. Denn sie können zwei Hilfestellungen erwarten.
Zum einen läuft die Amtszeit der französischen EZB-Präsidentin Christine Lagarde noch bis zum 31. Oktober 2027; Lagarde und ihren Helfern verbleibt deswegen noch genug Zeit, ihr Heimatland vor dem Bankrott zu bewahren. Zum anderen hat sich der Rat der EZB längst (in „weiser Voraussicht“ möchte man sagen) ein Instrument an die Hand gegeben, um Krisenlagen wie etwa den drohenden Staatsbankrott eines Euro-Mitgliedlandes abzuwehren. Es lautet: „Transmissionsschutzinstrument“ (englisch: „Transmission Protection Instrument“, kurz: „TPI“).
Mit dem TPI hat sich der EZB-Rat im Juli 2022 quasi selbstermächtigt, gezielt und unbegrenzt Staatsanleihen einzelner Euro-Länder aufkaufen zu können, um die Kreditzinsen für deren Anleihen zu senken. Mit dem TPI kann der EZB-Rat gewissermaßen „still und heimlich“ Euro-Staatsanleihen kaufen, und die Öffentlichkeit erfährt davon nichts — oder wenn überhaupt, dann (viel) zu spät.
Das wirklich Tückische dabei ist: Da der EZB-Rat das TPI einsetzen kann (und zwar im Grunde wann immer er es will), muss er nicht einmal Anleihen tatsächlich kaufen, um die beabsichtigte Wirkung auf Anleihekurse und -renditen zu erzielen. Wenn zum Beispiel die Handelstische der Großbanken der Auffassung sind, die EZB-Räte werden die Rendite für französische Staatsanleihen nicht um mehr als, sagen wir, 80 Basispunkte gegenüber deutschen Staatsanleihen ansteigen lassen (weil ein EZB-Rat das den Großbankvorständen bei einem Sektempfang zugeraunt hat), dann wird die Rendite für französische Staatsanleihen auch nicht mehr als 80 Basispunkte betragen. Anders gesagt: Die Manipulation der Marktzinsen erfordert nicht notwendigerweise effektive Anleihekäufe durch die EZB.
Und folglich sind auch die Zinsabstände zwischen französischen und deutschen Staatsanleihen mit allergrößter Vorsicht zu interpretieren: Die EZB-Räte können in Krisenphasen nicht nur französische, sondern auch deutsche und/oder italienische Staatsanleiherenditen in ihrem Sinne manipulieren. Dadurch wird nicht nur die Renditehöhe, sondern es werden auch die Renditeabstände zwischen unterschiedlichen Staatsschuldnern verzerrt, beziehungsweise Renditen und Zinsabstände verlieren ihre Signalfunktion für den Investor.
Man fragt sich: Warum gerade jetzt? Ist eine Krise französischer Staatsanleihen etwa politisch initiiert? Ganz abwegig ist das nicht: Eine Krise lässt sich bekanntlich politisch nutzen. Sie erlaubt es den EU-Befürwortern, drastische Maßnahmen, Notmaßnahmen einzuführen, die ihnen bei ihrem Plan helfen, so etwas wie die „Vereinigten Staaten von Europa“ aus der Taufe zu heben. Oder will man vielleicht die EZB endgültig einsetzen, um die Überschuldung der Euro-Staaten mit einer Inflationierung aus der Welt zu schaffen?
Man kann darüber viel spekulieren. Ganz wichtig ist an dieser Stelle für die Investoren jedoch die Antwort auf die Frage: Erhöhen die EZB-Räte die Geldmenge oder nicht? Folgende Szenarien sind zu bedenken:
(1.) Wenn es den EZB-Räten gelingt, die Rendite der (französischen) Staatsanleihen allein durch Verlautbarungen niedrig zu halten (indem sie beispielsweise bedeutsame Investoren in ihre Pläne einweihen, und die Investoren sich auf die informellen Versprechungen der EZB-Räte einlassen), dann bleibt der Schein erhalten: Und die Renditen der Staatsanleihen bleiben niedrig.
(2.) Wenn die EZB-Räte Staatsanleihen kaufen müssen, weil sie sonst die Investoren nicht davon überzeugen können, an ihren Staatsanleihen festzuhalten, dann steigt unweigerlich die (Basis-)Geldmenge im Euroraum. Das wiederum kann zwei Folgen haben:
(a) Die EZB-Räte kaufen nur relativ wenige Euro-Staatsanleihen, doch das genügt, um die Kreditmärkte zu beruhigen. Die Krise wird und bleibt eingehegt. Der Inflationseffekt ist nur relativ gering.
(b) Angesichts der EZB-Anleihekäufe werfen die Investoren ihre Anleihen zuhauf auf den Markt, weil sie steigende Inflation befürchten. Die EZB erhöht daraufhin ihre Anleihekäufe. Es kommt zu einer Abwärtsspirale: Fallende Anleihekurse, steigende Inflation, eine Flucht aus Euro-Anleihen setzt ein. Die EZB verursacht letztlich Hoch- beziehungsweise Hyperinflation.
Mit was ist zu rechnen? Aus gegenwärtiger Sicht scheint es nicht sehr wahrscheinlich zu sein, dass die französische Staatsschuldenkrise abebbt, sich in Wohlgefallen auflöst — denn die Zweifel an der finanziellen Solidität Frankreichs sind nur allzu berechtigt. Auch sind Ansteckungseffekte auf andere Schuldner im Euroraum (zu denken ist an Italien) und anderswo (zum Beispiel Großbritannien, Japan) oder das Euro-Bankensystem nicht auszuschließen.
Ein großangelegter Eingriff der EZB-Räte in die Euro-Kreditmärkte wäre nicht verwunderlich — und das wäre absehbar verbunden mit weiteren Zinssenkungen, Anleihekäufen und einer neuerlichen und beträchtlichen Ausweitung der Euro-Geldmenge. Euro-Anleger haben also gute Gründe, mit einer fortgesetzten, sich künftig wieder beschleunigenden Geldentwertung zu rechnen, auch wenn sich die Güterpreissteigerungen in den letzten Monaten etwas verlangsamt haben.
Und so kommen wir zu „Des Kaisers neue Kleider“ zurück: Auch wenn es den EZB-Räten gelingt, die Realität für gewisse Zeit zu verschleiern, sie scheinbar hinfortzumanipulieren, so wird sie doch früher oder später zutage kommen. Die Tatsache, dass der Staatskredit zusehends in Misskredit gerät, angefangen in Frankreich, sollte wirklich niemanden überraschen — und auch nicht, dass die nächste Eurokrise vor der Tür steht.
*****
Dieser Artikel ist aus Dr. Polleits BOOM & BUST REPORT: www.boombustreport.com
 Professor Dr. Thorsten Polleit war als Ökonom 15 Jahre im internationalen Investment-Banking tätig und danach 12 Jahre im internationalen Edelmetallhandelsgeschäft. Er ist zudem seit 2014 Honorarprofessor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth. Thorsten Polleit ist Adjunct Scholar Mises Institute, Auburn, Alabama, Mitglied im Forschungsnetzwerk „ROME“ und Präsident des Ludwig von Mises Institut Deutschland. Im Jahr 2012 erhielt er den The O.P. Alford III Prize In Political Economy. Thorsten Polleit ist Autor zahlreicher Aufsätze in referierten Journals, Magazinen und Zeitungen. Seine letzten Bücher sind: „Des Teufels Geld. Der faustische Fiatgeld-Pakt – wie wir ihn kündigen und zu gutem Geld zurückkehren“(*) (Oktober 2023), „The Global Currency Plot. How the Deep State Will Betray Your Freedom, and How to Prevent It“(*) (2023), „Ludwig von Mises. Der kompromisslose Liberale“(*) (2022) und „Der Weg zur Wahrheit. Eine Kritik der ökonomischen Vernunft“(*) (2022). Hier Thorsten Polleit auf Twitter folgen.
Professor Dr. Thorsten Polleit war als Ökonom 15 Jahre im internationalen Investment-Banking tätig und danach 12 Jahre im internationalen Edelmetallhandelsgeschäft. Er ist zudem seit 2014 Honorarprofessor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth. Thorsten Polleit ist Adjunct Scholar Mises Institute, Auburn, Alabama, Mitglied im Forschungsnetzwerk „ROME“ und Präsident des Ludwig von Mises Institut Deutschland. Im Jahr 2012 erhielt er den The O.P. Alford III Prize In Political Economy. Thorsten Polleit ist Autor zahlreicher Aufsätze in referierten Journals, Magazinen und Zeitungen. Seine letzten Bücher sind: „Des Teufels Geld. Der faustische Fiatgeld-Pakt – wie wir ihn kündigen und zu gutem Geld zurückkehren“(*) (Oktober 2023), „The Global Currency Plot. How the Deep State Will Betray Your Freedom, and How to Prevent It“(*) (2023), „Ludwig von Mises. Der kompromisslose Liberale“(*) (2022) und „Der Weg zur Wahrheit. Eine Kritik der ökonomischen Vernunft“(*) (2022). Hier Thorsten Polleit auf Twitter folgen.
[(*) Mit * gekennzeichnete Links sind Partner-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, unterstützen Sie das Ludwig von Mises Institut Deutschland, das mit einer Provision beteiligt wird. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten.]
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Instituts Deutschland wieder.
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Das Ludwig von Mises Institut Deutschland e.V. setzt sich seit Jahren für die Verbreitung der Lehre der Österreichischen Schule der Nationalökonomie ein. Freiheit gibt es nicht geschenkt, sie muss stets neu errungen und erhalten werden. Bitte unterstützen Sie daher das Ludwig von Mises Institut Deutschland mit einer Spende, damit wir uns weiterhin für unser aller Freiheit einsetzen können!
Spendenkonto:
Ludwig von Mises Institut Deutschland e. V.
IBAN: DE68 7003 0400 0000 1061 78
BIC: MEFIDEMM
Merck Finck A Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch
Verwendungszweck: Spende
Titel-Foto: Adobe Stock – bearbeitet