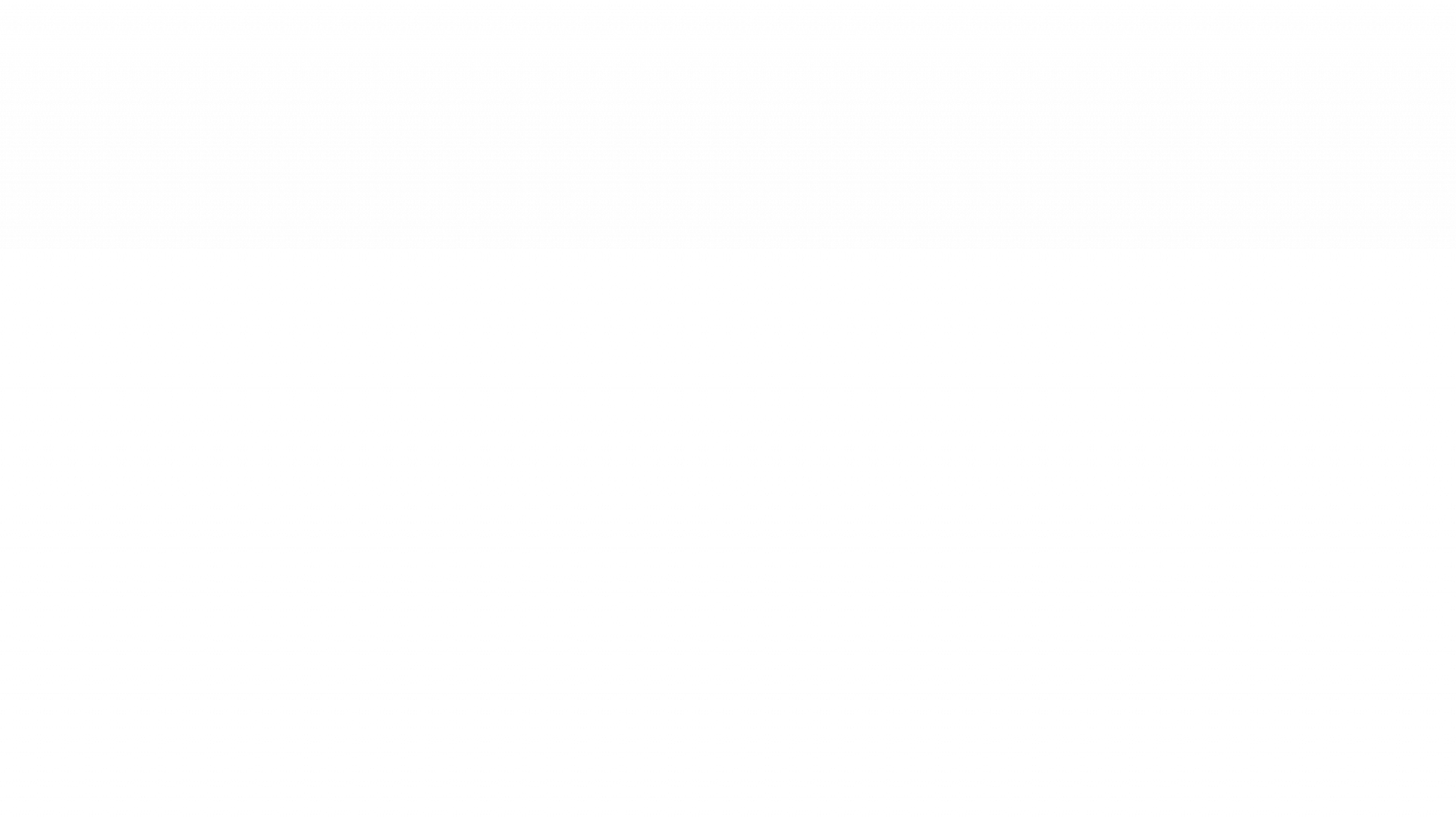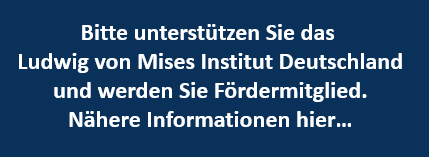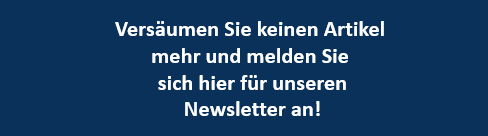Demokratie, Parteienkartell und Diktatur
Ein erster Theorieentwurf, angelehnt an deutsche Verhältnisse
11. August 2025 – von Thorsten Polleit
[Jetzt HIER KLICKEN, um den Beitrag als PODCAST-FOLGE anzuhören.]
Viele Menschen beklagen sich: Es stimmt etwas nicht, es ist (frei nach William Shakespeare) etwas faul im Staate. Der Wählerwille manifestiert sich nicht in der Regierungspolitik. Wahlen bewirken keinen politischen Richtungswechsel. Trügt der Eindruck? Oder ist die Beschwerde gerechtfertigt? Um eine Antwort auf diese Fragen zu finden, wird in diesem Artikel eine Theorieskizze entworfen, mit der sich eine solche Klage begründen lässt. Sie zeigt auf, dass die moderne (Mehrheits-)Demokratie in eine (Parteien-)Diktatur führt. Der Weg lässt sich in Kurzform wie folgt zusammenfassen:
– Demokratien entwickeln sich zu „Parteienstaaten“: Die etablierten Parteien, nicht die Wähler, sind es über kurz oder lang, die die Hoheit über die Staatsmacht innehaben.
– Denn es bildet sich ein „Parteienkartell“ heraus, das neue politische Wettbewerber und damit einen echten Politikwechsel verhindert.
– Die Wähler haben keine wirksame Kontrolle und Sanktionierungsmöglichkeiten (mehr) über die Entscheidungen der gewählten Parteienkartell-Politiker.
– Politiker fühlen sich immer weniger an den Wählerauftrag gebunden, haben vielmehr wachsende Anreize, sich in den Dienst von Sonderinteressengruppen zu stellen.
– Der Drang zur Machtausdehnung des (Parteikartell-)Staates lässt sich nicht (mehr) wirksam begrenzen, er wird durch den Einfluss von Sonderinteressengruppen noch verstärkt.
– Die Wahrscheinlichkeit für Krieg steigt, wenn der Staat finanziell überschuldet ist; verstärkt wird sie durch das Agieren von Sonderinteressengruppen und den chronischen Drang staatlicher Machtausweitung.
Die Erklärung für diese Aussagen beginnt mit der Einsicht in das, was der Staat, wie wir ihn heute kennen, tatsächlich ist, und was er macht. Fragen wir also: Was ist der Staat? Das Wort Staat hat für unterschiedliche Personen in der Regel eine unterschiedliche Bedeutung. Einige verstehen unter dem Staat „Vater Staat“, einen „wohlmeinenden Diktator“, andere denken „Der Staat sind WIR“, er stehe stellvertretend für „die Gemeinschaft der Menschen“, für wieder andere ist der Staat ein notwendiges Übel, und einige sehen im Staat sogar etwas ganz und gar Schlechtes: einen „Unterdrücker“, einen „Plünderer“.
Verwenden wir an dieser Stelle eine positive Definition des Staates (eine also, die sagt, was der Staat tatsächlich ist, und was er tut). Sie lautet: Der Staat ist der territoriale Zwangsmonopolist mit der Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte auf seinem Gebiet, und er räumt sich zudem das Recht ein, Steuern zu erheben.
Solch ein Staat kann angeführt werden durch einen Feudalherren, König oder Kaiser oder auch durch demokratisch gewählte Personen aus dem Volk. In den modernen (Mehrheits-)Demokratien des Westens ist Letzteres der Fall. Die Wähler wählen Parteien beziehungsweise Personen, von denen sie erwarten, dass diese sie im Parlament vertreten, dass sie als Minister, Kanzler oder Präsidenten die Staatsgeschäfte im Sinne des vermeintlichen Souveräns, also der Mehrheit der Wähler, führen.
In der (Mehrheits-)Demokratie ist nun allerdings nicht garantiert, dass die Wünsche der Wähler von den Gewählten, wie vor der Wahl versprochen, auch erfüllt werden. Man könnte nun hoffen: Wenn die Gewählten sich nicht bewähren, unerwünschte Dinge tun, dann bleibt den enttäuschten Wählern die Möglichkeit, in der nächsten Wahl andere Parteien und Personen zu wählen, von denen sie sich erhoffen, dass diese sie besser behandeln werden.
Doch eben die Hoffnung ist trügerisch: Denn ist der Wettbewerb in der Parteienlandschaft beschränkt, können die etablierten Parteien die wählbaren Personen und Programme abschließend festlegen; die Wähler haben dann nur noch eine begrenzte Auswahl. Und genau das ist nun das Problem, das mit dem Wort „Parteienkartell“ bezeichnet wird: Etablierte Parteien kooperieren miteinander, verhindern, dass „neue Anbieter“ nicht oder nur sehr schwer ins Parlament gelangen. In Deutschland wird beispielsweise durch eine „Sperrklausel“, eine „5-Prozent- Hürde“, kleinen Parteien der Zugang ins Parlament verunmöglicht.
Wie alle, die im „Markt für Politik“ operieren, wird auch ein Parteienkartell alles daransetzen, die öffentliche Meinung für sich einzunehmen. Vorzugsweise indem es die Presse beeinflusst beziehungsweise beherrscht, die Medien durch Zwangsbeiträge, die nur der Staat eintreiben kann, oder mittelbar mit Steuergeldern durch Fördergelder, „Werbeanzeigen“ und dergleichen „beauftragt“, die Parteien des Kartells und ihre Repräsentanten als gut und richtig aussehen zu lassen, gleichzeitig konkurrierende politische Anbieter zu diskreditieren, inakzeptabel und damit unwählbar zu machen.
In einer solchen Situation eines „gehemmten Wettbewerbs“ können die etablierten Parteien recht bequem Absprachen miteinander treffen, ihre Politikprogramme „harmonisieren“, Koalitionen eingehen und damit die Macht über die Staatsgewalt fest in ihren Händen behalten; also eben ein Parteienkartell bilden, das sich die Verfügung über die Staatsgewalt sprichwörtlich unter den Nagel reißt. Unter diesen Bedingungen können dann auch Sonderinteressengruppen in wirksamer Weise Einfluss auf die politischen Entscheidungen nehmen. So werden etwa Politiker regelmäßig im Zuge der „Lobby-Arbeit“ von Unternehmen beeinflusst, um politische Entscheidungen (über zum Beispiel Regulierung, Besteuerung, Subventionierung, Bestellung von Rüstungsgütern etc.) in ihrem Sinne zu treffen.
Dass Politiker dafür Geld von den Sonderinteressengruppen bekommen (in Form von Spenden, Zuwendungen, gut bezahlten Vortragshonoraren, dass ihnen finanziell attraktive Positionen nach Niederlegung ihres Mandates in Aussicht gestellt werden etc.), dass also, wenn auch nicht formaljuristisch, aber im ökonomischen Sinne „Bestechung in großem Stil“ stattfindet, darf man getrost als „Arbeitshypothese“ annehmen. Denn wer will schon sagen, was „zulässige Zuwendungen“ sind und was nicht, wenn das Ganze geschickt gemacht und abgewickelt wird? Und meistens gilt: Wo kein Kläger, da kein Richter.
[(*) Mit * gekennzeichnete Links sind Partner-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, unterstützen Sie das Ludwig von Mises Institut Deutschland, das mit einer Provision beteiligt wird. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten.]
Es ist also alles andere als eine an den Haaren herbeigezogene Vermutung, dass in modernen Demokratien nicht die Mehrheit der Wähler, sondern ein Parteienkartell und damit letztlich auch Sonderinteressengruppen (wie Big Business, Big Banking, Big Pharma, Big Tech etc.) maßgeblichen Einfluss auf die Politik nehmen (können) — weil der Wähler de facto entmachtet ist, die Möglichkeit einer „Abwahl des Systems“, eine Befreiung vom Parteienkartell kaum oder gar nicht mehr besteht.
Wenn unter diesen Bedingungen sich auch noch die Sonderinteressengruppen ihrerseits eng miteinander international koordinieren, wie das beispielsweise im World Economic Forum (WEF) geschieht oder im Pharmabereich bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dann werden die demokratischen Systeme der Einzelstaaten und mit ihnen die gutgläubigen (und meist wohl ahnungslosen) Wähler nur allzu leicht zu ihrem Spielball. Auf diesem Wege können natürlich auch ideologische Programme (wie der „Great Reset“) in die Staatspolitik eingeschleust werden, ohne dass dafür die ausdrückliche Zustimmung der Wähler erforderlich wäre.
So gesehen kann es auch nicht verwundern, dass vor allem die Vereinigten Staaten von Amerika — ein wirklich großer Staat, ein „Tiefer Staat“ — sich nahezu fortwährend in einer aggressiven, kriegerischen Außenpolitik befinden. Die US-Administrationen stehen nicht nur stark unter dem Einfluss des militärisch-industriellen Komplexes, sondern vor allem auch externer Interessengruppen — wie beispielsweise der aktuellen israelischen Netanjahu-Administration (wie die jüngste Intervention der USA im Israel-Iran-Konflikt unmissverständlich dokumentiert).
Neben der „Zweckentfremdung“ des Staates (wie wir ihn heute kennen) durch Sonderinteressengruppen gibt es ein weiteres Problem: Aus theoretischen Überlegungen weiß man, dass der Staat (wie wir ihn heute kennen) immer größer und mächtiger wird. Warum? Nun, Politiker und Bürokraten streben nach Einfluss und Machtausweitung. Und die Befugnis zur Verwendung der Steuergelder versetzt die Regierenden in die Position, sich die Zustimmung der Wähler zu einer Tätigkeits- und Machtausweitung des Staates quasi zu erkaufen.
Dazu werden die (in der Regel zahlenmäßig wenigen) Leistungsfähigen besteuert und die Steuereinahmen an die (vielen) von den Regierenden Begünstigten weitergereicht (nachdem sich die Regierenden großzügig versorgt haben, versteht sich). Vor allem aber verschulden sich die Regierenden im Namen des Staates. Denn auf diese Weise lassen sich sehr große Geldbeträge beschaffen, ohne dass das auf großen Widerstand in der Öffentlichkeit treffen würde: Die Sparer leihen dem Staat schließlich gern ihr Geld gegen einen Zins. Und so steigt die Staatsverschuldung im Zeitablauf (von Regierung zu Regierung) immer weiter an. Und zwar nicht nur in absoluten Zahlen, sondern auch im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung.
Warum? Nun, weil der Großteil der mit Schulden finanzierten Staatsausgaben für unproduktive Zwecke ausgegeben wird (Gehälter und Pensionen für Politiker, Sozialtransfers etc.). Und folglich wächst der Staatsschuldenberg schneller in die Höhe, als die Wirtschaftsleistung zunimmt. Das Ganze entwickelt sich, wird es nicht gestoppt und umgekehrt, in Richtung Staatsbankrott — der dann in Zahlungsausfällen und/oder in einer inflationären Geldmengenvermehrung durch die Zentralbank zutage tritt.
Droht der Staat zu überschulden, werden die Probleme, die es zu lösen gilt, so erdrückend, dass kein Politiker sie anfassen will (wie insbesondere die Staatsausgaben zu kürzen), steigt der Anreiz für das Parteienkartell, eine Situation herbeizuführen, die vom eigenen Versagen, vom „Systemversagen“ ablenkt. Dazu eignen sich insbesondere Notsituationen. Kriegerische außenpolitische Verwicklungen können daher den Politikern durchaus willkommen sein — solche, die sich unerwartet ergeben, aber auch solche, die bewusst angezettelt werden. Denn allein schon die Aussicht auf einen drohenden Krieg versetzt die Bevölkerung üblicherweise in Angst und Schrecken, macht sie gefügig, die Menschen ordnen sich den Weisungen und Vorgaben der Regierung widerstandslos unter.
Den Regierenden und ihren Bürokraten eröffnen sich angesichts einer Kriegsgefahr, geschweige denn im Krieg selbst, gewaltige Machtzuwächse. So lassen sich Eingriffe in Wirtschaft und Gesellschaft durchführen, Dinge werden plötzlich möglich, die in Friedenszeiten undenkbar wären, die die Politiker in Friedenszeiten nicht wagen würden (wie zum Beispiel das Außerkraftsetzen von Grundrechten).
Vor allem eine noch größere Ausweitung der Staatsverschuldung zur Finanzierung der Kriegsvorbereitung wird ohne große Widerstände möglich. Im Gegenteil. Für weite Teile der Bevölkerung verbessert sich durch zusätzliche Rüstungsausgaben ihre wirtschaftliche Lage zunächst einmal: Eine Sonderkonjunktur stellt sich ein. Die Nachfrage nach Kriegsgütern lässt die Auftragsbücher der Firmen anschwellen. Die Unternehmensgewinne steigen, die Beschäftigungslage verbessert sich. Und erst mit zeitlicher Verzögerung zeigt sich dann, dass die gesamtwirtschaftliche Produktion überdehnt wird.
Engpässe treten zutage. Denn der Staat lenkt ja durch seine Kriegsgüterproduktion knappe Ressourcen verstärkt von der Konsumgüter- in die Kriegsgütererzeugung. Die Versorgungslage der Menschen verschlechtert sich: Die Güter des täglichen Lebens werden knapper und teurer. Doch wenn die Kosten der Kriegswirtschaft zutage treten, dann ist eine Umkehr kaum mehr möglich — schließlich, so wird die staatliche Propaganda verkünden, müsse Verzicht geleistet werden, damit die Verteidigung oder auch das Kriegsgeschäft gelingen kann.
Die Volkswirtschaft verfällt in eine Art „Kriegssozialismus“. Fortan läuft alles darauf hinaus, Wirtschaft und Gesellschaft stärker denn je auf die Belange des Staates auszurichten. Die Unternehmer werden dabei zu Beauftragten, zu Befehlsempfängern degradiert, denen vom Staat befohlen wird, was und wie sie zu erzeugen haben, wo und zu welchem Preise sie Produktionsmittel zu erwerben und an wen und zu welchem Preis sie ihre Produkte zu verkaufen haben.
Der Kriegssozialismus war nur die Fortsetzung der schon lange vor dem Kriege eingeleiteten staatssozialistischen Politik in einem beschleunigten Tempo. Von Anfang an bestand bei allen sozialistischen Gruppen die Absicht, nach dem Kriege keine der im Kriege getroffenen Maßnahmen fallen zu lassen, vielmehr auf dem Weg zur Vollendung des Sozialismus fortzuschreiten.
— Ludwig von Mises
Solange die Kriegswirtschaft nur einen recht kleinen Teil des gesamten Wirtschaftssystems ausmacht, bleiben die genannten Schäden begrenzt. Doch natürlich expandiert auch die Kriegswirtschaft — schließlich profitieren von der Rüstungsproduktion nicht nur Firmen, auch der politische Apparat steht auf der Gewinnerseite. Mit der verbliebenen Zurückhaltung ist es natürlich ganz vorbei, wenn die Kriegshandlungen tatsächlich einsetzen. Der moderne Krieg ist nämlich zwangsläufig „total“, zieht die gesamte Bevölkerung in Mitleidenschaft, erlaubt der Kriegswirtschaft zu wachsen, immer bedeutsamer für die Volkswirtschaft zu werden.
Der Staat wird die Kriegswirtschaft vor allem mit neuen Schulden finanzieren wollen. Dazu spannt er seine Zentralbank ein, die – zusammen mit dem „angeschlossenen“ Finanzsektor – für niedrige Zinsen und eine üppige Kredit- und Geldmengenausweitung sorgt. Die ansteigende Geldmenge, verbunden mit steigenden Engpässen in der Produktion, treibt die Güterpreise in die Höhe, sorgt für Güterpreisinflation. Um die Härten für die Bevölkerung abzumildern, greift der Staat zu Preiskontrollen: Er erlässt Höchstpreise für besonders knappe Güter (und stellt harte Strafen in Aussicht für die, die die Güter zu Preisen handeln, die die offiziellen Höchstpreise übersteigen). Der Staat führt möglicherweise auch eine Rationierung ein: Jeder Nachfrager bekommt pro Zeiteinheit nur eine bestimmte Menge (und nicht mehr) eines Konsumguts (zugeteilt).
Und damit ist das Wenige, was von der Marktwirtschaft noch übrig war, auch noch zerstört. Denn ist der Preismechanismus erst einmal ausgehebelt, gibt es keine rationale Möglichkeit mehr, die knappen Ressourcen in die für die Konsumenten drängendsten Verwendungen zu leiten. Der Staat geht dann vielmehr dazu über, Produktion und Beschäftigung zu diktieren. Das Ergebnis ist eine Lenkungs- und Befehlswirtschaft, in der der Staat im wahrsten Sinne des Wortes allmächtig ist, die Bürger ihm vollends untergeordnet sind. Man sieht: Gerade die „Notsituation“ Kriegsgefahr oder Krieg kann nur allzu leicht das Ende der freien Gesellschaft und Wirtschaft (oder was davon heute noch übrig ist) bedeuten, eine Parteiendiktatur aus der Taufe heben.
Der Königsberger Philosoph der Aufklärung, Immanuel Kant (1724–1804), erkannte bereits sehr genau das Problem, wenn die Herrschenden über Krieg und Frieden befinden können, ohne auf die Stimme der Betroffenen zu achten, beziehungsweise wenn die vom Krieg und dem daraus folgenden Leid Betroffenen nicht die eigentlichen Entscheider sind. In seiner Schrift „Zum ewigen Frieden“ (1795) schrieb er:
Wenn … die Bestimmung der Staatsbürger dazu erfordert wird, um zu beschließen, ob Krieg sein solle, oder nicht, so ist nichts natürlicher, als daß, da sie alle Drangsale des Krieges über sich selbst beschließen müßten (als da sind: selbst zu fechten, die Kosten des Krieges aus ihrer eigenen Habe herzugeben; die Verwüstung, die er hinter sich läßt, kümmerlich zu verbessern; zum Übermaße des Übels endlich noch eine den Frieden selbst verbitternde, nie (wegen naher, immer neuer Kriege) zu tilgende Schuldenlast selbst zu übernehmen), sie sich sehr bedenken werden, ein so schlimmes Spiel anzufangen.
Eine Demokratie, die ein Parteienkartell hervorbringt, das die Wähler de facto entmachtet, in der also Parteikartellpolitiker ohne „Skin in the Game“ und Sonderinteressengruppen das Sagen haben, ist sicherlich nicht das, was sich die meisten Menschen von einer Demokratie erwarten. Aber es ist nun einmal, so deutet die vorgestellte, an deutsche Verhältnisse angelehnte Theorieskizze an, kein unmöglicher Entwicklungspfad. Er wird sogar sehr wahrscheinlich, sobald der Staat über ein gewisses Maß hinaus angewachsen ist, dass die Parteien die Institutionen (wie zum Beispiel Bildung, Presse, Rechtsprechung und Vollstreckungsorgane) für ihre Zwecke einnehmen, ein Parteienkartell, sogar eine Parteiendiktatur bilden.
Wie kann ein Gemeinwesen einer solchen Situation entkommen? Wohl nur durch ein „großes Erwachen“, eine weitreichende Aufklärung, durch die die Menschen zur Erkenntnis gelangen, dass keiner das Recht hat, friedvollen Menschen Zwang und Gewalt anzutun; und dass auch niemand seinen eigenen Willen seinen Mitmenschen entgegen ihrer Zustimmung aufoktroyieren darf. Und wird das wirklich verstanden, schwindet auch die Akzeptanz, die Duldung von Staat (wie wir ihn heute kennen), Parteien, Politikern und Bürokraten, von Täuschung, Lug und Trug, Ausbeutung und Gängelung — und die Welt wird produktiver und friedvoller.
 Professor Dr. Thorsten Polleit war als Ökonom 15 Jahre im internationalen Investment-Banking tätig und danach 12 Jahre im internationalen Edelmetallhandelsgeschäft. Er ist zudem seit 2014 Honorarprofessor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth. Thorsten Polleit ist Adjunct Scholar Mises Institute, Auburn, Alabama, Mitglied im Forschungsnetzwerk „ROME“ und Präsident des Ludwig von Mises Institut Deutschland. Im Jahr 2012 erhielt er den The O.P. Alford III Prize In Political Economy. Thorsten Polleit ist Autor zahlreicher Aufsätze in referierten Journals, Magazinen und Zeitungen. Seine letzten Bücher sind: „Des Teufels Geld. Der faustische Fiatgeld-Pakt – wie wir ihn kündigen und zu gutem Geld zurückkehren“(*) (Oktober 2023), „The Global Currency Plot. How the Deep State Will Betray Your Freedom, and How to Prevent It“(*) (2023), „Ludwig von Mises. Der kompromisslose Liberale“(*) (2022) und „Der Weg zur Wahrheit. Eine Kritik der ökonomischen Vernunft“(*) (2022). Die Website von Thorsten Polleit ist: www.thorsten-polleit.com. Hier Thorsten Polleit auf Twitter folgen.
Professor Dr. Thorsten Polleit war als Ökonom 15 Jahre im internationalen Investment-Banking tätig und danach 12 Jahre im internationalen Edelmetallhandelsgeschäft. Er ist zudem seit 2014 Honorarprofessor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth. Thorsten Polleit ist Adjunct Scholar Mises Institute, Auburn, Alabama, Mitglied im Forschungsnetzwerk „ROME“ und Präsident des Ludwig von Mises Institut Deutschland. Im Jahr 2012 erhielt er den The O.P. Alford III Prize In Political Economy. Thorsten Polleit ist Autor zahlreicher Aufsätze in referierten Journals, Magazinen und Zeitungen. Seine letzten Bücher sind: „Des Teufels Geld. Der faustische Fiatgeld-Pakt – wie wir ihn kündigen und zu gutem Geld zurückkehren“(*) (Oktober 2023), „The Global Currency Plot. How the Deep State Will Betray Your Freedom, and How to Prevent It“(*) (2023), „Ludwig von Mises. Der kompromisslose Liberale“(*) (2022) und „Der Weg zur Wahrheit. Eine Kritik der ökonomischen Vernunft“(*) (2022). Die Website von Thorsten Polleit ist: www.thorsten-polleit.com. Hier Thorsten Polleit auf Twitter folgen.
[(*) Mit * gekennzeichnete Links sind Partner-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, unterstützen Sie das Ludwig von Mises Institut Deutschland, das mit einer Provision beteiligt wird. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten.]
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Instituts Deutschland wieder.
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Das Ludwig von Mises Institut Deutschland e.V. setzt sich seit Jahren für die Verbreitung der Lehre der Österreichischen Schule der Nationalökonomie ein. Freiheit gibt es nicht geschenkt, sie muss stets neu errungen und erhalten werden. Bitte unterstützen Sie daher das Ludwig von Mises Institut Deutschland mit einer Spende, damit wir uns weiterhin für unser aller Freiheit einsetzen können!
Spendenkonto:
Ludwig von Mises Institut Deutschland e. V.
IBAN: DE68 7003 0400 0000 1061 78
BIC: MEFIDEMM
Merck Finck A Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch
Verwendungszweck: Spende
Titel-Foto: Adobe Stock – bearbeitet