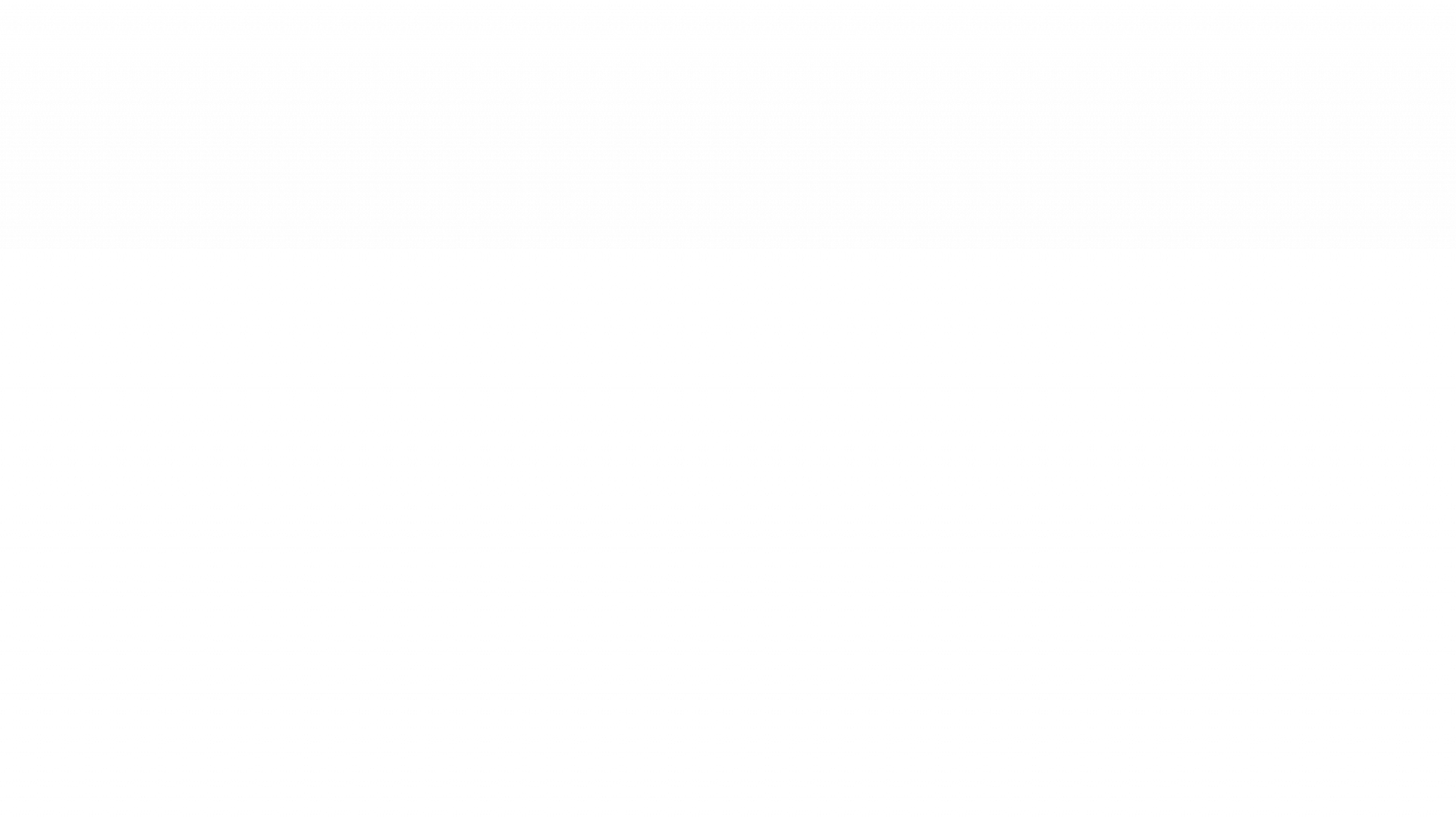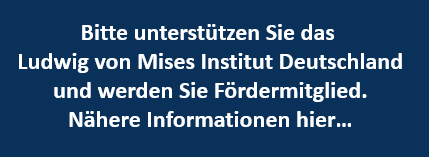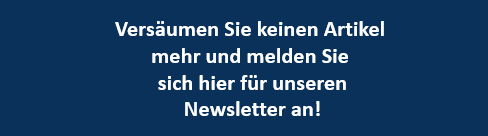Wie erhält Geld seinen Wert?
1. September 2025 – von Frank Shostak
[HIER KLICKEN, um den Beitrag als PODCAST-Folge anzuhören.]
Warum hat der Geldschein in unserer Tasche einen Wert? Der Wert des Geldes wird nach Ansicht einiger dadurch bestimmt, dass die Regierung dies so bestimmt. Für manche Kommentatoren beruht der Wert des Geldes auf einer gesellschaftlichen Konvention. Das bedeutet, dass Geld einen Wert hat, weil es akzeptiert wird – und warum wird es akzeptiert? Weil es einen Wert hat und akzeptiert wird! Offensichtlich ist dies keine gute Erklärung dafür, warum und wie Geld einen Wert hat.
Der Unterschied zwischen Geld und anderen Gütern
Versuchen wir einen anderen Ansatz. Die Nachfrage nach einem Gut entsteht aus seinem angenommenen Nutzen. Beispielsweise verlangen Menschen nach Nahrungsmitteln, weil diese ihnen Nährstoffe liefern. Was Geld angeht, so verlangen Menschen danach nicht, um es unmittelbar für den Verzehr oder Verbrauch zu verwenden, sondern um es gegen andere Güter und Dienstleistungen einzutauschen. Geld ist nicht an sich nützlich, sondern weil es einen Tauschwert hat – es ist gegen andere Güter und Dienstleistungen eintauschbar. Geld wird nachgefragt, weil sein Nutzen in seiner gegenwärtigen und zukünftigen Kaufkraft liegt.
Ludwig von Mises Institut Deutschland Konferenz 2025
Folglich muss etwas, damit es als Geld akzeptiert wird, bereits über Kaufkraft verfügen. Wie erlangt also etwas, das von der Regierung als Tauschmittel festgelegt wird, diese Kaufkraft? Wir wissen, dass das Gesetz von Angebot und Nachfrage den Preis einer Ware erklärt, aber wie erhält Geld seinen Preis (d. h. die Waren, die Menschen bereit sind, dafür zu tauschen)? Es scheint, dass dasselbe Gesetz auch den Preis von Geld erklären sollte. Allerdings gibt es hier ein Problem, da die Nachfrage nach Geld dadurch entsteht, dass Geld bereits über Kaufkraft verfügt. Wenn die Nachfrage nach Geld jedoch von seiner bereits vorhandenen Kaufkraft abhängt, warum wurde es dann ursprünglich überhaupt nachgefragt?
Wir scheinen hier in einer zirkulären Falle gefangen zu sein – die Kaufkraft des Geldes wird durch die Nachfrage nach Geld erklärt, während die Nachfrage nach Geld durch seine Kaufkraft erklärt wird. Diese Zirkularität scheint die Ansicht zu untermauern, dass die Akzeptanz von Geld das Ergebnis einer staatlichen Anordnung und einer gesellschaftlichen Konvention ist.
Mises‘ Erklärung
In seinen Schriften zeigte Mises, wie und warum Geld akzeptiert wurde. Er begann seine Analyse mit der Feststellung, dass die heutige Nachfrage nach Geld durch die gestrige Kaufkraft des Geldes bestimmt wird. Dementsprechend wird für ein gegebenes Geldangebot die heutige Kaufkraft festgelegt. Die gestrige Nachfrage nach Geld wiederum wurde durch die Kaufkraft des Geldes am Vortag bestimmt. Wenn wir in der Zeit zurückgehen, gelangen wir schließlich zu einem Zeitpunkt, an dem Geld nur eine gewöhnliche Ware war, die im Tauschhandel verwendet wurde und deren Preis durch Angebot und Nachfrage bestimmt wurde. Die Ware hatte einen Tauschwert in Bezug auf andere Waren (d. h., ihr Tauschwert wurde dadurch bestimmt, welche anderen Waren oder Dienstleistungen oder Bruchteile von Waren und Dienstleistungen gegen eine Einheit dieser Ware getauscht wurden). Einfach ausgedrückt: An dem Tag, an dem eine Ware zu Geld wird, hat sie bereits eine festgelegte Kaufkraft in Bezug auf andere Waren durch freiwillige Tauschgeschäfte. Diese Kaufkraft ermöglicht die Nachfrage nach dieser Ware als Tauschmittel.
An dem Tag, an dem eine Ware zum ersten Mal als Tauschmittel für indirekte Tauschgeschäfte dient – also Güter zu handeln, um ein anderes Gut zu bekommen, mit der Absicht, dieses Gut für den Austausch mit anderen zu verwenden –, wird ihre Kaufkraft durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Die kontinuierliche und weit verbreitete Verwendung nicht nur als Ware, sondern auch als Tauschmittel kann die Nachfrage nach der Ware als Geld erhöhen. Sobald der Preis des Geldes etabliert ist – welche vollständigen oder teilweisen Waren und Dienstleistungen dafür getauscht werden –, ist eine praktikable Grundlage für den morgigen Preis des Geldes gegeben (ceteris paribus). Daraus folgt, dass ohne die Informationen von gestern über den Preis des Geldes die heutige Kaufkraft des Geldes nicht bestimmt werden kann.
Bei anderen Gütern und Dienstleistungen ist es nicht erforderlich, die Geschichte zu betrachten, um die aktuellen Preise zu ermitteln. Die Nachfrage nach diesen Gütern entsteht aufgrund der wahrgenommenen Vorteile, die sich aus ihrem Konsum ergeben. Der Nutzen von Geld besteht darin, dass es gegen andere Waren und Dienstleistungen eingetauscht werden kann. Folglich muss man die vergangene Kaufkraft des Geldes kennen, um seine aktuelle Kaufkraft herleiten zu können. Anhand des Mises-Denksystems – auch bekannt als Regressionstheorem – können wir folgern, dass es unmöglich ist, dass Geld als Ergebnis eines Regierungsbeschlusses, einer staatlichen Anordnung oder einer spontanen gesellschaftlichen Konvention entstanden sein könnte. Das Theorem zeigt, dass Geld als Ware entstehen muss. Dazu schrieb Rothbard:
Im Gegensatz zu direkt verwendeten Konsum- oder Produktionsgütern muss Geld bereits existierende Preise haben, auf denen eine Nachfrage basieren kann. Dies kann jedoch nur geschehen, indem man mit einer nützlichen Ware im Tauschhandel beginnt und dann die Nachfrage nach einem [Tausch-]Mittel zur bisherigen Nachfrage nach direkter Verwendung hinzufügt (z. B. für Schmuck im Falle von Gold). Daher ist die Regierung nicht in der Lage, Geld für die Wirtschaft zu schaffen; dies kann nur durch den Prozess des freien Marktes geschehen.
Aber wie hängt das alles mit Papiergeld zusammen? Ursprünglich wurde Papiergeld nicht als Geld angesehen, sondern es repräsentierte lediglich Gold (d. h. als Geld-Substitut). Verschiedene Papierzertifikate stellten Ansprüche auf bei Banken gelagertes Gold dar. Die Inhaber von Papierzertifikaten konnten diese jederzeit in Gold umtauschen, wenn sie es für angebracht hielten. Da die Menschen es bequemer fanden, Papierzertifikate zum Tausch gegen Waren und Dienstleistungen zu verwenden, wurden diese Zertifikate schließlich als Geld angesehen. Diese Zertifikate erlangten Kaufkraft aufgrund der Tatsache, dass sie als Surrogat für Gold angesehen wurden.
Papierzertifikate, die als Tauschmittel akzeptiert werden, eröffnen Möglichkeiten für betrügerische Praktiken. Banken könnten nun versucht sein, ihre Gewinne zu steigern, indem sie Zertifikate als Kredit ausgeben, die nicht durch Gold gedeckt sind. In einer freien Marktwirtschaft würde eine Bank, die zu viele Papierzertifikate ausgibt, jedoch schnell feststellen, dass der Tauschwert ihrer Zertifikate in Bezug auf Waren und Dienstleistungen sinkt. Um ihre Kaufkraft zu schützen, würden die Inhaber der übermäßig ausgegebenen Zertifikate höchstwahrscheinlich versuchen, diese wieder in Gold umzuwandeln. Wenn alle gleichzeitig ihr Gold zurückfordern würden, würde dies die Bank in den Bankrott treiben. In einem freien Markt würde also die Gefahr des Bankrotts die Banken davon abhalten, nicht durch Gold gedeckte Papierzertifikate auszugeben.
Die Regierung kann jedoch die Disziplin des freien Marktes umgehen. Sie kann eine Anordnung erlassen, die es der übermäßig emittierenden Bank erlaubt, Papiergeld nicht in Gold einzulösen. Sobald Banken nicht mehr verpflichtet sind, Papiergeld in Gold einzulösen, entstehen Möglichkeiten für große Gewinne, die Anreize für eine ungebremste Ausweitung des Papiergeldangebots schaffen. Die ungebremste Ausweitung von ungedecktem Papiergeld führt zu einem ungleichmäßigen Anstieg der Preise für Waren und Dienstleistungen. Darüber hinaus wird die Produktionsstruktur verzerrt, was zu einem künstlichen Boom führt, der zwangsläufig in einem Bust enden muss.
Um einen solchen Bust zu verhindern, muss die Versorgung mit Papiergeld gesteuert werden. Der Hauptzweck der Steuerung der Versorgung besteht darin, zu verhindern, dass verschiedene konkurrierende Banken zu viele Papiergeldscheine ausgeben und sich gegenseitig in den Bankrott treiben. Dies kann durch die Einrichtung einer Monopolbank – d. h. einer Zentralbank – erreicht werden, die die Ausweitung des Papiergeldes steuert.
Um ihre Vormachtstellung zu behaupten, führt die Zentralbank eigene Papierzertifikate ein, die die Zertifikate verschiedener Banken ersetzen. Die Kaufkraft des Zentralbankgeldes wird dadurch begründet, dass verschiedene Papierzertifikate, die aufgrund ihrer historischen Verbindung zu Gold Kaufkraft besitzen, zu einem festen Kurs gegen Zentralbankgeld eingetauscht werden. Die Papierzertifikate der Zentralbank sind vollständig durch Bankzertifikate gedeckt, die eine historische Verbindung zu Gold haben. Daraus folgt, dass die Papiergeldscheine der Zentralbank nur aufgrund ihrer historischen Verbindung zu Gold Kaufkraft erlangt und behalten haben.
Fazit
Entgegen der landläufigen Meinung beruht der Wert eines Papierdollars auf seiner historischen Verbindung zu Warengeld und nicht auf einer Regierungsanordnung oder einer gesellschaftlichen Konvention. Fiatgeld, wie wir es heute verwenden, könnte und würde in einem Marktumfeld nicht entstehen. Es ist ausschließlich eine inflationäre Schöpfung des Staates, mit der dieser sich die historische Verbindung zu solidem Geld zunutze machte.
*****
Dieser Beitrag von Frank Shostak ist bereits am 4. August 2025 auf der Homepage des Mises Institute, Auburn, Alabama, unter dem Titel „How Does Money Acquire its Value?“ erschienen. Übersetzt von Florian Senne.
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Instituts Deutschland wieder.
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Das Ludwig von Mises Institut Deutschland e.V. setzt sich seit Jahren für die Verbreitung der Lehre der Österreichischen Schule der Nationalökonomie ein. Freiheit gibt es nicht geschenkt, sie muss stets neu errungen und erhalten werden. Bitte unterstützen Sie daher das Ludwig von Mises Institut Deutschland mit einer Spende, damit wir uns weiterhin für unser aller Freiheit einsetzen können!
Spendenkonto:
Ludwig von Mises Institut Deutschland e. V.
IBAN: DE68 7003 0400 0000 1061 78
BIC: MEFIDEMM
Merck Finck A Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch
Verwendungszweck: Spende
Titel-Foto: Adobe Stock Fotos (bearbeitet)