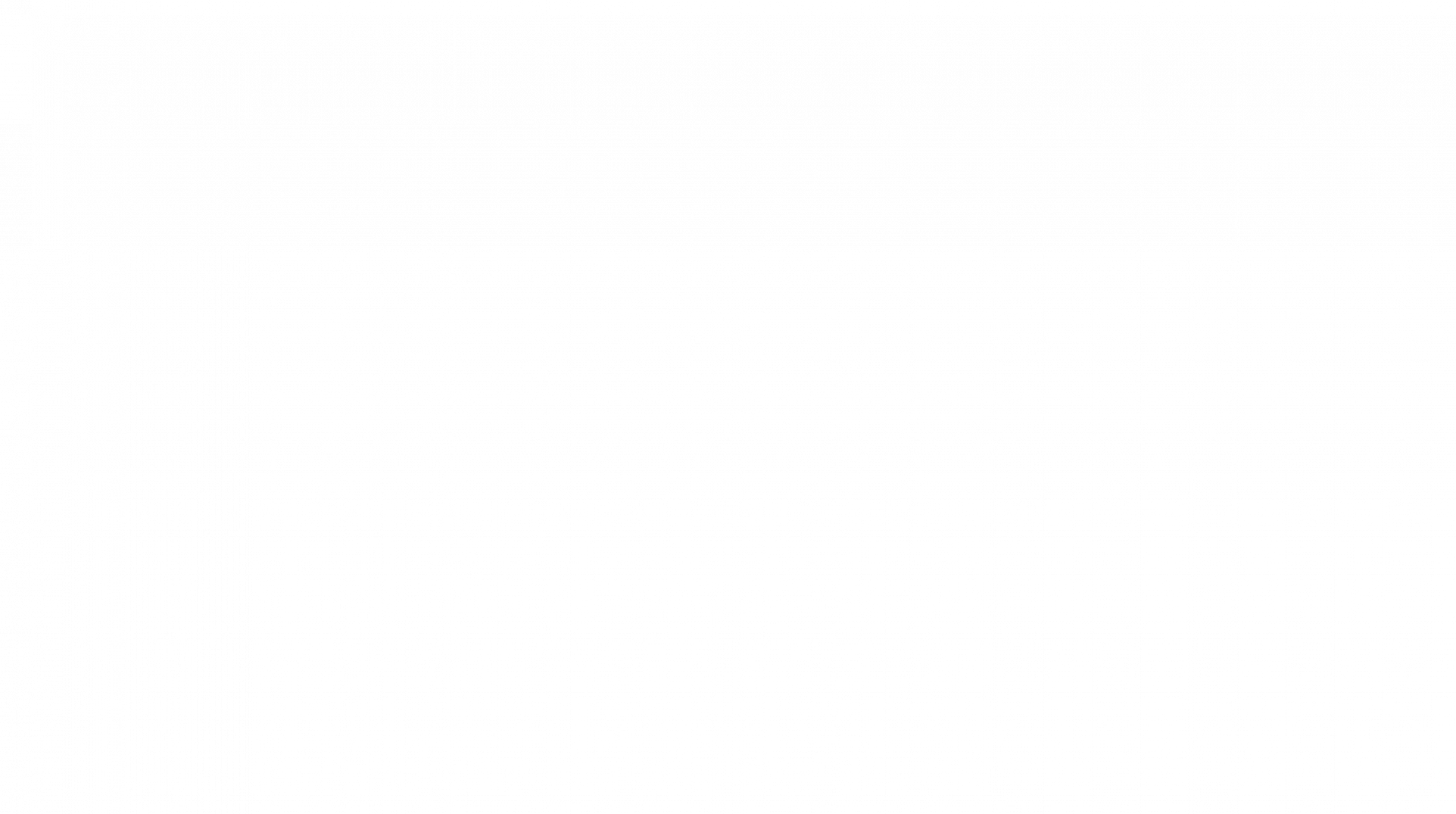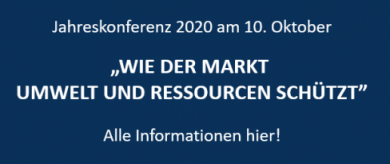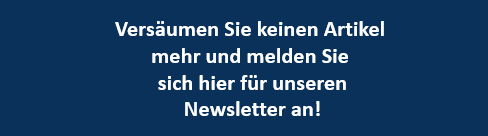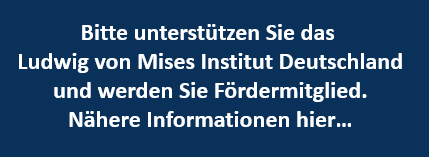Entstaatlichung kurbelt die Wirtschaft an
10. Juli 2020 – Weltweit wird versucht, mit staatlichen Geldern und Interventionen die Wirtschaft anzukurbeln. Dabei werden so die Wachstumskräfte eher geschwächt.
von Olivier Kessler

Olivier Kessler
Eilig werden derzeit überall Hilfspakete für die notleidende Wirtschaft geschnürt, die Staatsquote wächst. Von diesem Vorgehen verspricht man sich eine Ankurbelung der Konjunktur. Die historischen Erfahrungen zeigen jedoch, dass vor allem politische Zurückhaltung zum Erfolg führt und ein rigoroses Entstaatlichungsprogramm die Erholung der Wirtschaft beschleunigt.
Schweden etwa hat erfreuliche Erfahrungen mit seiner Abspeckungskur für den Staat gemacht, nachdem man zuvor mit dem Ausbau des Staatsumfangs auf den Holzweg gelangte. Zwischen 1970 und 1990 wurde der schwedische Wohlfahrtsstaat zunächst stark ausgebaut, womit das Wirtschaftswachstum des Landes deutlich hinter dasjenige der meisten europäischen Länder zurückfiel.
Schwedens Rückfall
Noch 1970 war Schweden auf Rang vier des OECD-Rankings der Länder mit dem höchsten Bruttoinlandprodukt (BIP) pro Kopf und fiel dann bis 1995 auf Platz sechzehn zurück. Viele Unternehmer – unter anderem Ikea-Gründer Ingvar Kamprad – verließen aufgrund der Politik des Staatsausbaus und der grenzenlosen fiskalischen Gier frustriert das Land.
Ab den Neunzigerjahren rang sich Schweden zu marktwirtschaftlichen Reformen durch: Die Unternehmenssteuern wurden von 57 auf 30% nahezu halbiert. Ebenfalls um rund 25 Prozentpunkte gesenkt wurde der Spitzensteuersatz der Einkommenssteuer. 2004 folgte die komplette Abschaffung der Erbschafts- und Schenkungssteuern, 2007 die Streichung der Vermögenssteuer. Und 2013 wurde dann die Körperschaftssteuer auf 22% gesenkt. Von 1993 bis 2000 wurden die Sozialleistungen von 22,2 auf 16,9%, die Personalkosten in der Verwaltung von 18,2 auf 15,6 und die Subventionen von 8,7 auf 1,8% des BIP reduziert. Die Staatsquote Schwedens sank deshalb zwischen 1990 und 2012 von 61,3 auf 52%.
In der Folge verbesserte sich Schweden im erwähnten OECD-Ranking bis zum Jahr 2016 wieder auf Platz zwölf. Das ist deshalb eindrücklich, weil in der Zwischenzeit viele neue Länder in diesem Ranking aufgestiegen sind.
Weiteres Anschauungsmaterial bietet Großbritannien, das nach dem Zweiten Weltkrieg seinen Staatsumfang enorm ausweitete. Etwa mit einem groß angelegten Verstaatlichungsprogramm, wovon unter anderem die Kohle-, die Eisen- und die Stahlindustrie, die zivile Luftfahrt, das Fernmeldewesen, Eisenbahnen, Banken, Strom und Gas betroffen waren. Zwischen 1950 und 1970 fiel das Land in der Folge beim Wirtschaftswachstum im Vergleich zu anderen europäischen Ländern deutlich zurück. 1972 intervenierte die Regierung zudem unverblümt in die Lohn- und Preisbildung und setzte damit die Marktwirtschaft noch stärker außer Kraft.
Margaret Thatcher gewann 1979 die Wahl und erklärte sogleich die Aufhebung der Preiskontrollen. Sie senkte den Eingangssteuersatz von 33 auf 25% und den Spitzensteuersatz von 83 auf 40%. Sie bekämpfte die grassierende Überregulierung, entrümpelte das Land von unnötiger Bürokratie und leitete eine große Privatisierungswelle ein – etwa von British Telecom, British Airways, BP, Rolls-Royce und Jaguar. Über 600.000 Arbeitsplätze wurden so in den privaten Sektor überführt.
Die Produktivität der betroffenen Gesellschaften stieg stark. Das Unternehmertum blühte in der freiheitlicheren Umgebung auf: von 1,9 Mio. kleinen Unternehmen 1979 auf über 3 Mio. im Jahr 1989. Die Nettolöhne einfacher Produktionsmitarbeiter stiegen zwischen 1979 und 1994 mit 25,8% viel stärker als beispielsweise in Deutschland (2,5%) oder in Frankreich (1,8%).
Freiheit bringt Wohlstand
Schweden und Großbritannien sind nur zwei von vielen Beispielen, die auf den Erfolg von Entstaatlichungskuren hindeuten. Wie der Index wirtschaftlicher Freiheit zeigt, sind das keine Zufälle: In dem Viertel aller Länder, die die höchste wirtschaftliche Freiheit aufweisen, sind die Menschen im Vergleich zu dem Viertel der Länder mit der geringsten wirtschaftlichen Freiheit rund sechsmal wohlhabender und leben fünfzehn Jahre länger.
Der Ökonom Richard Rahn zeigt mit seiner Rahn-Kurve, dass das ideale Staatsgewicht irgendwo bei 12 bis 13% des BIP liegt. Weil der Staat jedoch derzeit in sämtlichen Volkswirtschaften zu übergewichtig ist und weiter an Gewicht zulegt, wird das Wachstumspotenzial der Wirtschaft immer mehr geschwächt.
Gerade angesichts der globalen Rezession besteht hier dringender Handlungsbedarf. Will die Politik einer Verarmung der Gesellschaft tatsächlich entgegenwirken und die aktuelle Krise nicht einfach dafür missbrauchen, ihre eigenen Macht- und Entscheidungsbefugnisse auszubauen, muss sie jetzt den Staat entschieden auf Diät setzen.
Die aktuelle Situation wird oft mit der Großen Depression von 1929 verglichen. Der Ökonom Murray Rothbard zeigt in seiner umfangreichen Studie «America’s Great Depression», dass eine Laissez-faire-Politik auch die richtige Antwort auf eine unmittelbare Krise ist. Vor 1929 war staatliche Zurückhaltung in den USA während wirtschaftlichen Depressionen die Norm, was Krisen bis dahin signifikant abdämpfte und verkürzte.
In der Großen Depression jedoch änderte sich dies dramatisch. Staatliche Interventionen wie etwa eine Ausweitung der Staatsausgaben zur Unterstützung taumelnder Unternehmen, Lohnschutzgesetze, das Verbot der Spekulation mit Nahrungsmitteln, Arbeitsbeschaffungsprogramme – die Errichtung des Hoover Dam ist ein prominentes Beispiel dafür –, Steuererhöhungen, eine expansive Geldpolitik und Ähnliches mehr verlängerten die Krise, weil sie die notwendigen marktwirtschaftlichen Anpassungsprozesse massiv behinderten.
Aus der Geschichte lernen
Nach dreieinhalb Jahren lag die Arbeitslosenquote auf 25%, und eine Besserung war noch immer nicht in Sicht. Rothbard kam daher zum Schluss, dass die Politik das Leid unnötig fortgeführt habe und die Große Depression vor allem aufgrund des staatlichen Aktionismus so «groß» geworden sei.
Albert Einstein meinte:
Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.
Es bleibt zu hoffen, dass uns der Wahnsinn in der aktuellen Krise erspart bleibt und sich die politischen Entscheidungsträger ernsthaft mit den historischen Erfahrungen auseinandersetzen.
*****
Dieser Beitrag ist zuerst erschienen auf der website der Finanz und Wirtschaft.
Olivier Kessler ist Direktor des Liberalen Instituts in Zürich und Mitherausgeber des Buchs «Explosive Geldpolitik. Wie Zentralbanken wiederkehrende Krisen verursachen».
*****
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Institut Deutschland wieder.
Foto: Adobe Stock