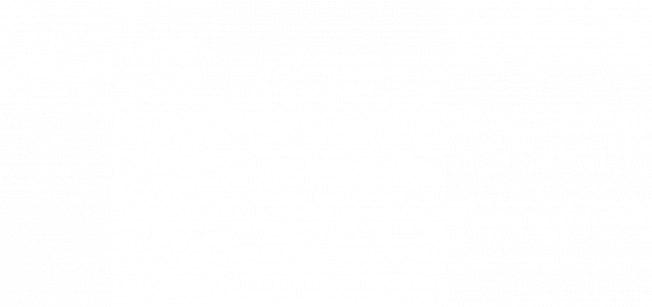Offener Brief an Thomas Piketty
23.5.2014 – von Christoph Braunschweig.
Sehr geehrter Herr Kollege Piketty!
In den Medien werden Sie als „neuer Karl Marx“ bezeichnet, zumal Ihr Bestseller „Capital in the Twenty-First Century“ in fesselnder Diktion, interessanten historischen Reflexionen und einer viele Menschen ansprechenden Botschaft verfasst ist. Sie betonen das Risiko einer Explosion der Vermögensungleichheit weil die Kapitalakkumulation schneller ist, als es die Zuwächse der Arbeitseinkommen sind. Die zentrale These Ihres Buches lautet also, dass die Kapitalrendite stets höher ist als das Wachstum der Wirtschaft und der Arbeitseinkommen. Dadurch würden reiche Kapitalbesitzer immer reicher und die Vermögen immer stärker in wenigen Händen konzentriert – letztlich sei dadurch die Demokratie gefährdet. Als Gegenmittel fordern Sie Steuersätze bis zu 75 Prozent für Spitzenverdiener und eine globale, progressive Vermögenssteuer von bis zu 10 Prozent jährlich für Milliardäre. Alle diejenigen, die die sakrosante Losung der „sozialen Gerechtigkeit“ anbeten, sind emotional sofort auf Ihrer Seite.
Fast alle Wirtschaftswissenschaftler verwerfen jedoch Ihre Theorie, die Datengrundlage und die verfehlte sozialistische Politikempfehlung. Dies gilt sogar für 100-prozentige Keynesianer, wie z. B. Peter Bofinger. Er weist darauf hin, dass Ihre Grundthese nicht durch die empirischen Daten gestützt wird und Sie ihre Leser im Unklaren lassen, welche Beziehungen zwischen der Kapitalrendite und der Sparquote sowie dem Verhältnis der Sparquote zur Wachstumsrate des Volkseinkommens bestehen.
Viel besser wäre es gewesen, wenn Sie, sehr geehrter Herr Kollege, das Verhältnis zwischen dem Produktivitätsfortschritt und der Entwicklung der Realeinkommen analysiert hätten. Das Ergebnis ist nämlich, dass sich seit Einführung des Euros die erzielten Produktivitätsfortschritte der Industrie nicht mehr in entsprechend steigenden Realeinkommen widerspiegeln. Diese „Sozialdividende“ für die Arbeitnehmer verdampft in der Sozialstaatsbürokratie und den „Euro-Rettungsmaßnahmen“. Schon mal drüber nachgedacht?
Ich selber möchte mich an dieser Stelle ganz bewusst nicht weiter an der ökonomischen Fachdiskussion beteiligen, sondern Sie stattdessen, sehr geehrter Herr Kollege, dazu animieren, eine Fahrt nach Venedig zu unternehmen. Wie sagte schon Immanuel Kant (1724-1804): „Das Reisen bildet sehr; es entwöhnt von allen Vorurteilen…“ Nutzen Sie die Verkaufserlöse Ihres erfolgreichen Buches, indem Sie gleich Ihre ganze Familie mitnehmen und ein exquisites Hotel am Canal Grande in der Nähe vom Markus-Platz buchen. Ihre Liebsten werden sich freuen. Besuchen Sie mit den Ihrigen die vielen Paläste und betrachten Sie den morbiden Charme Venedigs. Nur bitte fahren Sie nicht im Sommer dorthin, wenn es viel zu heiß ist und die Serenissima von den schwitzenden Touristenhorden regelrecht niedergetrampelt wird.
Warum gerade Venedig? Weil die Wiege des modernen Kapitalismus in den norditalienischen Städten stand. Und das war mehr als ein Wirtschaftssystem; es war die Idee der Freiheit, die Geburt des Individuums, die Überzeugung, dass Wahrheit nicht in Dogmen bestehen könne, sondern durch Beobachtung gefunden werden muss. Dieser frühe Kapitalismus Norditaliens ging wieder unter, aber seine Ideen prägen die Welt bis heute. Im 18. Jahrhundert wurde der Faden in Großbritannien („Whig-Partei“) wieder aufgenommen.
Die einstige Pracht der norditalienischen Städte – ganz besonders Venedig – ist heute ziemlich heruntergekommen. Die Reichen, die einst einen Palast mit allem Dienstpersonal unterhalten konnten, gibt es nicht mehr. Dem heutigen Besucher drängt sich der Eindruck auf, dass die Städte im Laufe der Jahrhunderte verarmt seien. Doch das ist falsch: Das reale Durchschnittseinkommen der Einwohner Venedigs liegt heute bei einem Mehrfachen dessen, was es in den Glanzzeiten betragen haben kann. Entgegen dem äußeren Anschein ist Venedig heute viel reicher als im 15. Jahrhundert. Das Bild der Verarmung kommt nur deshalb zustande, weil die Einkommen heute viel gleichmäßiger verteilt sind als damals. Wer heute einen durchschnittlichen venezianischen Palazzo bauen wollte, mit all seinen Gemälden und Skulpturen, wer Kompanien von Bediensteten bezahlen wollte, der müsste jährlich rund 2 Millionen Euro für seinen persönlichen Lebensunterhalt ausgeben. Von diesen Reichen gab es in Venedig seinerzeit etwa vierhundert. Sie konnten sich den Aufwand deshalb leisten, weil die Arbeitskraft der Maler, Mauerer, Bildhauer, der Haushofmeister und Küchenmädchen extrem billig war.
Wenn die Einkommensverteilung gleichmäßiger wird, dann gibt es immer weniger Reiche, die die Arbeitskraft anderer Leute für ihren persönlichen Lebensunterhalt bezahlen können, und zwar auch dann, wenn das Gesamteinkommen steigt. Der heutige Tourist hat in Venedig die gleichmacherische Kraft des Kapitalismus gleich doppelt vor Augen: Die Besucher, die die verfallenden Paläste bewundern, tragen meist ausgewaschene Jeans. Der Unterschied zwischen armen und reichen Touristen besteht heute darin, dass die Armen ihre Jeans selbst auswaschen müssen, während die Reichen sie schon ausgewaschen kaufen.
Die Paläste verfallen, weil die Hütten verschwunden sind. Und die ehemaligen Herrschaftssitze stehen heute dem Publikum gegen Eintrittsgebühr offen. Die Scharen von Dienstboten, die unter dem Befehl eines Butlers für das Wohl der Herrschaft sorgten, gibt es nicht mehr.
Es gibt keinen besseren Maßstab für die Gleichheit oder Ungleichheit in einer Gesellschaft als die Anzahl der Menschen, die zur persönlichen Dienstleistung für andere arbeiten, also die Lakaien, Diener, Butler, Köchinnen, Zofen. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren in Deutschland über zehn Prozent aller Arbeitnehmer Dienstpersonal. Ein Regierungsrat hatte zu dieser Zeit drei bis vier Hausangestellte. Vor dem Zweiten Weltkrieg hat er nur ein Dienstmädchen. Heute versorgt selbst die Frau Minister ihren Haushalt selber.
Man mag in Venedig beim Anblick der so unsäglich hässlich gekleideten Touristen den allgemeinen kulturellen Niedergang bedauern, aber ein Punkt ist unübersehbar: Der Kapitalismus erlaubt auf Dauer Massenwohlstand, der Sozialismus bloß Mangel.
Selbst der angeblich so rücksichtslose und brutale Manchester-Liberalismus hat dort, wo er praktiziert wird – in Taiwan, Hongkong, Singapur -, zu einer deutlichen Verminderung der Ungleichheit geführt. Umgekehrt gibt es dort, wo die kapitalistischen Marktkräfte in vielfacher Weise und oft mit sozialen Absichten behindert werden, kaum Fortschritte – so in Lateinamerika und Schwarzafrika. Das, was in Europa und Amerika Geschichte ist, lässt sich in den Entwicklungsländern noch heute beobachten: Von den Luxusvillen lateinamerikanischer Städte hat man oft einen malerischen Blick auf die Favelas, die Elendsquartiere der Armen. Die Armen strömen dennoch in die Städte, weil dort ihre Lebensbedingungen immer noch besser sind als dort, von woher sie kommen. Auch die Armen, die seinerzeit nach Florenz, Padua oder Venedig flohen, hatten es dort besser als unter den Feudal-Grundherren, denen sie entflohen.
Sie sehen, sehr geehrter Herr Kollege Piketty, es bedarf gar keiner spitzfindigen Gleichungen und Formeln, um wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Phänomene zu begreifen. In der Regel reicht gesunder Menschenverstand und die vorurteilsfreie Betrachtung der Realität völlig aus, um ökonomische Gesetzmäßigkeiten und soziale Folgen zu verstehen. Die anzahlmäßig kleine „Österreichische Schule der Nationalökonomie“ praktiziert dies seit jeher. Vermutlich liegt sie deshalb mit ihren Analysen und Voraussagen in der Regel richtig – ganz im Gegensatz zur keynesianisch vergifteten „Mainstream-Ökonomie“, deren behauptete Wirkungszusammenhänge aggregierter Gesamtgrößen oft genug nur hochgestochener Unsinn sind.
Die Wahrheit ist ganz banal: Ohne Kapitalismus und Marktwirtschaft ist kein Massenwohlstand möglich, der wiederum die Voraussetzung für die persönliche Freiheit und Unabhängigkeit des einzelnen Bürgers ist. Je mehr sich allerdings die Lebensumstände der Menschen im Kapitalismus durch allgemeines Wirtschafswachstum angleichen, desto empfindsamer regieren sie auf die verbleibenden Unterschiede. Man nennt diesen Effekt das „Wohlstandsparadoxon“ (Wolf Schneider). Der Sozialneid ist eine menschliche Urmacht, er war es zu allen Zeiten in allen Kulturen. Dies ist der Kern aller sozialpolitischen Kontroversen. Hier werden letztlich atavistische Gefühle des Menschen berührt. Und jede pseudowissenschaftliche Begründung für sozialpolitisches Gutmenschentum wird von der Politik und den machtloyalen Medien begierig aufgenommen. Dies ist der Grund für den Erfolg solcher Veröffentlichungen wie der Ihrigen.
Die Demokratie ist nicht gefährdet durch Kapitalakkumulation der Reichen, wie schon Karl Marx irrtümlicherweise annahm, sondern vielmehr durch die fortgesetzten Verstöße gegen alle elementaren Grundsätze marktwirtschaftlicher Ordnungspolitik. Ständige staatliche Interventionen im Rahmen von Gleichmacherei und Umverteilung („Wählerbestechungsdemokratie“) führen zwangsläufig zur schamlosen Staatsverschuldung; dies auf der auf der Grundlage des fatalen staatlichen Geldmonopols. Das damit einhergehende Geldmengenwachstum führt zur „financial- repression“ (Zinsen unterhalb der Inflationsrate). Durch diese verantwortungslose Politik werden die sozial Schwächeren gleich in mehrfacher Art und Weise besonders hart getroffen, während sich die Reichen besser gegen Inflation wehren können. Es ist also die verfehlte staatliche Wirtschafts- und Sozialpolitik, die die Schere zwischen Arm und Reich – nicht nur in diesem Fall – künstlich vergrößert, wie Philipp Bagus und Andreas Marquart in ihrem Buch „Warum andere auf Ihre Kosten immer reicher werden” eindrücklich erläutern.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr
Christoph Braunschweig
Quellen:
Philipp Bagus u. Andras Marquart: Warum andere auf Ihre Kosten immer reicher werden, München 2014
Philipp Bagus: Es liegt an der expansiven Papiergeldpolitik, in: FAZ: Harsche Kritik an den Thesen des „neuen Marx“, 15.5.2014, S. 18
Peter Bofinger: Die Formel hakt an den empirischen Daten, in: FAZ, ebenda
Christoph Braunschweig: Die demokratische Krankheit, München 2012, S. 124-125
Wolfram Engels: Schlussfolgerungen, Düsseldorf 1987, S. 217 – 220
FAZ: Harsche Kritik an den Thesen des „neuen Marx“, 15.5.2014, S. 18
Lars Feld: Hauptsache, mehr Staat – das fatale französische Konzept, in: FAZ ebenda
Stefan Homburg: Ein spekulatives Buch für eine falsche Politik, in: FAZ ebenda
Wolf Schneider: Glück, Hamburg 2007, S. 72
Hans-Werner Sinn: Die gleichen Fehler wie Karl Marx, in: FAZ, ebenda
Andreas Tögel: Buchrezension: Warum andere auf Ihre Kosten immer reicher werden, in: ef-Online, 20.5.2014
Etienne Wasmer: Die Häuserpreise verzerren die Vermögensstatistik, in: FAZ ebenda
Foto Startseite: youtube.de
—————————————————————————————————————————————————————————–
Christoph Braunschweig ist ehemaliger studentischer Hörer von Friedrich A. von Hayek und heute Professor der Staatlichen Wirtschaftsuniversität Jekaterinburg. Er ist Autor zahlreicher Fachbücher und war unter anderem als Geschäftsführer im Medien-Handelsbereich tätig.
Vor kurzem ist sein neues Buch erschienen, das er zusammen mit Susanne Kablitz geschrieben hat, mehr Informationen hier: Kluge Geldanlage in der Schuldenkrise -Austrian Investing-