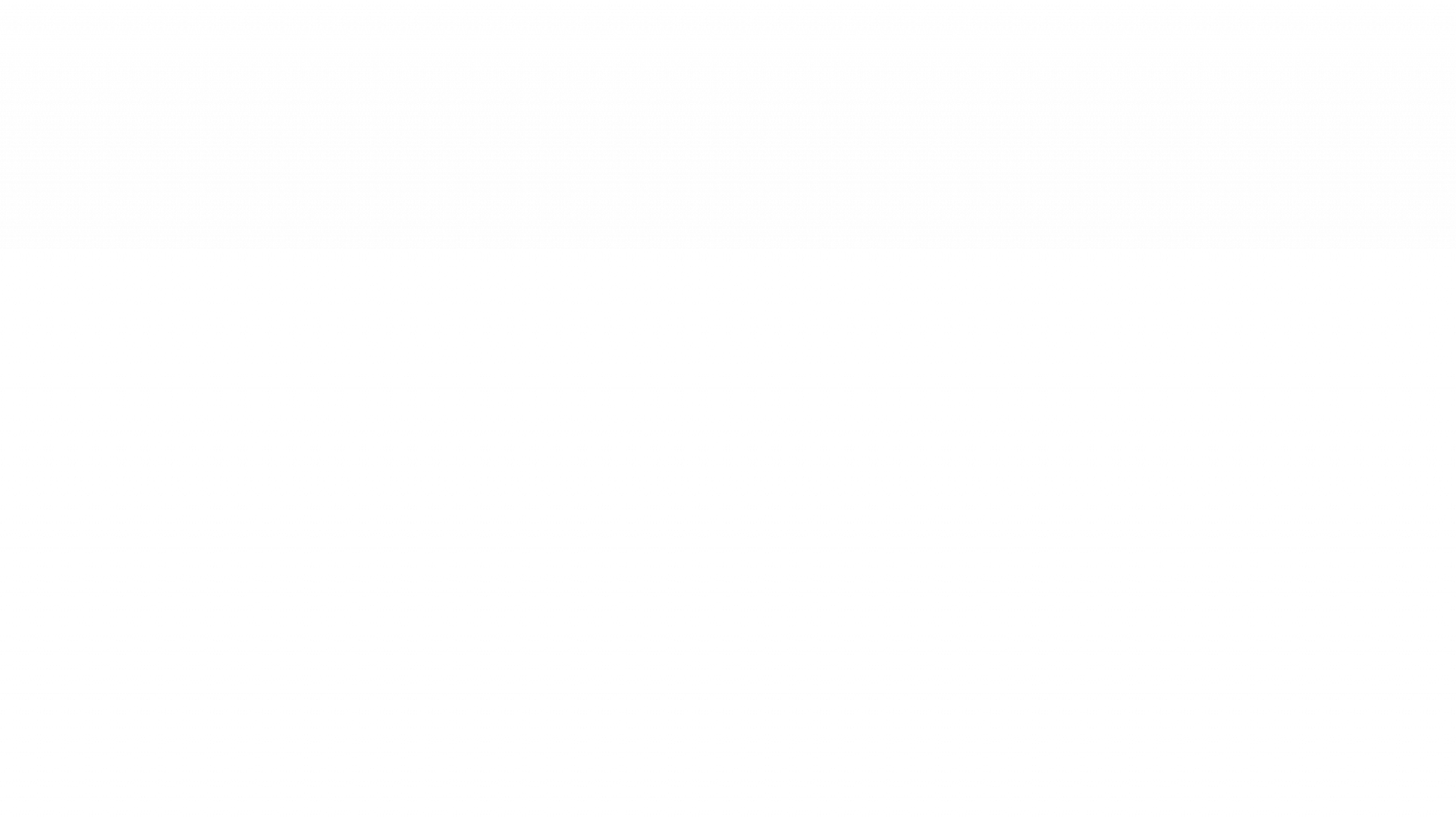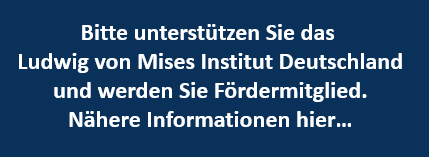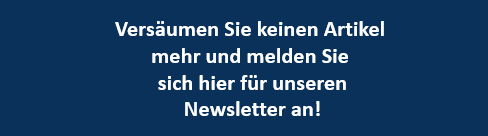Innovation – die unterschätzte Ressource
Titelfoto: Sprengung der Kühltürme des Kernkraftwerkes Grafenrheinfeld am 16. August 2024 (Adobe Stock Fotos; bearbeitet)
17. November 2025 – von Rainer Fassnacht
Wird über Ressourcen berichtet, ist meist von Energierohstoffen wie Öl oder Uran, seltenen Erden oder auch Ernährungsrohstoffen wie Weizen oder Kaffee die Rede. Betrachtet man das Thema genauer wird deutlich, dass es gute Gründe dafür gibt, auch die menschliche Innovationskraft als Ressource zu bezeichnen.
Eine erste, schnell ersichtliche Verbindung zwischen den eingangs genannten Rohstoffen und Innovation ist die Veränderung ihrer Verfügbarkeit im Laufe der Zeit. In den siebziger Jahren hatte der Club of Rome das bald bevorstehende Ende zahlreicher Ressourcen berechnet und eine mediale Woge der Panik ausgelöst.
Im Rückblick war der Schwachpunkt der „Grenzen des Wachstums“ der Umstand, dass Innovation unberücksichtigt blieb. Dabei hätte man nur einen Blick auf die Entwicklung des „Peak Oil“ werfen müssen, um zu erkennen, dass Innovationen drastische Auswirkungen auf die Rohstoffverfügbarkeit haben.
Die Innovationen wirken einerseits bei der Ressourcengewinnung. Beispielsweise helfen neue Detektionstechniken dabei, neue Lagerstätten zu finden. Oder neue Fördermethoden tragen dazu bei, zuvor unzugängliche Ressourcen nutzen zu können. Zusätzlich wirkt Innovation auf der Produktions- und Verbrauchsseite. Beispielsweise werden Prozesse verändert, um weniger Rohstoffe zu benötigen oder Kunden verändern ihr Verhalten in ressourcenschonender Richtung.
Vermutlich ist Innovation die am meisten unterschätzte Ressource. Wie wirksam sie sein kann, lässt sich unter anderem daran erkennen, dass Menschen vom Pol bis zum Äquator überleben können, indem sie die Früchte ihrer Innovationskraft nutzen. Die beeindruckenden Möglichkeiten zeigen Einzelbeispiele, wie die Produktion und Lagerung von Eis in der Wüste – schon lange bevor es Strom gab.
Die oben erwähnte „Ressourcen-Panik“ war nicht das erste Weltuntergangsszenario und wird auch nicht das letzte sein. Hat man mehrere Weltuntergänge unbeschadet überstanden, fällt auf, dass insbesondere Medien und Politik davon profitierten. Medien können das jeweilige Thema immer wieder mit dramatischen Geschichten und eindrucksvollen Bildern hochkochen, um ihr Publikum zu binden. Politiker können die alles bedrohende Gefahr als Begründung für weitere Interventionen nutzen.
Eine andere „Panikgeschichte“ – die Reaktionen auf den Unfall in Fukushima – zeigt exemplarisch die genannten Punkte. Ein Tsunami (also ein Naturereignis) war der Beginn einer Reihe von Entwicklungen, an deren Ende es zum Austritt von Radioaktivität kam. In Deutschland führte das Geschehen auf der anderen Seite des Globus zu den oben beschriebenen medialen und politischen Reaktionen, die dann zum Atomkraftausstieg führten. Dieser wiederum hatte – in Verbindung mit weiteren politischen Interventionen – einen drastischen Anstieg der Energiepreise und die Abwanderung energieintensiver Branchen zur Folge.
Ohne die panikbedingte (und teilweise noch immer andauernde) Blickverengung könnte man erkennen, dass es im Bereich der Kernkraft zu zahlreichen Innovationen kam, welche die Vorteile dieser Technik ohne das GAU-Risiko nutzbar machen. Einige dieser Ideen wurden in Deutschland erfunden. Allerdings führte die panische „Atomfeindlichkeit“ hierzulande dazu, dass die Weiterentwicklung der innovativen Technik und der Bau erster Anlagen in anderen Ländern stattfinden wird. Es sei noch angemerkt, dass ein anderer Verlauf der Klimaveränderung durch den panikgeprägte Atomausstieg in Deutschland nicht erkennbar ist.
Das Beispiel zeigt, wie leicht der menschliche Einfluss auf globale natürliche Prozesse überschätzt und die menschliche Innovationskraft unterschätzt werden kann. Einige mögen nun argumentieren, die Panik sei nötig, um Innovation voranzubringen. Doch trifft dies tatsächlich zu?
Die Antwort lautet nein. Wie schon das Sprichwort sagt, ist Angst kein guter Ratgeber. Zwar löst Angst zahlreiche physische und psychische Reaktionen aus, aber eine Steigerung der Innovationskraft gehört nicht dazu. Der durch Weltuntergangsgeschichten ausgelöste Überlebens- und Abwehrmechanismus Angst führt eher zu schnellen reflexhaften als zu durchdachten Reaktionen.
Außerdem gilt es zu bedenken, was im Gehirn passiert, wenn eine Panik der anderen folgt:
Zu häufige oder zu langandauernde Angstreize können sich als rhythmisches Muster im Gehirn festsetzen“, schreibt der Pharmakonzern Sanofi-Aventis. „Es entsteht eine Art Angstgedächtnis, das schon bei geringsten Umweltreizen den Angstalarm auslöst.“
Mediale und politische Angsttreiber abzuwehren, hilft dabei, der Angstspirale zu entkommen. Auch sich bewusst zu machen, dass der menschliche Ideenreichtum und menschliche Innovationskraft geeignet sind, selbst schwierigste Situationen zu meistern, kann nützlich sein.
Was hat das Alles mit Ludwig von Mises‘ (1881 – 1973) Praxeologie beziehungsweise der Handlungslogik zu tun?
Erstens sorgt die individuelle Bewertung von Innovation dafür, dass diese (wie jedes andere ablehnbare Angebot) nicht quasi-automatisch zur Umsetzung kommen. Das Stahlkochen mit Wasserstoff ist technisch möglich, ob es eine wirtschaftliche Zukunft hat und tatsächlich zu einer Verbesserung beitragen kann, zeigt der Markt.
Zweitens wissen wir, dass ein zentraler politischer Eingriff bei solchen „Panikthemen“ (wie bei jedem anderen Thema) schädlich ist und nicht dabei hilft, den Herausforderungen zu begegnen. Innovation – als die vermutlich am meisten unterschätzte Ressource – gedeiht am besten dort, wo staatliche Interventionen nicht verhindern, dass diese sich entfalten, aber auch nicht darüber entscheiden, welche realisiert werden.
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Instituts Deutschland wieder.
Rainer Fassnacht ist Ökonom und freier Journalist. Er schreibt für verschiedene Printmedien und Onlineplattformen im In- und Ausland. Hauptthema seiner Artikel über ökonomische Themen ist die Bewahrung der individuellen Freiheit.
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Das Ludwig von Mises Institut Deutschland e.V. setzt sich seit Jahren für die Verbreitung der Lehre der Österreichischen Schule der Nationalökonomie ein. Freiheit gibt es nicht geschenkt, sie muss stets neu errungen und erhalten werden. Bitte unterstützen Sie daher das Ludwig von Mises Institut Deutschland mit einer Spende, damit wir uns weiterhin für unser aller Freiheit einsetzen können!
Spendenkonto:
Ludwig von Mises Institut Deutschland e. V.
IBAN: DE68 7003 0400 0000 1061 78
BIC: MEFIDEMM
Merck Finck A Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch
Verwendungszweck: Spende
Titel-Foto: Adobe Stock Fotos – bearbeitet