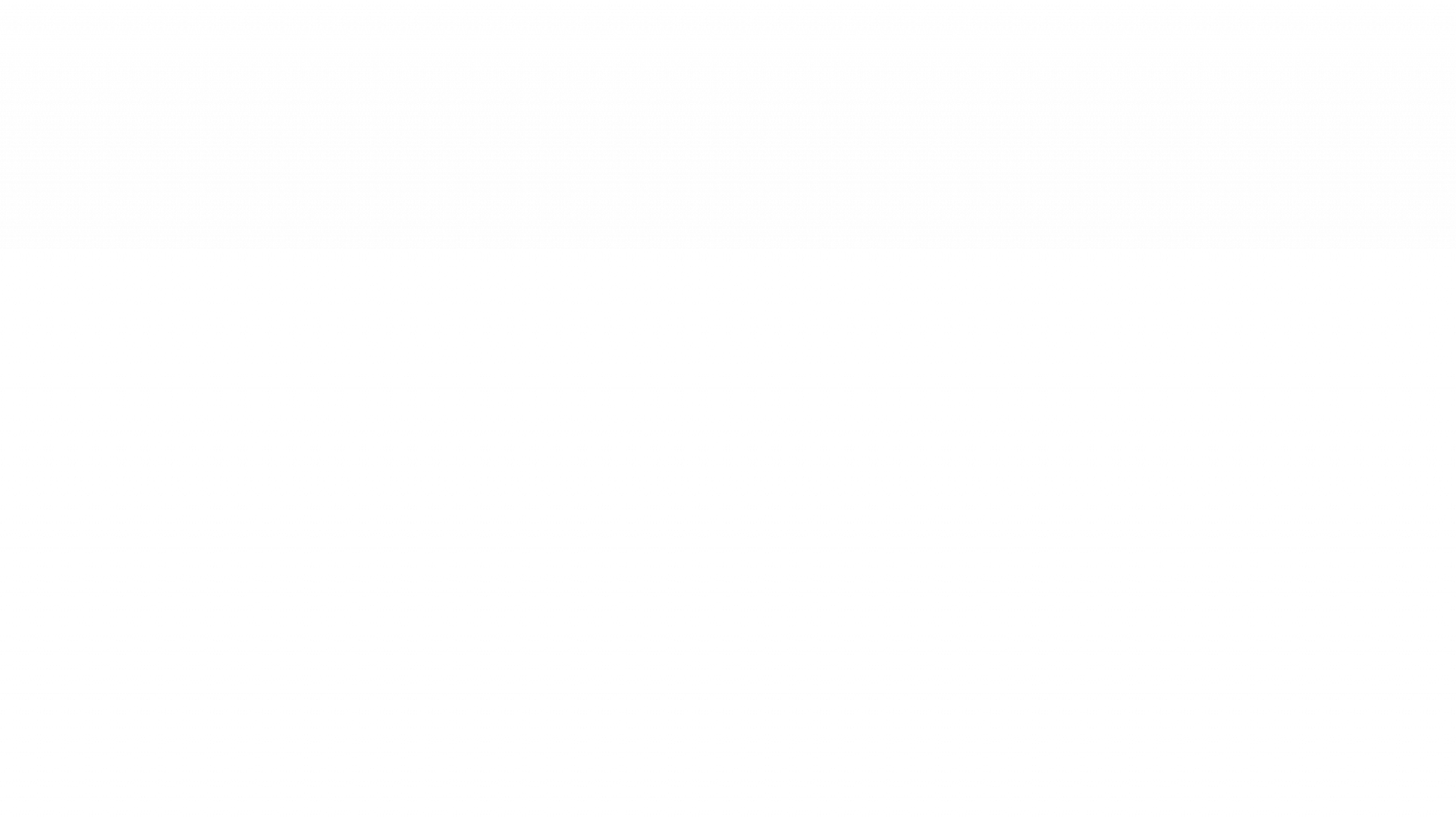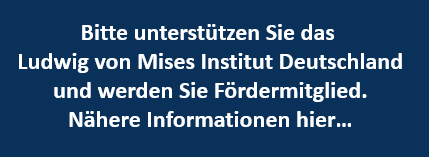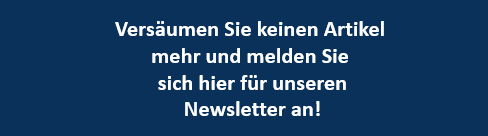Was Europa anders werden ließ
11. April 2025 – von Ralph Raico
[HIER KLICKEN, um den Beitrag als PODCAST-Folge ANZUHÖREN.]
[Anmerkung der Redaktion: In dieser Auswahl aus „The Struggle for Liberty: A Libertarian History of Political Thought“ („Der Kampf um die Freiheit: Eine libertäre Geschichte des politischen Denkens“) stellt Ralph Raico die Idee vor, dass das westliche Europa einzigartig darin war, wie es mit der Macht der Zivilregierung umging und versuchte, sie zu begrenzen. Wie wir später in diesem Kapitel sehen werden, verortet Raico die Ursprünge des westlichen Freiheitsbewusstseins im Mittelalter, einer Zeit, die durch politische Dezentralisierung und einen heilsamen Konflikt zwischen weltlichen Regierungen und kirchlicher Macht gekennzeichnet war].
Als erstes muss man über den Liberalismus festhalten, dass er in Europa, insbesondere in der westlichen Christenheit, entstanden ist. Das ist das Europa, welches einst in der Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom gewachsen ist, so dass die Geschichte Europas und die Geschichte des Liberalismus eng miteinander verbunden sind. Die Frage nach dem Warum hat zu einer umfangreichen Literatur geführt. Dieser Ansatz, der versucht herauszufinden, warum Europa anders war, warum Europa sich von anderen unterschied, wird manchmal als der institutionelle Ansatz der Wirtschaftshistoriker bezeichnet. Dieses Phänomen könnte als ‚das europäische Wunder‘ bezeichnet werden, nach dem Titel eines Buches eines der wichtigsten Autoren dieses Ansatzes, des australischen Wirtschaftshistorikers E.L. Jones.[1] Das fragliche Wunder besteht in einer einfachen aber bedeutsamen Tatsache: In Europa erreichten die Menschen zum ersten Mal über einen langen Zeitraum hinweg ein Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum. Auf diese Weise entkam die europäische Gesellschaft der Malthusischen Falle, und dies ermöglichte es neuen Dutzenden von Millionen – eigentlich Hunderten von Millionen – zu überleben, und es ermöglichte der Bevölkerung insgesamt, dem hoffnungslosen Elend zu entkommen, das in früheren Zeiten das Los des größten Teils der Menschheit war. Die Frage ist: Warum Europa? Warum hebt sich Europa auf diese Weise von anderen großen Zivilisationen ab: China, Indien, der Islam und so weiter? Geografische Faktoren spielten zweifellos eine Rolle, aber ich denke, dass Mises den Finger auf den wesentlichen Punkt legte, als er Folgendes schrieb:
Dem Osten fehlte die Grundidee, die Idee der Freiheit vom Staat. Der Osten hat nie die Fahne der Freiheit hochgehalten, er hat nie versucht, die Rechte des Individuums gegen die Macht der Herrschenden zu betonen. Er hat nie die Willkür der Despoten in Frage gestellt. Und vor allem hat er nie den rechtlichen Rahmen geschaffen, der das Vermögen der Bürger vor der Beschlagnahmung durch die Tyrannen schützen würde.[2]
Mises war nicht in erster Linie Historiker. Meiner Meinung, nach allem, was ich weiß, war er der größte Ökonom des 20. Jahrhunderts. Andererseits hatte er die Fähigkeit, ein historisches Problem auf eine Weise zu lösen, die ihn von anderen, professionellen Historikern absetzte. Wenn wir später über die Industrielle Revolution sprechen, werden wir darauf zurückkommen. Die Frage bleibt: Warum befand sich Europa in einer solchen Situation? Nun, einer der Autoren dieser allgemeinen Denkschule – es ist eine internationale Strömung: Amerikaner, Briten, Franzosen, Australier – ist Jean Baechler aus Paris. Baechler hat das in seiner Pionierarbeit sehr treffend ausgedrückt, als er sagte:
Die erste Bedingung für die Maximierung der wirtschaftlichen Effizienz ist die Befreiung der Zivilgesellschaft gegenüber dem Staat. Die Ausbreitung des Kapitalismus verdankt ihren Ursprung und ihre Daseinsberechtigung der politischen Anarchie.[3]
Wir werden sehen, was das bedeutet. Einer der Entwickler dieses Ansatzes ist Douglass North, der für seine Arbeiten auf diesem Gebiet der Wirtschaftsgeschichte mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet wurde. North schrieb, in Europa „war es gerade das Fehlen einer groß angelegten politischen Ordnung, die das Umfeld schuf, das für wirtschaftliches Wachstum und letztlich für menschliche Freiheiten unerlässlich war“.[4] Dieser institutionelle Ansatz wurde von John Hicks, dem Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften, in den späten 1960er Jahren vorgeschlagen. Aber die Grundzüge dieser Sichtweise wurden von dem großen Wirtschaftshistoriker David Landes skizziert, der heute emeritierter Professor der Harvard University ist – übrigens kein klassischer Liberaler. Aber er ist ein guter Historiker und hat ein Buch mit dem Titel The Unbound Prometheus veröffentlicht. Landes sagte:
Zwei Faktoren unterschieden Europa vom Rest der Welt: Der Umfang und die Effektivität des privaten Unternehmertums und der hohe Wert, der auf die rationale Beeinflussung der menschlichen und materiellen Umwelt gelegt wurde. … Die Rolle der Privatwirtschaft im Westen ist vielleicht einzigartig, mehr als jeder andere Faktor, der die moderne Welt geschaffen hat.[5]
Doch warum gab es Spielraum und Möglichkeit für privates Unternehmertum? Landes verweist auch auf die radikale Dezentralisierung Europas, die Baechler als politische Anarchie bezeichnet hatte. So schreibt er:
Aufgrund dieser entscheidenden Rolle in einem Kontext zahlreicher konkurrierender Staaten (im Gegensatz zu den Imperien des Orients und der Antike) besaß das private Unternehmertum im Westen eine politische und soziale Vitalität, die ohne Beispiel und Gegenstück war.[6]
Natürlich war es keine lineare Entwicklung hin zu einer Art freiheitlicher Utopie. Aber wir sprechen hier relativ und im Gegensatz zu anderen Zivilisationen. Behalten Sie das im Hinterkopf. Es gibt eine radikale Dezentralisierung, die auf einem Kontext mehrerer konkurrierender politischer Systeme beruht. Baechler, wie andere auch, sagt, dass dies das entscheidende Nichtereignis der europäischen Geschichte ist. Nach dem Untergang Roms konnte sich in Europa kein Imperium bilden, das die Hegemonie über den Kontinent erlangen konnte. Es gab zwar ab und zu Versuche, aber nie ein universelles Imperium. Stattdessen entwickelte sich Europa zu einem Mosaik aus Königreichen, Fürstentümern, Stadtstaaten, kirchlichen Herrschaftsgebieten und anderen politischen Einheiten. Innerhalb dieses Systems war es für jeden Fürsten höchst unklug, zu versuchen, die Eigentumsrechte so zu verletzen, wie es anderswo auf der Welt üblich war. Und diese Autoren – das möchte ich noch einmal betonen – sind in den meisten Fällen keine ‚doktrinären‘, wenn man es so nennen will, Libertären oder Marktwirtschaftler. Sie sind einfach sehr gute Historiker und sie sprechen über das übliche Verhalten von Staaten, das auf räuberischer Besteuerung und ständiger Enteignung beruht. Im Laufe der Geschichte haben die Staaten in manchen Gegenden so gehandelt wie die Mafia: Sie haben sich oft jemanden herausgepickt, der sich von den anderen abhebt, der über ein größeres Vermögen verfügt – ein erfolgreicher Arzt oder ein kleiner Geschäftsmann – und dann begann die Erpressung mit ihm. Das ist es, was Staaten in der Geschichte üblicherweise getan haben: Enteignung und räuberische Besteuerung. Die Staaten besteuern das Opfer, soweit dies möglich ist. Im Falle des späten Römischen Reiches ging die Besteuerung manchmal über das hinaus, was selbst für einen Raubtier-Staat natürlich und rational war. Die Opfer starben an übermäßiger Besteuerung oder Regulierung und Inflation.
Was hat die Dezentralisierung Europas damit zu tun? Sie schuf die unabdingbare Voraussetzung für das, was wir das europäische Wunder nennen, nämlich die Möglichkeit des Ausstiegs [Englisch: exit] – ein Begriff, den diese Gelehrten verwenden. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie sind ein erfolgreicher Geschäftsmann in Antwerpen oder Amsterdam und werden vom Staat bedrängt, indem er Ihr Vermögen enteignet oder stark besteuert. In Westeuropa konnten Sie ‚aussteigen‘. Sie konnten aussteigen, ohne den gesamten Kulturraum des christlichen Europas zu verlassen. Man musste nicht in eine völlig andere Zivilisation gehen. Man konnte über die Nordsee nach England gehen, man konnte den Rhein hinunter zum Erzbistum Köln gehen. Diese Möglichkeit der Ausreise galt generell für die italienischen Stadtstaaten. Es war sehr einfach, von einem zum anderen zu gehen, je nachdem, wie der Staat einen dort behandelte. Dies galt nicht in jedem Fall, aber es war ein konstanter Faktor, und die Möglichkeit des Ausstiegs schuf Grenzen für das, was der Staat seinen produktiven Bürgern antun konnte.
Nun, diese Geschichte reicht viele Jahrhunderte zurück. Sie reicht bis ins Mittelalter zurück, und diese historische Interpretation, die ich Ihnen hier gebe, ist übrigens auch die Grundlage für die Arbeiten anderer Wissenschaftler gewesen. Der große Peter Bauer zum Beispiel geht in seinem Werk über die wirtschaftliche Entwicklung in Europa im Vergleich zur wirtschaftlichen Entwicklung der Dritten Welt schlichtweg von dieser grundlegenden Interpretation aus, warum Europa reich geworden ist.[7] Paul Kennedy aus Yale geht in seinem Buch über den Aufstieg und Niedergang der großen Reiche von dieser Interpretation aus.[8] Auch William McNeill aus Chicago und seine anderen synthetischen Werke zur europäischen Geschichte gehen von dieser Interpretation aus.[9] Und Peter Bauer schrieb in einem seiner Aufsätze, dass diese wirtschaftliche Entwicklung mindestens sieben bis acht Jahrhunderte zurückreicht, also bis ins Mittelalter.[10] Wir müssen also etwas über das Mittelalter herausfinden, um zu erklären, warum Europa anders war. Tatsächlich entstand im Mittelalter das, was wir Europa nennen – nicht der geografische Kontinent, sondern Europa, die Zivilisation.
Hier gibt es eine Reihe von wichtigen Faktoren. Der Feudalismus, d. h. die europäische Variante des Feudalismus, spielte eine Rolle. In Russland zum Beispiel gab es einen Adel, der jedoch auf staatlich ernannten Herzögen, Erzherzögen, Grafen usw. beruhte. In Europa beruhte der Feudalismus auf einer vertraglichen Beziehung zwischen mächtigen Lords und dem König – vertraglich, d. h. es gab Obliegenheiten und Pflichten auf beiden Seiten. Bereits zu dieser Zeit wurden dem Handeln des Fürsten oder Königs gewisse Grenzen gesetzt. In jedem dieser Herrschaftsbereiche, die ohnehin relativ klein waren, kam es häufig zu einem Kampf zwischen den Mächten, der zur Herausbildung besonderer europäischer Institutionen führte. Auch dies war ein Teil dessen, was Europa ausmachte.
Es gab repräsentative Organe, die die Steuerzahler vertraten, was in anderen Zivilisationen nicht der Fall war. Es gab Parlamente. In Frankreich die Generalstände oder die Stände der Provinzen. In Kastilien gab es die Cortes. Diese Gremien gab es in ganz Europa. Ich glaube, es gab kein Gebiet in Europa, in dem es nicht ein solches parlamentarisches Vertretungsorgan gab. Sicherlich gab es sie in den verschiedenen Teilen der niederländischen Länder und auch in Skandinavien. Kastilien hatte eine Cortes, wie ich bereits erwähnte, aber auch in Aragon gab es eine Cortes. Es gab ein Parlament in Sizilien, in Neapel, in den deutschen Staaten, in Ungarn und in Polen.
Den Fürsten waren oft die Hände gebunden, da sie gezwungen waren, ihren Untertanen bestimmte Rechte einzuräumen. Die Magna Carta ist die bekannteste dieser Chartas, aber es gibt auch ein berühmtes ähnliches Dokument, den Freudigen Eintritt von Brabant, dem jeder Herrscher des heutigen Belgiens, der Niederlande und Hollands bei seinem Amtsantritt zustimmen musste. Darin wurde festgelegt, dass ohne die Zustimmung der verschiedenen Landtage der verschiedenen Teile des heutigen Belgiens und der Niederlande keine neuen Steuern erhoben werden durften. Es durften keine neuen Zölle eingeführt werden, die den Traditionen der Gebiete zuwiderliefen, es durfte keine ausländischen Amtsträger geben und so weiter. Mit anderen Worten, wir hatten in diesem sehr wichtigen Gebiet der Niederlande etwas, das der Magna Carta ähnelte.
Entscheidend für die gesamte besondere Entwicklung Europas war vielleicht vor allem die Existenz einer mächtigen internationalen Kirche, deren Interessen nicht gleichlaufend mit den Interessen des Staates waren und oft auch nicht wirklich mit ihnen vereinbar waren. Lord Acton, der Katholik war, betonte dies, aber man muss nicht Katholik sein, um dem zuzustimmen. Es geht um die Frage, was eigentlich die historische Entwicklung ist. Man kann Freidenker sein, man kann Protestant sein, und in der Tat gibt es heute Gelehrte, die überhaupt keine Christen sind, die meinen, dass die Rolle der katholischen Kirche entscheidend war. Anders sieht es aus, wenn wir über die Kirche nach der Reformation oder insbesondere nach der Französischen Revolution sprechen. Zu diesem späteren Zeitpunkt kam es zu einer Annäherung der Kirche an den Staat, insbesondere an die katholischen Herrscher, und Kirche und Staat gingen Hand in Hand.
[1] Siehe Jones, The European Miracle: Environments, Economies and Geopolitics in the History of Europe and Asia (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), S. 118
[2] Ludwig von Mises, Money, Method, and the Market Process (Norwell, MA: Kluwer Academic Publishers, 1990), S. 311.
[3] Jean Baechler, Die Ursprünge des Kapitalismus, übers. Barry Cooper (Oxford: Blackwell, 1975), S. 77, 113.
[4] Douglass North, „The Rise of the Western World“, in Political Competition, Innovation and Growth: Eine historische Analyse, ed. Peter Bernholz, Manfred E. Streit, und Roland Vaube (Heidelberg: Springer, 1998), S. 22
[5] David Landes, The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present (Cambridge: Cambridge University Press, 1969), S. 15.
[6] Ebd.
[7] P.T. Bauer, From Subsistence to Exchange and Other Essays (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000).
[8] Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000 (New York: Vintage, 1987).
[9] William McNeill, The Pursuit of Power: Technology, Armed Forces and Society since A.D. 1000 (Chicago: University of Chicago Press, 1982).
[10] Bauer, Dissent on Development (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1976), S. 277, 299-302. Bauer stellt in mehreren Beispielen fest, dass die Unterschiede in der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen Westeuropa und anderen Regionen im Mittelalter beginnen. Diese Beschleunigung der wirtschaftlichen Entwicklung im mittelalterlichen Europa gibt Aufschluss über die modernen Volkswirtschaften, und Bauer kommt zu dem Schluss, dass „eine gute Kenntnis der europäischen und mediterranen Wirtschaftsgeschichte seit dem Mittelalter für das Verständnis der sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen in vielen Teilen der heutigen Welt hilfreich ist“ (S. 277).
Dieser Beitrag ist am 27. März 2025 unter dem Titel „What Made Europe Different“ auf der Homepage des Mises Institute, Auburn, Alabama, erschienen. Übersetzt von Florian Senne.
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Instituts Deutschland wieder.
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Das Ludwig von Mises Institut Deutschland e.V. setzt sich seit Jahren für die Verbreitung der Lehre der Österreichischen Schule der Nationalökonomie ein. Freiheit gibt es nicht geschenkt, sie muss stets neu errungen und erhalten werden. Bitte unterstützen Sie daher das Ludwig von Mises Institut Deutschland mit einer Spende, damit wir uns weiterhin für unser aller Freiheit einsetzen können!
Spendenkonto:
Ludwig von Mises Institut Deutschland e. V.
IBAN: DE68 7003 0400 0000 1061 78
BIC: MEFIDEMM
Merck Finck A Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch
Verwendungszweck: Spende
Titel-Foto: Adobe Stock – bearbeitet