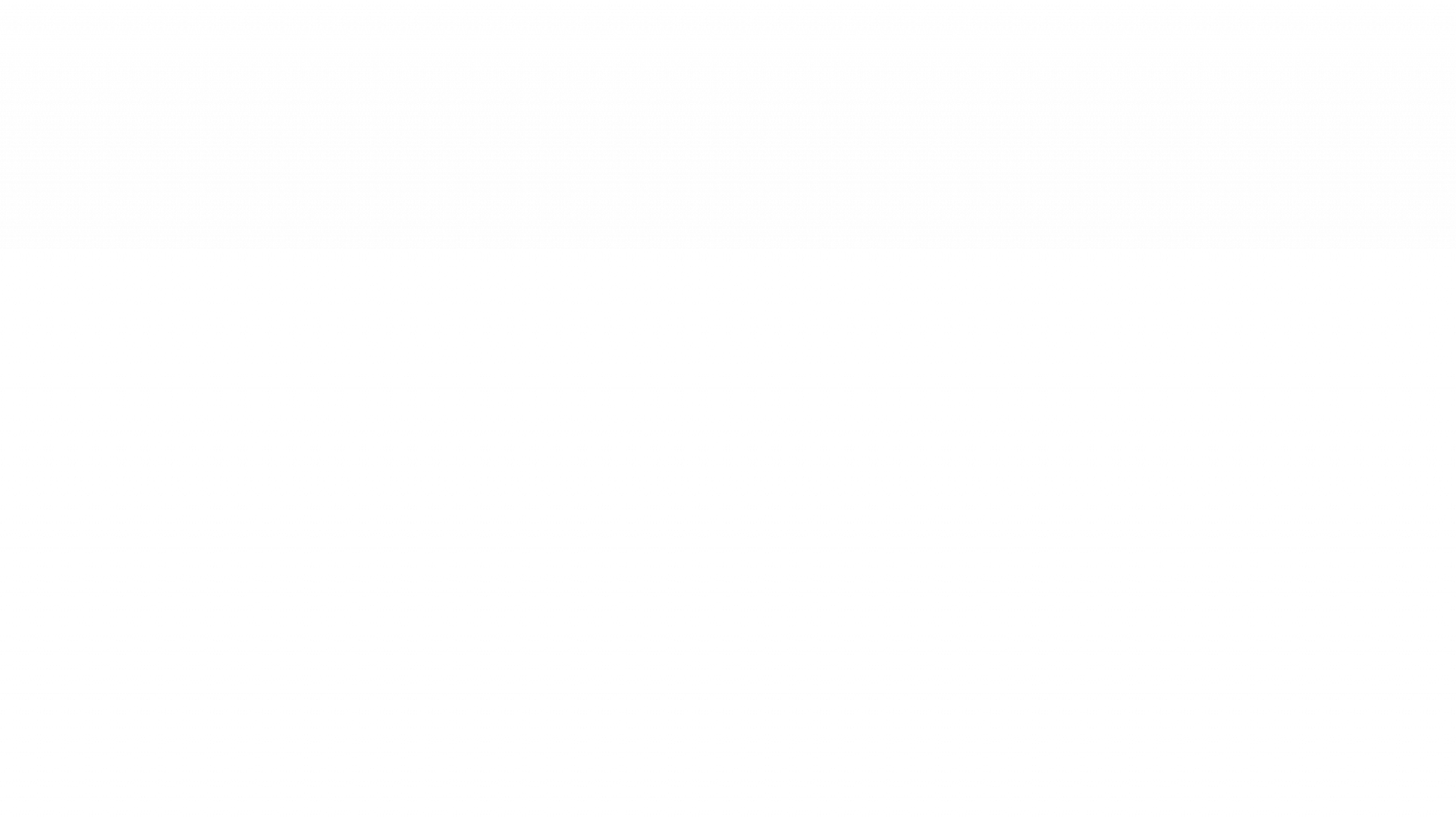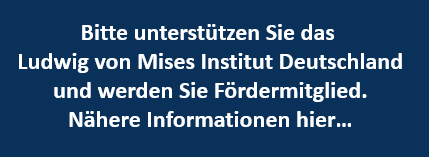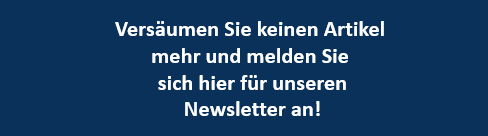Elon Musk: Geld wird irrelevant. Warum das unwahrscheinlich ist
28. November 2025 – von Thorsten Polleit
Titelbild: Elon Musk mit Optimus-Roboter, KI-generiert von Grok (built by xAI) am 26. November 2025
[HIER KLICKEN, um den Beitrag als PODCAST-Folge anzuhören.]
Auf dem U.S.-Saudi Investment Forum am 19. November 2025 ließ Unternehmer-Titan Elon Musk seine Zuschauer wissen, welche Zukunftsperspektiven er mit dem Fortschreiten der Künstlichen Intelligenz („KI“, Englisch: „Artificial Intelligence“, oder kurz: „AI“) verbindet. Musk sagte unter anderem:
And my guess is, if you go out long enough—assuming there’s a continued improvement in AI and robotics, which seems likely—money will stop being relevant.
Wow: Eine Zukunft, in der Geld keine Rolle (mehr) spielt? Ist das möglich, oder ist es zumindest wahrscheinlich? Um diese Fragen zu beantworten, rufen wir uns doch zunächst einmal in Erinnerung, aus welchen Gründen die Menschen Geld nachfragen, und das schon seit Jahrtausenden.
In den handelsüblichen Lehrbüchern werden drei Motive genannt, die die Menschen veranlassen, Geld zu halten: Tauschmittelfunktion, Rechenfunktion und Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes. Allerdings gibt es einen Grund für die Geldnachfrage, der all diesen genannten vorausgeht, der sie letztlich bestimmt. Und das ist die Unsicherheit oder Ungewissheit im Bereich des menschlichen Handelns.
Wäre alles perfekt vorhersehbar, bräuchten die Menschen tatsächlich kein Geld. Jeder wüsste dann nämlich heute schon alles über seine künftigen Ziele, Bedürfnisse, seine verfügbaren Mittel, deren Preise etc. In einem solchen Fall könnten wir schon heute alles so arrangieren, dass unsere künftige Güternachfrage entsprechend unseren Präferenzen mit den verfügbaren Gütern bedient wird.
Wenn aber die Zukunft ungewiss ist, dann ist der Mensch gerade nicht in der Lage, heute schon alles zu wissen, was er künftig bedarf, was er künftig nachzufragen wünscht. Vielmehr muss er dann bereits im Hier und Heute mit künftigen Veränderungen rechnen, die er noch nicht kennt, oder die er nicht vollumfänglich abschätzen und bemessen kann, und für sie vorsorgen. Und genau das ist auch der Grund — die Ungewissheit über das Zukünftige —, warum Menschen Geld nachfragen.
Ludwig von Mises (1881–1973) schreibt dazu:
Denn nur weil es Veränderung gibt und über Art und Ausmass der Veränderung Ungewissheit besteht, muss der Einzelne Kasse halten. [1]
Das Halten von Geld gibt den Menschen die Möglichkeit, mit der künftigen Ungewissheit umzugehen. Es macht jeden einzelnen tauschfähig(er), er kann auf veränderte Situationen in der für ihn bestmöglichen Weise reagieren.
Natürlich kann die Vorsorge für unsichere Ereignisse und Umstände in der Zukunft auch mit „normalen Gütern“ (Nahrungsmittel, Kleidung etc.) bewerkstelligt werden. Doch mit dem Halten von Geld ist das eben besonders einfach und effizient — denn Geld ist schließlich das allgemein akzeptierte Tauschmittel, ist das marktfähigste Gut von allen.
Musks Äußerung, Geld könnte verzichtbar werden (und damit wohl auch seine Kaufkraft einbüßen), setzt also voraus, dass die Ungewissheit über Künftiges im Bereich des menschlichen Handelns verschwinden kann (oder wird). Zunächst mag man vielleicht geneigt sein, so etwas als Folge von AI, Robotik (oder anderer Technologiesprünge) für möglich zu halten. Doch eine solche Schlussfolgerung lässt sich bei genauerem Nachdenken nicht vertreten.
Der eine Grund ist: Die Natur, in der der Mensch lebt, lässt sich (erfahrungsgemäß) nicht perfekt vorhersehen. Die Umstände ändern sich, nicht selten in ganz unvorhersehbarer Weise. Beispielsweise kommt es immer wieder zu Naturkatastrophen (Vulkanausbruch, Überschwemmung etc.). Oder Regionen, die bisher unwirtlich waren, werden durch Veränderung der Witterungsverhältnisse plötzlich bewohnbar und bebaubar. Die Natur hat sehr häufig Unsicherheit, Ungewissheit im Gepäck, mit der der Mensch umgehen muss.
Der andere — für die hier behandelte Frage entscheidende — Grund ist jedoch: Das menschliche Handeln selbst lässt sich nicht (mit wissenschaftlichen Mitteln) prognostizieren. Schon Ludwig von Mises stellte heraus, dass das menschliche Handeln nicht auf der Basis innerer oder äußerer Faktoren (biologischer, chemischer Art) vorhersagbar sei:
Die Wissenschaft des menschlichen Handelns geht von der Tatsache aus, dass Menschen absichtsvoll Ziele anstreben, die sie gewählt haben. Es ist genau dieses, das alle Spielarten des Positivismus, Behaviorismus und Panphysikalismus entweder allesamt leugnen oder es stillschweigend übergehen. Nur, es wäre einfach verrückt, die Tatsache zu leugnen, dass Menschen offenkundig sich verhalten, als ob sie wirklich auf bestimmte Ziele zustreben. Diese Leugnung der Zielgerichtetheit des menschlichen Verhaltens kann nur aufrechterhalten werden, wenn man annimmt, dass die Wahl beider, von Zielen und Mitteln, nur scheinbar sei und dass menschliches Verhalten letztlich determiniert ist durch physiologische Geschehnisse, die ganz in der Sprache der Physik und Chemie beschrieben werden kann.
Sogar die fanatischsten Anhänger der Sekte der ‚Einheitswissenschaft‘ schrecken davor zurück, für diese plumpe Formulierung ihrer grundlegenden These unzweideutig einzustehen. Es gibt gute Gründe für diese Zurückhaltung. So lange noch keine bestimmte Beziehung zwischen Ideen und physikalischen oder chemischen Geschehnissen entdeckt worden ist, die als regelmäßige Abfolge auftritt, bleibt die positivistische These eine erkenntnistheoretische Behauptung, die nicht von wissenschaftlich gebauten Experimenten abgeleitet ist, sondern aus einer metaphysischen Weltsicht.[2]
Hans Hermann Hoppe gab Mises‘ Argument nachfolgend die rigorose (handlungs-)logische Basis. Und zwar mit der Aussage, dass der Mensch sich durch Lernfähigkeit auszeichnet.[3] Lernfähigkeit bedeutet zunächst einmal, dass der Handelnde seine künftigen Wissensbestände und die aller anderen nicht schon heute vollumfänglich kennen kann — die er aber kennen müsste, um sein künftiges Handeln und das Handeln der anderen, das zweifelsfrei durch künftige individuelle Wissensbestände bestimmt ist, vorherzusagen.
Der Grund: Man kann die Lernfähigkeit des handelnden Menschen nicht widerspruchsfrei verneinen; die Negation der Aussage „Ich kann lernen“ ist logisch widersprüchlich, sie gilt vielmehr a priori.
Wenn du sagst „Der Mensch ist nicht lernfähig“, dann begehst du damit einen performativen Widerspruch: Indem du diese Aussage triffst, gehst du davon aus, dass dein Gesprächspartner das Gesagte noch nicht kennt, es aber lernen kann — sonst würdest du diese Aussage ja nicht machen.
(Übrigens: Lehrer, Professoren, Wissenschaftler insbesondere: Sie alle gehen davon aus, dass der Mensch lernfähig ist. Ansonsten würden sie ja (für sich und/oder andere) gar nicht erst versuchen, neues zu entdecken und zu verbreiten. Würden sie die Lernfähigkeit verneinen, wären sie Zyniker, vielleicht sogar Scharlatane, Betrüger.)
Und wenn du sagst „Der Mensch kann lernen nicht zu lernen“, dann unterstellst du Lernfähigkeit, dass man also lernen kann, dass man nicht lernen kann — und sagst damit ganz offensichtlich etwas Falsches, begehst einen offenen Widerspruch.
Wenn man also die Lernfähigkeit des handelnden Menschen nicht widerspruchsfrei verneinen kann, sie aus logischen Gründen wahr ist, dann kann man auch nicht schon heute wissen, wie künftig gehandelt wird: Der Handelnde kennt weder seinen eigenen Wissenstand in der Zukunft, der sein Handeln bestimmen wird, noch kann er die Wissensbestände seiner Mitmenschen heute schon kennen, die deren künftige Handlungen hervorbringen.
Man mag vielleicht der Ansicht sein, dass der Mensch das Wirken der künftigen Naturkräfte perfekt wird prognostizieren, in den Griff bekommen kann; trefflich lässt sich eine solche Vorstellung debattieren. Was sich aber nicht vertreten lässt, ist, dass das künftige menschliche Handeln vorhersagbar wird wie eine Impuls-Antwort-Funktion — nach dem Motto „Wenn A geschieht, dann folgt B“.
Damit ist natürlich nicht gesagt, dass alles im Bereich des menschlichen Handelns unsicher, nicht prognostizierbar wäre — genauso wenig wie es nicht bedeutet, dass alles gewiss wäre.[4] Vielmehr muss es aus rein logischen Gründen Unsicherheit geben, wenn es so etwas wie Sicherheit gibt; und entsprechend muss es Sicherheit geben, wenn es so etwas wie Unsicherheit gibt — denn das eine lässt sich nicht ohne das andere denken.
Die Logik des menschlichen Handelns sagt uns, dass es im Bereich des menschlichen Handelns Dinge gibt, die wir mit apodiktischer Gewissheit wissen. Etwa das der Mensch handelt; dass der Handelnde Ziele anstrebt, die er mit dem Einsatz von Mitteln zu erreichen sucht; dass Mittel knapp sind; dass Handeln notwendigerweise Zeit erfordert, Zeit also für den Handelnden ein unverzichtbares Mittel ist; und anderes mehr.
Die Logik des menschlichen Handelns informiert uns aber auch darüber: Wir können wissenschaftlich gesehen nicht mit Gewissheit wissen, wie und wann der Mensch künftig handelt — und der Grund dafür ist, dass der Mensch lernfähig ist, eine Aussage, die sich nicht widerspruchsfrei verneinen lässt, die a priori gilt.
Solange das künftige menschliche Handeln unter Unsicherheit stattfindet, es im Bereich des menschlichen Handelns Dinge gibt, die der Unsicherheit unterliegen, ist auch der Grund dafür gegeben, dass auch in der Zukunft (wie immer sie technologisch aussehen wird) die Menschen (weiterhin) Geld nachfragen; dass also das Geld für sie einen Wert hat, dass es nicht irrelevant für sie wird und werden kann.
Oder denkt Elon Musk etwa daran, dass die künftigen Menschen eine „andere Logik“ als wir heute haben werden? Das wäre schwer oder gar nicht denk- und vorstellbar für uns. Denn „unsere Logik“ ist ja die Voraussetzung für jedes kohärente Denken überhaupt. Man kann den Satz „Logik könnte sich ändern“ nicht einmal formulieren, ohne sich dabei auf die Logik, auf den Satz vom Widerspruch (wonach derselbe Satz nicht zugleich wahr und falsch sein kann, im selben Sinn und zur selben Zeit) zu berufen.
Jedes zukünftige Wesen (Mensch, Postmensch, KI-Wesen, Alien etc.), das aus unserer Sicht kohärent denken, kommunizieren oder Wissenschaft betreiben kann, müsste dieselben grundlegenden logischen Prinzipien benutzen, die wir auch benutzen, weil diese Prinzipien für uns erst kohärentes Denken möglich machen.
Man mag durchaus spekulieren: Vielleicht werden künftig superintelligente KIs oder hochgeladene Bewusstseine in einer Weise denken, die für uns buchstäblich unvorstellbar ist, mit einer „neuen Logik“ operieren. Aber schon solch ein Gedanke steht auf dem Boden der uns bekannten Logik: Jedes Wesen, das den Anspruch formuliert „unsere Logik ist anders als eure“, setzt nämlich bereits „unsere“ logischen Kategorien wie Identität und Unterschied voraus.
Hätte unser Gegenüber eine andere Logik als die unsrige, es wäre für uns sehr wahrscheinlich gar nicht zu verstehen, wie auch sollten wir uns mit ihm verständigen? Überhaupt wäre fraglich, ob ein solches Gegenüber uns als menschlich erscheinen würde und könnte. Wenn also Elon Musk tatsächlich damit rechnet, dass irgendwann das Geld für die Menschen irrelevant wird, dann kann das wohl nur in einer für uns nicht verstehbaren Welt stattfinden, in der die Logik des menschlichen Handelns nicht mehr gilt.
[1] Mises, L. v. (1940), Nationalökonomie. Theorie des Handelns und Wirtschaftens, Genf, S. 377.
[2] Mises, L. v. (2014), Theorie und Geschichte. Eine Interpretation sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung, Akston Verlags GmbH, München, S. 62–63.
[3] Siehe hierzu Hoppe, H. H. (1983), Kritik der kausalwissenschaftlichen Sozialforschung. Untersuchungen zur Grundlegung von Soziologie und Ökonomie, Westdeutscher Verlag.
[4] Siehe Hoppe, H. H. (1997), On Certainty and Uncertainty, Or: How Rational Can Our Expectations Be?, in: Review of Austrian Economics 10, no. 1, S. 49–78.
 Professor Dr. Thorsten Polleit war als Ökonom 15 Jahre im internationalen Investment-Banking tätig und danach 12 Jahre im internationalen Edelmetallhandelsgeschäft. Er ist zudem seit 2014 Honorarprofessor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth. Thorsten Polleit ist Adjunct Scholar Mises Institute, Auburn, Alabama, Mitglied im Forschungsnetzwerk „ROME“ und Präsident des Ludwig von Mises Institut Deutschland. Im Jahr 2012 erhielt er den The O.P. Alford III Prize In Political Economy. Thorsten Polleit ist Autor zahlreicher Aufsätze in referierten Journals, Magazinen und Zeitungen. Seine letzten Bücher sind: „Des Teufels Geld. Der faustische Fiatgeld-Pakt – wie wir ihn kündigen und zu gutem Geld zurückkehren“(*) (Oktober 2023), „The Global Currency Plot. How the Deep State Will Betray Your Freedom, and How to Prevent It“(*) (2023), „Ludwig von Mises. Der kompromisslose Liberale“(*) (2022) und „Der Weg zur Wahrheit. Eine Kritik der ökonomischen Vernunft“(*) (2022). Seit April 2024 gibt er Dr. Polleits BOOM & BUST REPORT heraus. Hier Thorsten Polleit auf Twitter folgen.
Professor Dr. Thorsten Polleit war als Ökonom 15 Jahre im internationalen Investment-Banking tätig und danach 12 Jahre im internationalen Edelmetallhandelsgeschäft. Er ist zudem seit 2014 Honorarprofessor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth. Thorsten Polleit ist Adjunct Scholar Mises Institute, Auburn, Alabama, Mitglied im Forschungsnetzwerk „ROME“ und Präsident des Ludwig von Mises Institut Deutschland. Im Jahr 2012 erhielt er den The O.P. Alford III Prize In Political Economy. Thorsten Polleit ist Autor zahlreicher Aufsätze in referierten Journals, Magazinen und Zeitungen. Seine letzten Bücher sind: „Des Teufels Geld. Der faustische Fiatgeld-Pakt – wie wir ihn kündigen und zu gutem Geld zurückkehren“(*) (Oktober 2023), „The Global Currency Plot. How the Deep State Will Betray Your Freedom, and How to Prevent It“(*) (2023), „Ludwig von Mises. Der kompromisslose Liberale“(*) (2022) und „Der Weg zur Wahrheit. Eine Kritik der ökonomischen Vernunft“(*) (2022). Seit April 2024 gibt er Dr. Polleits BOOM & BUST REPORT heraus. Hier Thorsten Polleit auf Twitter folgen.
[(*) Mit * gekennzeichnete Links sind Partner-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, unterstützen Sie das Ludwig von Mises Institut Deutschland, das mit einer Provision beteiligt wird. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten.]
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Instituts Deutschland wieder.
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Das Ludwig von Mises Institut Deutschland e.V. setzt sich seit Jahren für die Verbreitung der Lehre der Österreichischen Schule der Nationalökonomie ein. Freiheit gibt es nicht geschenkt, sie muss stets neu errungen und erhalten werden. Bitte unterstützen Sie daher das Ludwig von Mises Institut Deutschland mit einer Spende, damit wir uns weiterhin für unser aller Freiheit einsetzen können!
Spendenkonto:
Ludwig von Mises Institut Deutschland e. V.
IBAN: DE68 7003 0400 0000 1061 78
BIC: MEFIDEMM
Merck Finck A Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch
Verwendungszweck: Spende
Titelbild: Elon Musk mit Optimus-Roboter, KI-generiert von Grok (built by xAI) am 26. November 2025