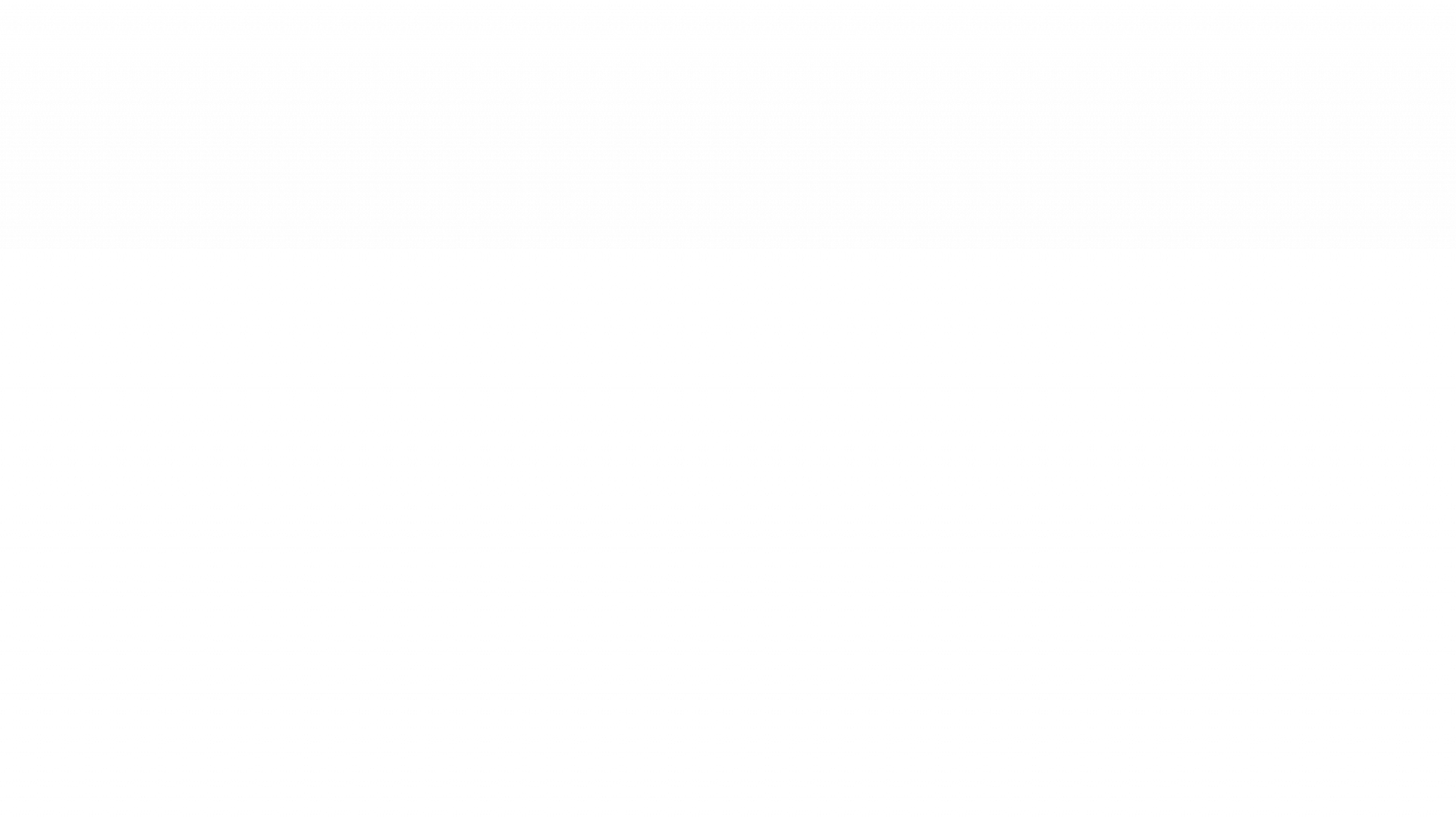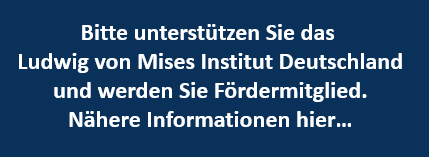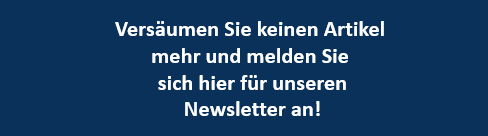Der Markt kann nicht simuliert werden!
27. Oktober 2025 – von Rainer Fassnacht
Es gibt zahlreiche – teils offensichtliche, teils kaum als solche erkennbare – Situationen, in denen Menschen versuchen, den Markt zu simulieren. Das bekannteste und zugleich offensichtlichste Beispiel ist die Planwirtschaft. In diesem Fall ist die Simulation kein „Versehen“, sondern ausdrücklich dazu gedacht, den Markt zu ersetzen.
Zu diesem besonders würzigen Kochrezept – beziehungsweise dieser Form der „Marktsimulation“ – gehören die Arbeitswertlehre, statistische Daten der Vergangenheit und Projektionen über zukünftige Bedarfe. Unglücklicherweise (für die vom Ergebnis dieser Politik Betroffenen) ist jede dieser Zutaten verdorben.
Die Arbeitswertlehre basiert auf widerlegten Annahmen über die Natur des Wertes und beinhaltet darüber hinaus zahlreiche weitere Denkfehler. Schon kurz nach der Veröffentlichung des dritten Bandes des Kapitals, zeigte Eugen von Böhm-Bawerk (1851 – 1914) diese Irrungen und Wirrungen im lesenswerten Aufsatz „Zum Abschluß des Marxschen Systems“ auf.
Statistischen Daten sind lediglich „Geschichtserzählungen“. Sie berichten ausschließlich von dem, was war. Ludwig von Mises (1881 – 1973) schrieb dazu in „Nationalökonomie“ (dem deutschen Vorläufer vom einflussreichen Werk „Human Action“):
Das statistische Material, das dem Wirtschafts- und Sozialstatistiker vorliegt, stammt nicht aus isolierenden Versuchen; es ist der zahlenmäßige Niederschlag geschichtlicher Vorgänge, deren Komplexität das Erkennen der Beziehungen einer Ursache und einer Wirkung nicht zulässt. (S. 51)
Und auch die von den zentralen Planern vorgenommenen Projektionen darüber, was künftig gebraucht wird, sind lediglich Trugbilder. Innerhalb des naturgegebenen Rahmens hängt die Zukunft von Handlungen auf Basis individueller Bewertungen der Verbraucher und der Unternehmer ab. Ein planender Ökonom kann zwar wissen, dass mehr Angebot unter sonst gleichen Bedingungen den Preis reduziert, aber er tappt im Dunkeln, ob oder wann dies eintreffen könnte.
Um im Bild zu bleiben: Wenn das Rezept falsch ist und die Zutaten verdorben, dürfen wir mit hoher Sicherheit annehmen, dass die zubereitete Mahlzeit keine Gaumenfreude wird – was die Praxis bestätigt hat. Die Bürger der DDR mussten jene ekelhafte Zubereitung auslöffeln, welche die Staatliche Plankommission zusammenkochte. Wollten sie vor Übelkeit davonlaufen, stand eine Mauer im Weg.
Wie bereits einleitend geschrieben, ist Planwirtschaft nur das bekannteste und zugleich offensichtlichste Beispiel für den zum Scheitern verurteilten Versuch, den Markt zu simulieren beziehungsweise durch etwas anders zu ersetzen. Doch es ist beileibe nicht das Einzige Beispiel.
Häufig erscheint die Marktsimulation in anderer, schwerer zu erkennender Form. Angebliches Marktversagen ist ein öfter anzutreffender Aufhänger, um Marktsimulation zu betreiben, statt den Prozess tatsächlich wirken zu lassen. Beispiele hierfür sind politisch gewährte Subventionen, die Maßnahmen der Kartellämter oder klimatechnisch begründete Eingriffe.
So unterschiedlich die genannten Interventionen erscheinen, haben sie doch eine entscheidende Gemeinsamkeit: Es wird angenommen, mit dem jeweiligen Eingriff etwas „Besseres“ erreichen zu können, als ohne die Intervention. Diese Annahme beruht auf einer bewussten oder unbewussten Marktsimulation (und vernachlässigt die Frage „Besser für wen?“).
Das einzig Sichere bei diesen und anderen marktsimulationsbasierten Eingriffen, ist der Eingriff selbst. Der Einsatz von Steuergeld, für Subventionen – beispielsweise für eine heimische Batteriefabrik – ist Fakt. Das angenommene Ergebnis bleibt oft nur eine Annahme, ist also meist Fiktion – ein Satz mit X, das war wohl nix.
Man kann fast schon von Glück sprechen, wenn ein Subventionsprojekt scheitert, bevor das Geld überhaupt verausgabt ist, wie dies bei grünem Stahl der Fall war. Nur sind diese „Das-ging-gerade-nochmal-gut-Beispiele“ ausgesprochen seltene Fälle, meist ist das Geld der Steuerzahler tatsächlich futsch, beziehungsweise in anderen Taschen gelandet.
Auch für das eigene Verhalten – beispielsweise beim Investieren an der Börse – kann die Erkenntnis nützlich sein, dass sich der Markt nicht simulieren lässt. Einzelne Marktteilnehmer sind zwar Elemente im Marktprozess und wirken auf dessen Ergebnis, aber dieses Ergebnis vorher zu kennen und entsprechen zu investieren kann dauerhaft nicht gelingen.
Selbst professionelle Investoren die Milliardensummen bewegen, das modernste technische Equipment und sämtliche bekannten „Börsenregeln“ nutzen, werden von nicht erwarteten Entwicklungen überrascht.
Da bekannt ist, dass nur der Markt das optimale Ergebnis liefern kann (weil hier freiwillige Tauschhandlungen stattfinden), ist der Versuch ihn zu ersetzen oder im Voraus „auf den Punkt“ zu berücksichtigen zum Scheitern verurteilt. Außerdem kann diese Erkenntnis dabei helfen, politische Interventionen zu bewerten und nicht enttäuscht zu sein, wenn es wiederholt nicht gelingt, Aktien genau zum Zeitpunkt des niedrigsten Kurses zu kaufen und zum Zeitpunkt des höchsten zu verkaufen.
Marktsimulationen jeglicher Form – von der Planwirtschaft bis zu Interventionen wegen vorgeblichem Marktversagen – sind freie Schöpfungen des menschlichen Geistes. Auch wenn es so aussehen mag, sind sie kein Ersatz für das tatsächliche Marktgeschehen auf Basis freiwilliger individueller Handlungen.
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Instituts Deutschland wieder.
Rainer Fassnacht ist Ökonom und freier Journalist. Er schreibt für verschiedene Printmedien und Onlineplattformen im In- und Ausland. Hauptthema seiner Artikel über ökonomische Themen ist die Bewahrung der individuellen Freiheit.
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Das Ludwig von Mises Institut Deutschland e.V. setzt sich seit Jahren für die Verbreitung der Lehre der Österreichischen Schule der Nationalökonomie ein. Freiheit gibt es nicht geschenkt, sie muss stets neu errungen und erhalten werden. Bitte unterstützen Sie daher das Ludwig von Mises Institut Deutschland mit einer Spende, damit wir uns weiterhin für unser aller Freiheit einsetzen können!
Spendenkonto:
Ludwig von Mises Institut Deutschland e. V.
IBAN: DE68 7003 0400 0000 1061 78
BIC: MEFIDEMM
Merck Finck A Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch
Verwendungszweck: Spende
Titel-Foto: Adobe Stock Fotos – bearbeitet