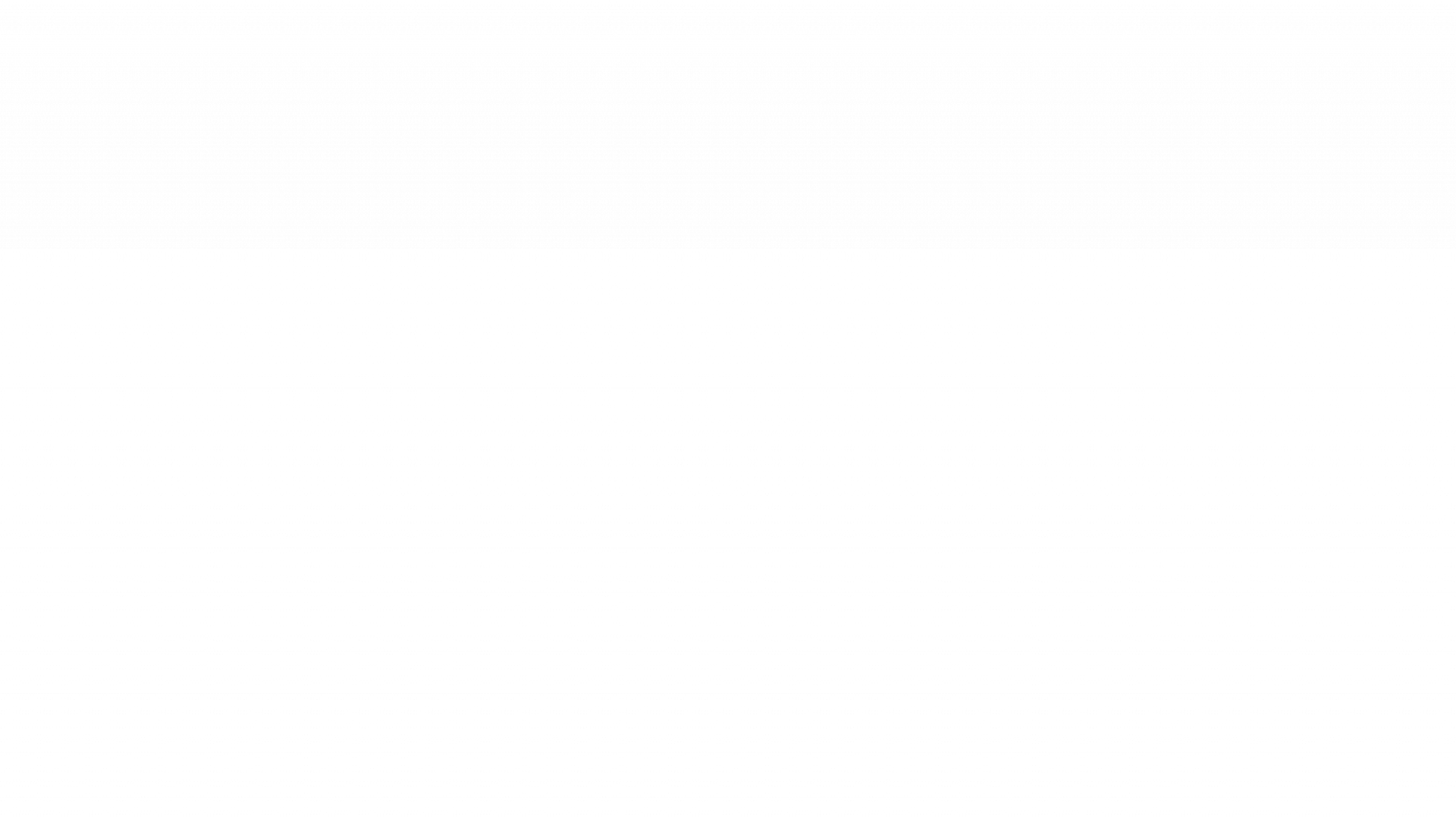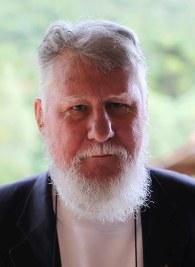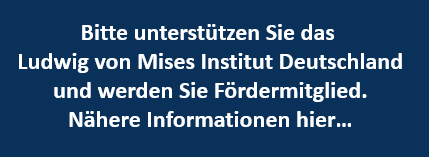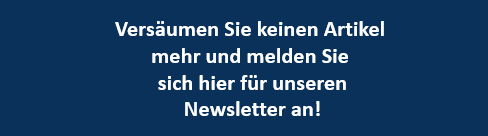Weltreise eines Kapitalisten
Rezension
24. Mai 2024 – von Antony P. Mueller
Rainer Zitelmanns neues Buch „Weltreise eines Kapitalisten. Auf der Suche nach den Ursachen von Armut und Reichtum“ (*) ist sensationell. Der self-made Millionär hat einen Reisebericht eigener Art geschrieben. Wie der Titel besagt, begibt sich hier ein Kapitalist auf die Weltreise, um den Ursachen von Armut und Reichtum auf die Spur zu kommen. Zitelmann hat zwischen April 2022 und Dezember 2023 dreißig Staaten auf vier Kontinenten besucht. Neben den USA standen Länder in Asien und in Lateinamerika sowie 18 europäische Länder auf seinem Reiseplan. Einige davon hat er mehrmals besucht. Insgesamt hat Zitelmann 260tausend Flugkilometer zurückgelegt – für einen guten Zweck, wie er feststellt.
Zitelmann ist nicht nur herumgereist, sondern er hat in den besuchten Ländern auch Umfragen durchführen lassen und persönlich gezielt mit Unternehmern, Ökonomen, Politikern und den einfachen Menschen gesprochen. Dem Stand der libertären Bewegung in den jeweiligen Ländern galt dabei sein besonderes Interesse, schließlich hat während des Zeitraums seines Reiseprojekts in Argentinien am 19. November 2023 Javier Milei die Wahl zum Präsidenten gewonnen, der erste seiner Art, der sich als Libertärer und Anarchokapitalist bezeichnet. Als promovierter Historiker fließt bei Zitelmann auch die Geschichte des jeweiligen Landes in seine Beobachtungen ein. Deshalb liegt nicht nur ein politisches Reisebuch vor, sondern ebenso ein Geschichtsbuch.
[(*) Mit * gekennzeichnete Links sind Partner-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, unterstützen Sie das Ludwig von Mises Institut Deutschland, das mit einer Provision beteiligt wird. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten.]
Der Bericht seines „Liberty Road Trips“ beginnt im April 2022 in Zürich und Tiflis, Georgien, und endet im Dezember 2023 in Kathmandu, Nepal und Monaco. Über jedes der besuchten Länder hat Zitelmann Wichtiges zu berichten, und er bringt tiefgehende, teilweise auch sehr überraschende Einsichten ans Licht. In dieser Besprechung kann nicht auf jedes Land eingegangen werden, das der Autor besucht hat, sondern nur auf einige der Länderportraits, die vielleicht besonders erhellend sind, weil sie manchen gängigen Vorurteilen entgegenstehen. Das beginnt schon mit der Schweiz.
*****
Jetzt anmelden zur
Ludwig von Mises Institut Deutschland Konferenz 2024
*****
Über die Schweiz erfahren wir, dass dieses Land, das überall im Hinblick auf „Kapitalismus“ in einer Spitzenposition und beim Pro-Kopf-Einkommen zu den reichsten Ländern der Welt zählt, keineswegs mehr so kapitalistisch ist wie einst, sondern in den letzten Jahren zunehmend dem Zeitgeist folgt und auch dort die Marktwirtschaft eher beargwöhnt wird. Selbst die vielgerühmte direkte Demokratie mit ihren Volksabstimmungen ist kein Bollwerk mehr gegen den öko-sozialistischen Interventionismus. Die Schweiz kann sich dem allgemeinen Trend in Europa nicht entziehen. Es melden sich Zweifel an, ob die Schweiz dauerhaft ihren Spitzenplatz im Ranking der wirtschaftlichen Freiheit behalten kann. (S. 20)
Über die Schweiz erfahren wir, dass dieses Land … keineswegs mehr so kapitalistisch ist wie einst …
Ähnliches ist auch von Chile zu sagen, das nach dem Sturz des Sozialisten Salvador Allende im September 1973 mit Hilfe durchgreifender marktwirtschaftlicher Reformen einen eindrucksvollen Wohlstandszuwachs erlebt hat. Aber 2004 übernahm wieder die Linke das Ruder, und nach einer kurzen liberalen Zwischenphase wurde im Dezember 2022 erneut ein erklärter Sozialist zum Präsidenten gewählt. Die von Zitelmann in Auftrag gegebene Umfrage ergibt, dass die Chilenen heute mehrheitlich antikapitalistisch denken. (S. 47)
Was ist in Chile passiert, fragt man sich. Seit dem Sturz von Allende galt Chile doch als kapitalistisches Musterland für Südamerika. In Rankings, wie dem zur Humanentwicklung und im Index der Wirtschaftsfreiheit, nimmt Chile sehr gute Plätze ein. Im Human Development Index 2022 hat Chile den Spitzenplatz aller lateinamerikanischer Staaten. Der Anteil der Menschen in extremer Armut beträgt 1,7 Prozent, während dies im sozialistischen Venezuela auf 59,6 Prozent der Haushalte zutrifft. Wieso also dieses Unbehagen am Kapitalismus? Weshalb diese Diskrepanz zwischen der wirtschaftlichen Realität und der Mehrheitsmeinung? Zur Zeit des Aufenthalts von Zitelmann in Chile wird ihm vom Entwurf einer neuen Verfassung berichtet, die von einem tiefen Misstrauen gegen den Markt und einem fast grenzenlosen Staatsvertrauen geprägt ist. Die neue Verfassung würde schwere Eingriffe in das Eigentumsrecht erlauben und die „sozialen Rechte“ ausbauen. Es stellt sich die bange Frage, ob aus Chile nun ein zweites Venezuela wird. (S. 49)
Die Entwicklung in Chile lässt nichts Gutes für Argentinien ahnen. Es könnte bedeuten, dass selbst wenn es dem neugewählten argentinischen Präsidenten Javier Milei gelingt, „den Karren aus dem Dreck zu ziehen“, die Feinde der Marktwirtschaft später dann doch wieder an die Macht kommen würden, um den erreichten Reichtum erneut umzuverteilen, und zwar so, dass sich diese linkslastigen Politiker damit erneut für eine längere Zeit ihre Wiederwahl sichern, bis der Wohlstand erneut verpulvert ist.
Noch überwiegt aber die Hoffnung in Argentinien. Das Land ist so heruntergekommen, dass die Argentinier im Anarchokapitalismus den letzten Ausweg sehen, denn alle vorherigen politischen Ideen sind an der argentinischen Wirklichkeit zerschellt. Argentinien hält den Rekord im wirtschaftlichen Niedergang. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts war das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen der Bevölkerung eines der höchsten der Welt. In Paris war zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Ausdruck »riche comme un argentin« – reich wie ein Argentinier – noch ein geflügeltes Wort. Aber als Zitelmann im Mai 2022 in Buenos Aires eintrifft, weisen seine ersten Eindrücke darauf hin, wie heruntergekommen das Land inzwischen ist und in welcher Notlage sich große Teile der Bevölkerung befinden.
Die Entwicklung in Chile lässt nichts Gutes für Argentinien ahnen. …
Noch überwiegt aber die Hoffnung in Argentinien.
Der Niedergang Argentiniens begann schon in den Jahrzehnten bevor Juan Perón im Februar 1946 zum Präsidenten gewählt wurde und den nach ihm benannten Peronismus einführte, der hauptsächlich darin bestand, das Land mit „sozialen Wohltaten“ zu überfluten. „Mehr Staat“ war sein Programm. Schließlich war das Land reich und es gab viel zu verteilen. Die Regierung vervielfachte die Staatsausgaben und verstaatlichte Unternehmen. Damit wurden tausende von neuen Jobs beim Staat geschaffen, die hauptsächlich dazu dienten, die Mitglieder der Regierungspartei zu versorgen. Während Peróns erster Präsidentschaft von 1946 bis 1952 wurde seine Frau Eva Duarte, genannt „Evita“, zur Volksheldin, indem sie staatliche Gelder mit vollen Händen „für die Armen“ ausgab. Mit nur 33 Jahren 1952 gestorben wird sie heute noch verehrt und diente Hollywood als Hauptfigur für die Verfilmung des Musicals „Don’t cry for me, Argentina“.
Militärdiktaturen und peronistische Regierungen lösten sich ab und Argentinien versank immer mehr in Schulden. Inflation, Hyperinflation, Staatspleiten und Verarmung sind bis heute die Folgen. Der Grundstein für den Niedergang wurde schon in den 1930er Jahren gelegt, als die argentinische Regierung während der Großen Depression eine Wirtschaftspolitik der Importsubstitution verfolgte und zum Protektionismus überging. Diese Politik der wirtschaftlichen Abschottung wurde auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges weiterverfolgt. Wenn sich die Wähler nun libertären Ideen zuwenden, so geschieht das aus tiefer Verzweiflung, denn alle vorherigen Versuche, mit mehr Staat die Probleme zu lösen, haben nur zu mehr Elend geführt.
Ein Kontrastprogramm zu Argentinien findet Zitelmann in Polen. Vom europäischen Armenhaus während seiner Zeit im Ostblock ist Polen heute ein Wachstumschampion. Die Grundlage dafür ist das radikale marktwirtschaftliche Reformprogramm, das von der nicht-kommunistischen Regierung schon 1989 in die Wege geleitet wurde. Zuerst wurde es zwar wie erwartet schlimmer, aber schon 1992 trug diese Politik Früchte und die polnische Wirtschaft setzt bis heute ihren Erfolgskurs fort.
… Polen [ist] heute ein Wachstumschampion.
Wieder eine andere Welt zeigt sich in Asien. Im Unterschied zu vielen anderen Teilen der Welt dominiert bei vielen Asiaten der persönliche Wille, reich zu werden. Das von Zitelmann beauftragte Meinungsforschungsinstitut untersuchte die Einstellung zu Reichtum und reichen Menschen in 13 Ländern. Bei der Frage, wie wichtig es einem wäre, selbst reich zu sein, sagten im Durchschnitt in Europa und den USA nur 28 Prozent der Befragten, dass ihnen dies wichtig sei. In den vier asiatischen Ländern waren es dagegen im Durchschnitt 58 Prozent. Besonders ausgeprägt war der Wille zum Reichtum in Vietnam, wo 76 Prozent der Befragten angaben, dass es ihnen wichtig sei, reich zu werden (S. 115). Der immense wirtschaftliche Aufstieg dieses Landes seit dem Ende der Kriegswirren, die von 1946 bis 1975 dauerten, zeigt, dass dieser Wunsch für viele Vietnamesen heute keine Illusion mehr ist.
Die erste Zeit nach dem Abzug der Amerikaner 1975 versuchte Hanoi in ganz Vietnam die kommunistische Planwirtschaft einzuführen. In der Folge sank der Lebensstandard drastisch. 1986 kam es zur Wende. Waren bis dahin nur kleine Familienbetriebe in privater Hand gestattet, wurde nun das Privateigentum umfassend erlaubt und eine Wende zur Marktwirtschaft eingeleitet. Es wurde sogar ein Artikel in die neue Verfassung eingefügt, wonach das Privateigentum an Produktionsmitteln ausdrücklich vor Enteignung geschützt ist. (S. 120)
Die mit dem exorbitanten wirtschaftlichen Aufstieg verbundene Ungleichheit scheint den Vietnamesen kein Dorn im Auge zu sein, sondern wird, wie die Umfrage zeigt, wohl eher als Ansporn gesehen, selbst wohlhabend zu werden. Im Unterschied zu China setzt Vietnam bislang unbeirrt seinem kapitalistischen Weg fort und wird im gesamten asiatischen Raum zu einem immer attraktiveren Wirtschaftsstandort. Inzwischen gibt es in Vietnam schon sieben Milliardäre. (S. 125)
Auch in Süd-Korea ist das Image des Kapitalismus positiv. Nur in Polen und den USA war das Image des Kapitalismus noch besser als in Süd-Korea. (S. 247)
… in Süd-Korea ist das Image des Kapitalismus positiv.
Wieder zurück in Europa besuchte Zitelmann im Dezember 2022 Sarajevo, die Hauptstadt Bosnien-Herzegowinas, einem Land, wo von den 35 Ländern der Befragung nur die Türkei noch ablehnender gegenüber dem Kapitalismus ist. Die Befragung zeigt, dass nicht nur das Wort „Kapitalismus“ die Mehrheit der Menschen in diesem Land abstößt, sondern dass die Bevölkerung auch massive Staatsinterventionen befürwortet und viele Leistungen vom Staat erwartet (S. 160). Es ist erstaunlich, dass ein ähnliches Meinungsbild auch in Großbritannien, dem Mutterland des modernen Kapitalismus, vorherrscht. Auch dort, so Zitelmann (S. 182) sind eher die Antikapitalisten dominant.
Auch in Frankreich wird der Kapitalismus mehrheitlich abgelehnt. Dort ist der berechnete Sozialneidkoeffizient sogar noch höher als in Deutschland. Wie die Umfrage zeigt, ist Frankreich „eines der antikapitalistischsten Länder der Welt.“ (S. 284)
… in Frankreich wird der Kapitalismus mehrheitlich abgelehnt.
Die Umfragen, die Zitelmann in Auftrag gegeben hat, eine zum Image der Reichen (in 13 Ländern) und eine zum Image des Kapitalismus (in 35 Ländern), zeigen, dass in den meisten Ländern ein positives Image der Reichen mit einem positiven Image des Kapitalismus einhergeht. Dies war beispielsweise in den USA, Polen, Korea oder Japan der Fall. Umgekehrt haben zum Beispiel in Deutschland und Frankreich die Reichen ein ebenso schlechtes Image wie der Kapitalismus.
Die Umfragen zeigen, dass antikapitalistisches Denken vor allem in Russland verbreitet ist. Während in Polen die Menschen für wirtschaftliche Freiheit sind, sind sie in Russland für staatliche Regulierung (S. 231). Die Umfragen bringen aber auch Merkwürdiges zutage, so zeigt sich, dass in den USA die jungen Amerikaner kritischer als die Älteren gegenüber den Reichen sind und es in Italien genau umgekehrt ist. Die jungen Italiener stehen den Reichen sehr viel positiver gegenüber als die Älteren (S. 237), wobei allerdings in Italien beide Altersgruppen ihre skeptische Einstellung zum Kapitalismus teilen. Genereller Antikapitalismus dominiert auch in Italien (S. 239). Selbst in den Niederlanden, das insgesamt zu einem der wirtschaftlich freiesten Länder der Welt gehört, haben der Kapitalismus und die Marktwirtschaft ein schlechtes Image. Die Ablehnung des Kapitalismus ist nur in sieben anderen Ländern noch stärker als in den Niederlanden. „Alle Daten weisen in eine Richtung: Die Niederländer lehnen die Marktwirtschaft und den Kapitalismus ab. (S. 300)
Nicht viel anders sieht es in Bulgarien aus. Während die älteren Intellektuellen, soweit sie über die einstigen Zustände unter der Oberherrschaft der Sowjetunion Bescheid wissen, durchwegs antisozialistisch und prokapitalistisch eingestellt sind, lernen die Jüngeren wenig über die Geschichte des Sozialismus. Zitelmann wird darüber unterrichtet, dass junge Bulgaren, die in Europa oder den USA studiert haben, oft als Marxisten in ihre Heimat zurückkommen. (S. 303)
Auch in Albanien wird der Begriff „Kapitalismus“ mit Ungleichheit, Gier, Hunger und Armut verbunden. Nicht einmal jeder zehnte Albaner (neun Prozent) stimmt der Aussage zu: „Kapitalismus ist nicht zu ersetzen, wenn das in der Vergangenheit versucht wurde, hat das zu Diktatur und Elend geführt.“ (S. 314). Dabei war Albanien unter der stalinistischen Diktatur von Enver Hoxhas (von 1944 bis 1985) das ärmste Land Europas und hat seit dem Ende des sozialistischen Regimes enorm an Wohlstand gewonnen.
… in Albanien wird der Begriff „Kapitalismus“ mit Ungleichheit, Gier, Hunger und Armut verbunden.
Zum Abschluss seiner Weltreise besucht Zitelmann im Dezember 2023 Monaco, mit nicht ganz vierzigtausend Einwohner und zwei Quadratkilometern Fläche das kleinste seiner besuchten Länder und wohl das „kapitalistischste“ überhaupt. Zitelmann ist nach Monaco gekommen, um sich mit dem dort wohnenden Titus Gebel zu treffen und mehr über dessen Projekt „freie Privatstädte“ zu erfahren, wofür Monaco gewissermaßen beispielhaft ist. In Monaco gibt es weder Einkommen- noch Erbschaftsteuer. Aber nicht nur das macht das Fürstentum attraktiv. Es gibt kaum Kriminalität. Wer die Gesetze verletzt, wird auch bei kleinen Straftaten ausgewiesen, wenn er nicht Bürger von Monaco ist.
Von Gebel erfährt Zitelmann, dass das Wesentliche an freien Privatstädten ist, eine Gemeinschaft ohne Politik zu formieren. Die Grundidee besteht darin, dass die Bewohner einen Vertrag mit einem gewinnorientierten privaten Dienstleister abschließen, der die öffentlichen Leistungen erbringt. Freie Privatstädte gehen weit über das Konzept der „gated communities“ hinaus, die vor allem in den Schwellenländern immer beliebter werden. Freie Privatstädte ähneln eher Sonderwirtschaftszonen. China hat zu Beginn seiner marktwirtschaftlichen Transformation auf dieser Strategie aufgebaut. Anstatt das ganze Land auf einmal umzubauen, hat man begrenzte Territorien ausgewiesen und sie von den meisten Regelungen befreit. Der durchschlagende Erfolg der ersten dieser Wirtschaftszonen, Shenzhen, gab dem chinesischen Reformer Deng Xiaoping Recht und seitdem bilden Sonderzonen den chinesischen Weg zum wirtschaftlichen Aufstieg. Ähnlich sieht Gebel den Weg in eine libertäre Zukunft. Er geht davon aus, dass es nicht möglich ist, einen bestehenden Staat libertär umzugestalten. Die politischen Widerstände sind zu groß, aber mit der Schaffung von libertären Inseln könnten vor allem die aufstrebenden Volkswirtschaften in Asien, Lateinamerika und Afrika den Weg zu Freiheit und Wohlstand finden.
Freie Privatstädte gehen aber über das Konzept der Sonderwirtschaftszonen hinaus. Sie sind nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht weitgehend autonom. Vorformen privater Privatstädte sind neben Monaco die bekannten Stadtstaaten Hongkong, Singapur und Dubai, die allesamt Spitzenpositionen im Wirtschaftlichen Freiheitsindex der Heritage Fundation einnehmen. Auch Liechtenstein kann man in diesem Zusammenhang erwähnen. Gebel hat zur praktischen Umsetzung seines Konzepts der freien Privatstädte die Firma „Tipolis Ltd.“ als eine in Singapur ansässige Aktiengesellschaft gegründet, deren Ziel es ist, ein internationales Netzwerk von freien Privat-städten zu betreiben. (S. 370)
Freie Privatstädte gehen … über das Konzept der Sonderwirtschaftszonen hinaus.
Während seiner Weltreise musste Zitelmann immer wieder feststellen, wie schwer es ist, marktwirtschaftliche Reformen durchzusetzen, und wenn es einmal gelingen sollte und das Land zu Wohlstand kommt, eine neue Generation von Politikern aufsteigt, die vorgeblich „kostenlose“ Wohltaten versprechen und sie dann zum Stimmenfang auf Pump verteilen.
In Ländern, in denen Reichtum positiv gesehen wird – sei es Polen, Süd-Korea oder Vietnam –, wächst die Wirtschaft, und auch den Durchschnittsbürgern und den Armen geht es dadurch besser. Dort aber, wo der Staat die Wirtschaft immer stärker gängelt und sich Politiker laufend neue Gesetze ausdenken, von denen sie behaupten, sie würden die „soziale Gerechtigkeit“ verbessern, aber mit denen sie tatsächlich nur Unternehmern das Leben schwerer machen, sinkt der Wohlstand. Zitelmann stellt ernüchternd fest, dass auch Deutschland sich Stück für Stück auf diesem Weg in die Planwirtschaft befindet und die entsprechenden Konsequenzen schon in Erscheinung treten. Sieht man sich Argentinien an, lässt das nichts Gutes hoffen. Der Weg ins Elend kann über Jahrzehnte anhalten und es dauert lange, bis es zu einem marktwirtschaftlichen Wiedererwachen kommt. Aber auch dann ist der Wohlstand nicht gesichert, sondern die Feinde des Kapitalismus lauern schon in ihren Startlöchern, um den erworbenen Reichtum zu ihrem politischen Nutzen wieder umzuverteilen.
Zitelmann stellt ernüchternd fest, dass auch Deutschland sich Stück für Stück auf diesem Weg in die Planwirtschaft befindet …
Marktwirtschaftler haben die Fakten auf ihrer Seite. Kapitalismus ist unbestreitbar das beste aller Systeme. Es verbindet Freiheit mit Wohlstand. Selbst den Ärmsten geht es im Kapitalismus besser als unter dem Sozialismus. Trotzdem ist der Kapitalismus nicht populär. Zitelmanns Bericht zeigt, dass die eingebildete Wahrnehmung nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt.
Die Sozialisten wissen, dass ihr Modell in der Wirklichkeit nicht funktioniert, deshalb setzen sie von vornherein auf die Manipulation der Wahrnehmung. Sie ignorieren die Realität und manipulieren die Perzeption. Mit dieser Herangehensweise, die seit der Französischen Revolution die Linke prägt, haben sie ihren Siegeszug angetreten. Linke sind Meister der Überredung, der Verbreitung von Hirngespinsten genau deshalb, weil ihre Ideen so illusorisch sind. Ihr Erfolgsmodell ist, dass man gegen das Aufwühlen von Emotionen mit noch so vielen Fakten nicht bestehen kann. Hinzukommt, dass der Staat und damit die Politik das Schulsystem beherrschen und dort schon den Schülern die antikapitalistischen, prostaatlichen Haltungen eingepflanzt werden, die bestimmend für ihr Denken-und-Fühlen sind. Für die Universitäten ist es dann ein Leichtes, auf diesen Einstellungen aufbauend pseudowissenschaftliche Begründungen für das Denken-und-Fühlen der Studenten zu liefern. Rationalität und Faktenbezogenheit kommt gegen diese tiefsitzenden Haltungen nicht an, und zwar um so weniger, als heute auch die offizielle Medienlandschaft prosozialistisch und antikapitalistisch ausgerichtet ist.
[Das] Erfolgsmodell [der Sozialisten] ist, dass man gegen das Aufwühlen von Emotionen mit noch so vielen Fakten nicht bestehen kann.
Zitelmanns Buch regt dazu an, darüber nachzudenken, wie das geändert werden kann. Die Freunde von Freiheit und Wohlstand müssen sich fragen: Gibt es einen Ausweg aus diesem Dilemma? Wie kann der Wahrheit zum Sieg verholfen werden? Das Buch Rainer Zitelmanns leistet in jedem Falle einen wertvollen Beitrag zur Aufklärung über die wahre Natur von Kapitalismus und Sozialismus. Es ist nicht nur sehr interessant und informativ, sondern liefert den Freunden der Freiheit auch überzeugende Argumente.
*****
Antony Peter Mueller ist promovierter und habilitierter Wirtschaftswissenschaftler. Bis 2023 war Dr. Mueller Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Makroökonomie und Internationale Wirtschaftsbeziehungen, an der brasilianischen Bundesuniversität UFS. Nach seiner Pensionierung ist Dr. Mueller weiterhin als Dozent an der Mises Academy in São Paulo tätig.
In deutscher Sprache erschien 2023 sein Buch „Technokratischer Totalitarismus. Anmerkungen zur Herrschaft der Feinde von Freiheit und Wohlstand“(*). 2021 veröffentlichte Antony P. Mueller das Buch „Kapitalismus, Sozialismus und Anarchie. Chancen einer Gesellschaftsordnung jenseits von Staat und Politik“(*). 2018 erschien sein Buch „Kapitalismus ohne Wenn und Aber. Wohlstand für alle durch radikale Marktwirtschaft“(*).
[(*) Mit * gekennzeichnete Links sind Partner-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, unterstützen Sie das Ludwig von Mises Institut Deutschland, das mit einer Provision beteiligt wird. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten.]
*****
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Instituts Deutschland wieder.
*****
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Das Ludwig von Mises Institut Deutschland e.V. setzt sich seit Jahren für die Verbreitung der Lehre der Österreichischen Schule der Nationalökonomie ein. Freiheit gibt es nicht geschenkt, sie muss stets neu errungen und erhalten werden. Bitte unterstützen Sie daher das Ludwig von Mises Institut Deutschland mit einer Spende, damit wir uns weiterhin für unser aller Freiheit einsetzen können!
Spendenkonto:
Ludwig von Mises Institut Deutschland e. V.
IBAN: DE68 7003 0400 0000 1061 78
BIC: MEFIDEMM
Merck Finck A Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch
Verwendungszweck: Spende
Titel-Foto: Adobe Stock – bearbeitet