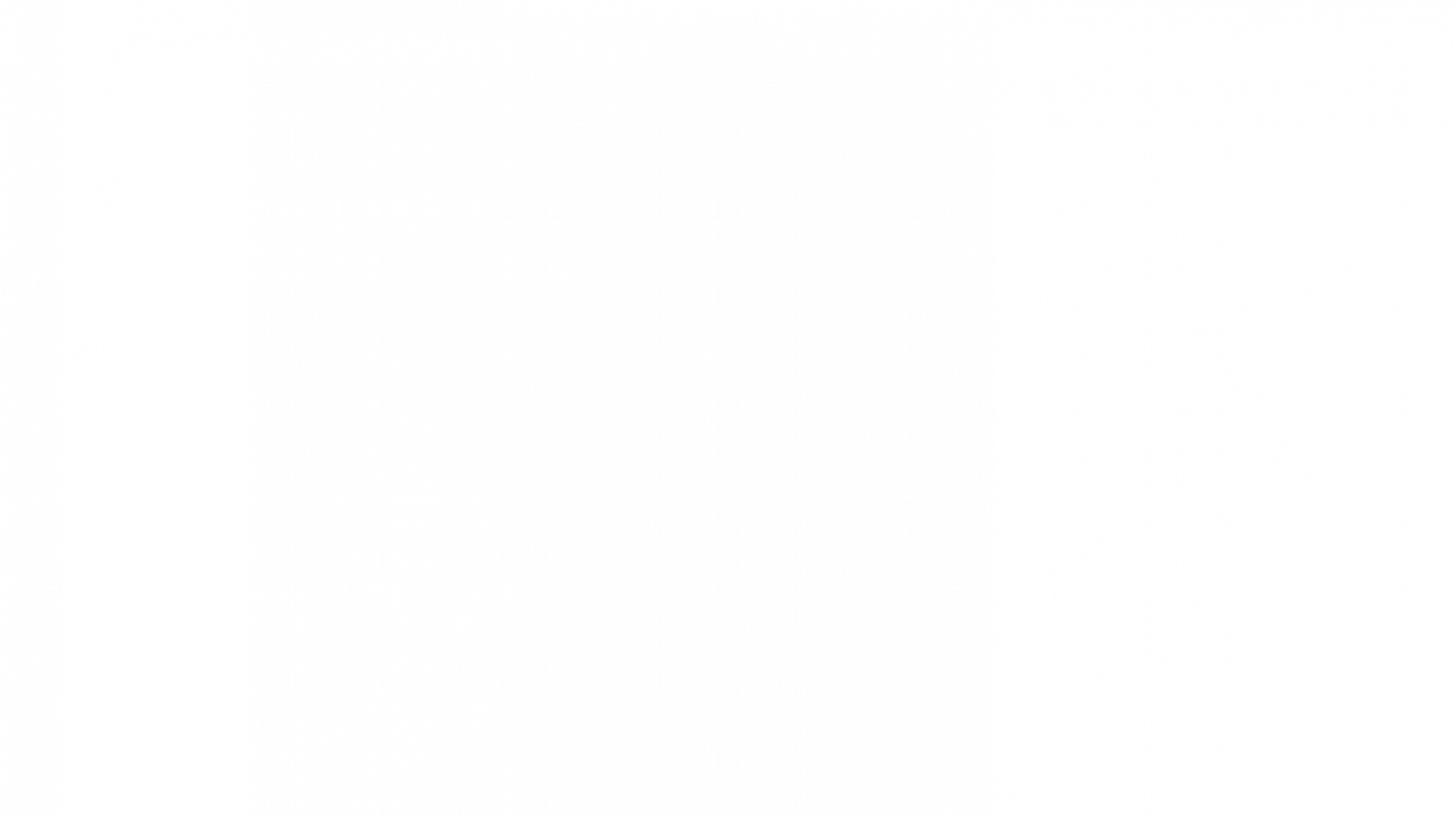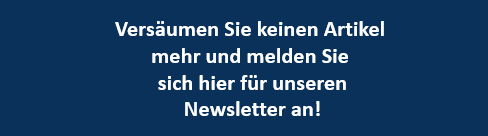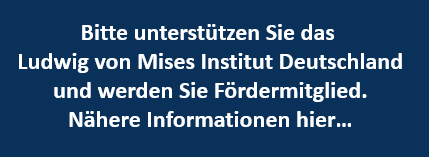175 Jahre Schweizerische Eidgenossenschaft. Warum Ludwig von Mises keine Freude hätte
Zuruf aus der Schweiz
11. September 2023 – von David Dürr
Am 12. September 2023 jährt sich zum 175. Mal die Geburtsstunde der Schweizerischen Eidgenossenschaft. „Am 12. Herbstmonat 1848“ wurde in Bern eine völlig neue Bundesverfassung angenommen, mit welcher der bis dahin bestehende Staatenbund aus 22 selbständigen Kantonen zu einem Bundesstaat namens „Schweizerische Eidgenossenschaft“ mit Bundesregierung, Bundesparlament und schon bald auch einem ständigen Bundesgericht geformt wurde. Dieses Ereignis wird im Moment bei uns in der Schweiz derart inbrünstig und überschwänglich begangen, dass man im Bundesparlament schon darüber diskutierte, nebst dem bisherigen 1. August noch einen zusätzlichen Nationalfeiertag einzuführen, den 12. September eben.
Doch zu feiern, gibt es eigentlich nichts, im Gegenteil. Was am 12. September 1848 in Bern stattfand, war ein völkerrechtswidriger Missbrauch militärischer Macht. Ludwig von Mises, der dem Selbstbestimmungsrecht völkerrechtlicher Körperschaften ein entscheidendes Gewicht beimaß, hätte jedenfalls keine Freude daran gehabt. – Doch schön der Reihe nach.
Ein Hoch auf den Sonderbund
Der erwähnte vor 1848 bestehende Staatenbund der Kantone war eine lose Verbindung, die es den einzelnen Mitgliedern überließ, wie sie sich intern organisieren wollten. So gab es eine – im 19. Jahrhundert nicht unübliche – breite Vielfalt verschiedener Regimes: kirchlich-konservative, ständisch-zünftische oder die damals neu aufkommenden liberal-republikanischen. Nun tendierten letztere zur Ansicht, die Wahrheit gepachtet zu haben, sie anderen deshalb aufdrängen zu sollen bis hin zu bewaffneten Überfällen auf konservative Kantone zwecks gewaltsamer Entfernung von deren Regierungen. Dies wiederum führte dazu, dass sich die angegriffenen konservativen, katholisch ausgerichteten Kantone im Jahr 1844 zu einem Verteidigungsbündnis zusammenschlossen, dem sogenannten „Sonderbund“.
*****
Jetzt anmelden zur
Ludwig von Mises Institut Deutschland Konferenz 2023
*****
Was sogleich einen heuchlerischen Aufschrei der „liberalen“ Kantone auslöste, die in diesem Sonderbund eine Verletzung von § 6 des damaligen Bundesvertrags behaupteten. Dort stand nämlich, dass „unter den einzelnen Kantonen keine, dem allgemeinen Bund oder den Rechten anderer Kantone nachtheilige Verbindungen geschlossen werden“ dürfen. Mit anderen Worten, die liberalen Aggressoren machten ihren Opfern zum Vorwurf, sich organisiert zu verteidigen. Und als diese sich weigerten, ihre Verteidigung aufzugeben, war dies für die Aggressoren Anlass zu einer noch massiveren, nun offiziell militärischen Attacke. Dies führte dann zum Sonderbundskrieg des Jahres 1847.
Die zahlenmäßig und militärisch überlegenen Liberalen siegten und begnügten sich nicht etwa damit, die Auflösung des angeblich unzulässigen Sonderbundes durchzusetzen, sondern benützten die Gelegenheit ihres Sieges, die unterlegenen Katholiken in einen neu geschaffenen Staat zu zwingen. Und sie sorgten dafür, dass sie, die Liberalen, in diesem neuen Staat auf Jahrzehnte hinaus in Gesetzgebung und Regierung das unangefochtene Sagen hatten.
Gegen das Selbstbestimmungsrecht der Völker
Völkerrechtlich war und ist völlig unbestritten, dass es für den Zusammenschluss dieser 22 Kantone zu einem umfassenden Bundesstaat die Zustimmung jedes einzelnen dieser Kleinstaaten gebraucht hätte. Oder anders gewendet: Mitglieder des neuen Bundesstaates hätten nur jene Kantone werden können, die das von sich aus wollten, nicht aber jene, die es ablehnten.
Angenommen hatten die neue Verfassung natürlich die Siegerkantone des Sonderbundskriegs (mit Ausnahme des Tessins), ferner zwei ehemalige Sonderbundskantone (Luzern und Freiburg, bei denen Liberale das Szepter übernommen hatten) sowie der im Sonderbundskrieg neutrale Kanton Neuenburg; insgesamt waren das 15,5 Kantone (Appenzell Ausserrhoden zählte als halber Kanton). Abgelehnt wurde die neue Verfassung von den restlichen Sonderbundskantonen, dem Kanton Tessin sowie dem neutralen Halbkanton Appenzell Innerrhoden; insgesamt waren das 6,5 Kantone. Völkerrechtlich verbindlich war die neue Verfassung also nur für die 15,5 zustimmenden Kantone. Für die 6,5 anderen Kantone ergab sich die „Verbindlichkeit“ nicht aus Recht, sondern aus schierer Unterwerfung durch die anderen, militärisch überlegenen Kantone.
Das war eine klare Verletzung des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Nicht nur ganze Nationen, sondern auch viel kleinere Einheiten wie etwa schweizerische Kantone haben das Recht, selbst zu bestimmen, mit welchen Partnern sie sich verbünden wollen. Das erinnert an die bekannte Stelle aus Ludwig von Mises‘ „Liberalismus“ von 1927 (S. 97), wonach das so oft beschworene Selbstbestimmungsrecht der Nationen, letztendlich gründet in einem natürlichen
Selbstbestimmungsrecht der Bewohner eines jeden Gebietes, das groß genug ist, einen selbständigen Verwaltungsbezirk zu bilden. …
Dass es im Sinn des Wortes nicht mit rechten Dingen zuging bei dieser Staatsgründung, wird heute nicht einmal bestritten. Doch nennt man den Vorgang nicht „rechtswidrig“, sondern beschönigend „revolutionär“. Das soll ihm einen legitimen Anstrich geben, weshalb es oft mit den revolutionären Bewegungen verglichen wird, die damals in ganz Europa für Unruhe sorgten, prominent in Deutschland mit der „Märzrevolution“ 1848/1849. Auch dort, so heisst es, ging es doch um den Aufstand liberaler Bewegungen gegen verkrustete Machtstrukturen des „Ancien Regime“. Allein, in der Schweiz war gerade das Gegenteil der Fall: Was hier die Liberalen taten, war nicht Aufstand, sondern Unterdrückung; was hier den Konservativen passierte, war nicht Enthebung von alter Macht, sondern Unterwerfung unter neue Macht.
*****
Was Sie für unser aller Freiheit tun können
HIER KLICKEN, um Thorsten Polleits Beitrag zu dieser Frage zu lesen.
*****
Gegen das Selbstbestimmungsrecht der Individuen
Wir wissen, dass von Mises das Selbstbestimmungsrechts nicht nur noch so kleinen Verwaltungseinheiten, sondern in letzter Konsequenz auch jedem Individuum attestieren wollte:
… Wenn es irgend möglich wäre, jedem einzelnen Menschen dieses Selbstbestimmungsrecht einzuräumen, so müsste es geschehen.
Auch hiergegen verstieß die erzwungene Staatsgründung 1848. Das zeigt sich, wenn man nachzählt, wie hoch die Zustimmung bei der damaligen Landesbevölkerung lag: Im Protokoll der Abstimmung vom 12. September 1848 heisst es zwar vollmundig, dass die 15,5 zustimmenden Kantone „zusammen eine Bevölkerung von 1‘897‘887 Seelen, also die überwiegende Mehrheit der schweizerischen Bevölkerung und der Kantone repräsentiren“; und in der Tat wäre das ein grosser Teil der damaligen Landesbevölkerung von rund 2,4 Millionen Menschen. – Indes, was damit suggeriert wurde, nämlich dass fast alle Landesbewohner der Verfassung zugestimmt hätten, stimmte nicht: In den landesweit durchgeführten Abstimmungen haben der neuen Verfassung nicht mehr als 145’584 zugestimmt; das sind magere 6% der damaligen Landesbevölkerung. Zwar waren die Neinstimmen mit 54’320 noch weniger zahlreich, doch wer will behaupten, dass 199’904 Stimmen für eine Landesbevölkerung von 2,4 Millionen repräsentativ seien. Das sind nicht mehr als 8%, was bestenfalls einen interessanten Stimmungsbarometer hergeben mag, aber keine legitime Basis, um einem ganzen Land eine neue Staatsstruktur aufzunötigen.
Verhängnisvolle Konsequenzen
Nach jenem völkerrechtswidrigen Staatsstreich 1848 hatte die Schweiz noch zweimal Gelegenheit, über eine sogenannte Totalrevision der Bundesverfassung abzustimmen und damit doch noch so etwas wie eine demokratische Basislegitimation herzustellen. Wirklich neu waren diese Verfassungsvorlagen zwar nicht; die Grundstruktur des Bundesstaates blieb unangetastet. Bei der Totalrevision 1874 wurde immerhin das Gesetzesreferendum eingeführt, während die Totalrevision 1999 erklärtermaßen bloß ein zeitgemäßes neues Kleid bei unverändertem Inhalt sein sollte.
Diese beiden Totalrevisionen wurden zwar angenommen, an der dünnen demokratischen Basis der Organisation „Schweizerische Eidgenossenschaft“ änderte sich aber nichts: Die Mehrheit der jeweils zustimmenden Kantone war gar noch geringer als 1848, nämlich 13,5 gegen 8,5 Kantone im Jahr 1874 beziehungsweise 13 gegen 10 Kantone im Jahr 1999 (neu gebildet hatte sich inzwischen der Kanton Jura). Und gemessen an der jeweiligen Landesbevölkerung machten die Zustimmenden nicht mehr aus als 12% beziehungsweise 13%. Da soll uns doch jemand erklären, woher diese das Recht nehmen, den jeweils anderen 88% beziehungsweise 87% diese Staatsordnung als verbindlich aufzuzwingen!
Nun werden Sie, liebe Leserin und Leser, vielleicht einwenden, dass sei bei Demokratien doch immer so, bei vielen sogar noch ausgeprägter als in der Schweiz; in Deutschland etwa hat das Volk überhaupt noch nie über das Grundgesetz abgestimmt, obwohl bekanntlich dessen Artikel 146 eine solche Abstimmung schon seit 1949 in Aussicht stellt. Mit diesem Einwand haben Sie natürlich recht. – Allein, mit „Demokratie“ im Sinn des Wortes Volks-Herrschaft hat dies nichts zu tun; das ist dann halt nicht Volks-Herrschaft, sondern Volks-Beherrschung. Da bestimmt eine kleine Machtelite mit einem stattlichen Mitarbeiterstab in Bern, wo es lang geht in diesem Land. Dass es hin und wieder Wahlen und in der Schweiz sogar Sachabstimmungen gibt, ist nie mehr als das erwähnte wenig repräsentative Stimmungsbarometer. Stellten sich Volksabstimmungen – selten genug – für einmal quer zur Machtzentrale, so hat diese noch immer Wege gefunden, sich über das lästige Stimmungsbarometer hinwegzusetzen.
Kein Wunder, wurde diese Volksbeherrschung in den letzten 175 Jahren kräftig ausgebaut. Hatte der Bund 1848 noch ganz wenige, vor allem militärische und außenpolitische Aufgaben, so dominiert er heute sämtliche Bereiche bis in die innersten Belange der Kantone, der Gemeinden und vor allem der einzelnen Bürger. Die Bundesgesetzgebung umfasst heute mehr als 5‘000 Erlasse, die Kantone haben immer mehr bloss reine Vollzugsfunktionen für den Bund. Wo es noch Reste von Wettbewerb zwischen Kantonen gibt, etwa im Steuer- und Finanzbereich, wird er durch „Steuerharmonisierungen“ und nationalen Finanzausgleich ruiniert. Opfer dieser zunehmend zentralisierten Staatsmacht sind nicht nur die Kantone und Gemeinden, sondern auch und vor allem die einzelnen Bürger.
Zurück zum Prinzip des Sonderbunds
Als Ludwig von Mises, wie eben erwähnt, das Selbstbestimmungsrecht jedem einzelnen Bürger einräumen wollte, zögerte er zwar noch aus rein praktischen, „verwaltungstechnischen Rücksichten“, die ohne einheitliche und insofern minimalstaatliche Organisation nicht einzuhalten seien.
Dem ist insofern beizupflichten, als Organisiertheit in gesellschaftlichen Belangen unerlässlich ist, doch anderseits kommt auch sie nicht darum herum, vom Selbstbestimmungsrecht getragen zu sein. Das ist nichts anderes als das Prinzip des Sonderbunds, zu dem sich jene Kleinstaaten im Jahr 1844 freiwillig zusammenschlossen, und das genau gleich für die einzelnen Bürger gilt. Auch sie sollen selbst bestimmen können, wie sie sich für ihre gesellschaftlichen Belange organisieren und welche mannigfachen Sonderbünde sie eingehen wollen. Das wird nicht ein einziger, alles umfassender Sonderbund sein, sondern eine Vielfalt funktional unterschiedlicher, örtlich überschneidender und sich gegenseitig konkurrenzierender Sonderbünde.
Warum also nicht den 175. Geburtstag der „Schweizerischen Eidgenossenschaft“ zum Anlass nehmen, einen etwas anderen Blick zurückzuwerfen, nicht den brutalen Staatsreich von 1848 und 175 Jahre Volksbeherrschung zu feiern, sondern das hervorzuholen, was er verdrängt hat, das Prinzip des Sonderbunds mit dem Selbstbestimmungsrecht der Kantone, der Gemeinden und vor allem der einzelnen Bürger, kurz Volksherrschaft.
*****
Professor Dr. iur. David Dürr, LL.M., lehrte bis 2018 an der Universität Zürich Privatrecht und Rechtstheorie. Er ist nach wie vor publizistisch und mit Vorträgen tätig, wie auch als Wirtschaftsanwalt und Notar bei der von ihm mitgegründeten SwissLegal-Gruppe. Er ist Beirat des Ludwig von Mises-Instituts Deutschland sowie des Liberalen Instituts Zürich. Nebst zahlreichen Sachbüchern und Artikeln veröffentlichte er unter anderem die Politsatire „Staats-Oper Schweiz – wenige Stars, viele Staatisten” (2. Auflage 2022) sowie eine Auswahl seiner Kolumnen bei der Basler Zeitung unter dem Titel „Das Wort zum Freitag” (2014). Zudem schrieb er Beiträge zu dem 2021 erschienenen Buch „Geht mir aus der Sonne! Wege aus der Bevormundung“.
*****
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Das Ludwig von Mises Institut Deutschland e.V. setzt sich seit Jahren für die Verbreitung der Lehre der Österreichischen Schule der Nationalökonomie ein. Freiheit gibt es nicht geschenkt, sie muss stets neu errungen und erhalten werden. Bitte unterstützen Sie daher das Ludwig von Mises Institut Deutschland mit einer Spende, damit wir uns weiterhin für unser aller Freiheit einsetzen können!
Spendenkonto:
Ludwig von Mises Institut Deutschland e. V.
IBAN: DE68 7003 0400 0000 1061 78
BIC: MEFIDEMM
Merck Finck A Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch
Verwendungszweck: Spende
*****
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Instituts Deutschland wieder.
Titel-Foto: Adobe Stock Fotos