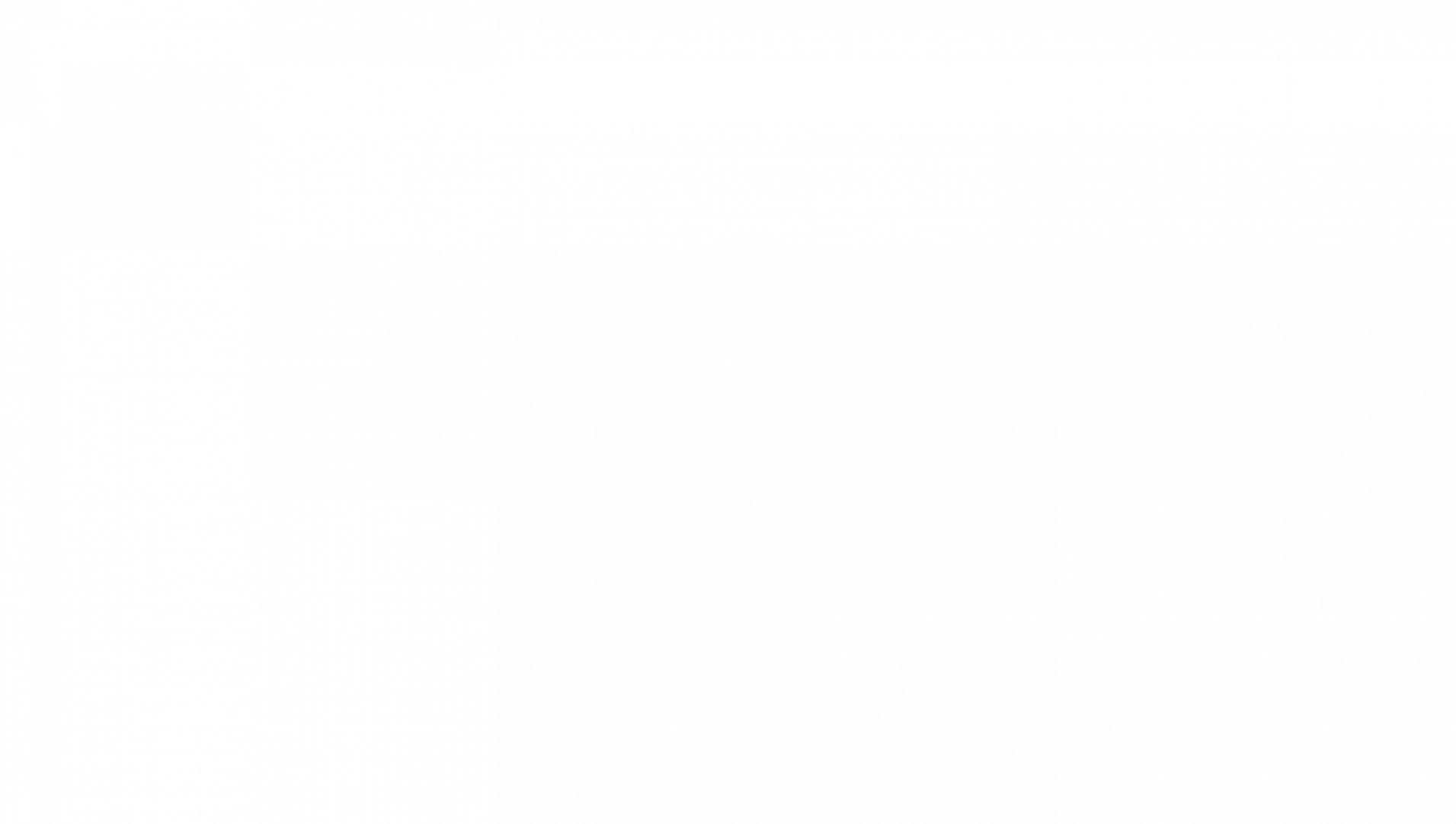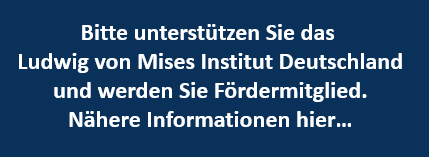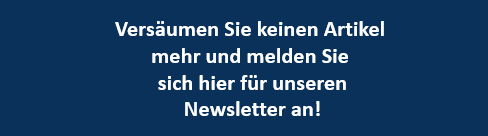Die große Verwirrung: Kapitalismus-Kritik, die Sozialismus-Kritik ist
11. November 2020 – Der nachfolgende Beitrag ist entnommen aus dem Buch „Der Antikapitalist. Ein Weltverbesserer, der keiner ist“ von Thorsten Polleit (FinanzBuch Verlag, Oktober2020).
Ein Interview mit Thorsten Polleit zum Buch finden Sie bei Mises Karma – der freiheitliche Podcast.
*****
»Auch das lauteste Getöse großer Ideale darf uns nicht verwirren und nicht hindern, den einen leisen Ton zu hören, auf den alles ankommt.«
Werner Heisenberg
Ein antikapitalistisches Trojanisches Pferd

Thorsten Polleit
Die Verwendung von Geld ist heutzutage für die meisten Menschen zur Selbstverständlichkeit geworden. So natürlich und problemlos wird Geld im täglichen Geschäftsverkehr eingesetzt, dass sich kaum noch jemand Gedanken darüber macht, was Geld eigentlich ist, wie es entstanden ist, und vor allem welche Auswirkungen das Geld beziehungsweise unterschiedliche Geldarten auf die wirtschaftlichen und politischen Geschicke einer modernen Gesellschaft und Volkswirtschaft haben. Doch es ist sicherlich nicht übertrieben zu sagen: Ohne das heute weltweit vorherrschende Fiat-Geldsystem, seine Entstehung sowie seine Funktions- und Wirkungsweise zu verstehen, lassen sich viele der wirtschaftlichen und politisch-sozialen Missstände der Zeit nicht verstehen und daher auch nicht lösen.
Dieses Buch ist ein Versuch der Aufklärung und soll verdeutlichen, dass das heutige Geld – ein staatlich monopolisiertes Fiat-Geld – im wahrsten Sinne des Wortes unnatürlich ist, dass es schwere ökonomische und ethische Defekte aufweist. Ferner soll es helfen zu erklären, dass viele der Probleme, die heutzutage zu Recht angeprangert werden – wie Finanz- und Wirtschaftskrisen, Geldwertschwund, wachsende Einkommens- und Vermögensunterschiede, Altersarmut, Umweltschäden et cetera – im staatlichen Fiat-Geld angelegt sind. Vor allem aber soll es aufzeigen, dass die heute verbreitete Kapitalismus- und Neoliberalismuskritik fehlgeleitet ist: Die weltweit vorherrschenden Wirtschafts- und Gesellschaftsmodelle haben mit Kapitalismus herzlich wenig gemeinsam, sie sind vielmehr allesamt Spielarten des staatlichen Interventionismus, der seinem Wesen nach antikapitalistisch ist.
Gerade des staatliche Fiat-Geldsystem erweist sich als ein antikapitalistisches Trojanisches Pferd: Für viele Menschen erscheint es eine Ausgeburt des Kapitalismus zu sein. In Wahrheit ist es jedoch staatsgemacht und beschwört nicht nur schwere Krisen herauf, sondern lässt den Staat immer weiter anwachsen auf Kosten der bürgerlichen und unternehmerischen Freiheiten. Ohne das Fiat-Geld wäre die Macht der Staaten über die Geschicke seiner Bürger und Unternehmer, wie sie in den letzten Jahrzehnten immer weiter gewachsen ist (Stichwort: »Deep State«), gar nicht denkbar. Man kann sogar sagen, dass das Fiat-Geld den Weg in den totalitären Staat ebnet und dass kein Weg daran vorbeiführt, dem Staat das Geldmonopol zu entziehen, wenn die Freiheit des Individuums und die produktive und friedvolle Kooperation der Menschen national wie international bewahrt werden sollen.
Vom Warengeld zum Fiat-Geld
Geld ist das universell akzeptierte Tauschmittel. Es ist ein Gut wie jedes andere Gut auch – mit der Besonderheit, dass es das marktgängigste, das liquideste Gut von allen ist.[1] Entstanden ist das Geld im freien Markt, ohne jegliches Dazutun des Staates oder seiner Zentralbank. Das erklärt der österreichische Ökonom Carl Menger (1840–1921) bereits im Jahr 1871.[2] Die Menschen erkennen, so Menger, dass Arbeitsteilung für alle Beteiligten sinnvoll ist, denn es erhöht die Ergiebigkeit der Arbeit. Arbeitsteilung führt zur Spezialisierung: Jeder produziert das, was er am relativ besten kann; man erzeugt nicht mehr allein für den Eigenbedarf, sondern vor allem auch für den Bedarf seiner Mitmenschen. Spezialisierung macht Tauschen erforderlich. Die primitivste Stufe des Tauschens ist der Naturaltausch (Barter): Brot wird gegen Schuhe getauscht, Äpfel gegen Kleider, Feuerholz gegen Fisch.
Der Naturaltausch ist jedoch beschwerlich. Man muss jemanden finden, der genau das anbietet, was man selbst nachzufragen wünscht, und der gleichzeitig auch das nachfragt, was man selbst anzubieten hat. Das Tauschen wird vereinfacht, wenn man ein indirektes Tauschmittel einschaltet: Man tauscht zunächst das Gut, was man anzubieten hat, in das indirekte Tauschmittel, und das indirekte Tauschmittel tauscht man dann nachfolgend in das letztlich gewünschte Gut. Dasjenige indirekte Tauschmittel, das die weiteste Verbreitung findet, wird zum Geld gewählt. Geld erweitert die Tauschmöglichkeiten für die Menschen ganz ungemein, ermöglicht einen hohen Grad von Arbeitsteilung und fördert den materiellen und auch kulturellen Wohlstand.
Die Währungsgeschichte zeigt, dass die Menschen, wenn sie die Freiheit der Geldwahl hatten, Edelmetalle – vor allem Gold, Silber, zuweilen auch Kupfer – als Geld gewählt haben. Dafür gibt es gute Gründe. Denn damit »etwas« als Geld funktioniert, muss es bestimmte (physische) Eigenschaften haben. Das »etwas« muss zum Beispiel knapp sein, homogen (von gleicher Art und Güte), haltbar, transportabel, teilbar, prägbar, es muss einen hohen Tauschwert pro (Gewichts-)Einheit aufweisen, und es muss allgemein wertgeschätzt sein. Währungshistorisch gesehen haben schon viele Güter um die Geldfunktion konkurriert: Vieh, Gewürze, Muscheln, Steine, Zigaretten und anderes mehr. Die Edelmetalle haben sich jedoch immer wieder durchgesetzt – weil sie aus Sicht der Geldverwender ganz offensichtlich die Anforderungen besonders gut erfüllen, die die Menschen an »gutes« Geld stellen.
Wer sich heutzutage auf der Welt umsieht, der erkennt allerdings: Es gibt kein Gold- oder Silbergeld mehr, das die Menschen im tagtäglichen Zahlungsverkehr verwenden. Ob US-Dollar, Euro, japanischer Yen, chinesischer Renminbi, britisches Pfund oder Schweizer Franken – sie alle stellen ungedecktes (Papier-)Geld beziehungsweise Fiat-Geld dar.
Der Begriff fiat stammt aus dem Lateinischen und bedeutet »es werde« oder »so sei es«. Fiat-Geld lässt sich daher auch als »erzwungenes Geld«, als »oktroyiertes Geld« bezeichnen. Das heute gebräuchliche Fiat-Geld zeichnet sich durch drei Eigenschaften aus:
(1) Fiat-Geld ist staatlich monopolisiertes Geld. Die staatlichen Zentralbanken haben das Geldproduktionsmonopol inne.
(2) Fiat-Geld wird durch Kreditvergabe »aus dem Nichts« geschaffen. Zentralbanken, in enger Kooperation mit Geschäftsbanken, vergeben Kredite, denen keine »echte Ersparnis« (Konsumverzicht) gegenübersteht, und erhöhen dadurch die ausstehende Geldmenge.[3]
(3) Fiat-Geld ist entmaterialisiertes Geld. Es besteht hauptsächlich in Form von bunt bedruckten Papierzetteln und Einträgen auf Computer-Festplatten (»Bits and Bytes«), die im Grunde jederzeit in beliebiger Menge und nahezu ohne nennenswerte Kosten vermehrbar sind.
Das Fiat-Geld ist nicht auf »natürliche Weise« – das heißt durch freiwillige Markttransaktionen – in die Welt gekommen, sondern auf »unnatürliche Weise«.[4] Im Jahr 1944 einigen sich die Vertreter von 44 Nationen auf der Konferenz von Bretton Woods im US-Bundesstaat New Hampshire darauf, dass der US-Dollar künftig die Weltleitwährung sein soll. Der US-Dollar ist dabei goldgedeckt: 35 US-Dollar entsprechen 1 Feinunze Gold (das sind 31,1034768 Gramm Gold). Alle anderen Währungen sind eintauschbar (konvertibel) in US-Dollar, und sie sind mit einem festen Wechselkurs an den US-Dollar gebunden. Mit dieser Konstruktion wird das Weltgeldsystem im US-Dollar beziehungsweise letztlich im Gold verankert. Das System von Bretton Woods ist kein echter Goldstandard, vielmehr nur ein (Pseudo-Dollar-)Goldstandard.[5]
Die Amerikaner beginnen bereits in den 1950er- und 1960er-Jahren, die US-Dollar-Geldmenge unablässig zu vermehren, ohne dass dabei die Golddeckung entsprechend mitwächst. Die Folge ist Inflation, die immer stärker zu steigen beginnt. Das Vertrauen in den US-Dollar schwindet, und in der Folge ziehen es viele Nationen vor, ihre US-Dollar-Guthaben bei der US-Zentralbank in physisches Gold umzutauschen. Das führt dazu, dass die Goldbestände der Vereinigten Staaten wie Schnee in der Sonne dahinschmelzen. Es wird zunehmend deutlicher, dass Amerika im Fall der Fälle nicht wie versprochen alle US-Dollar-Guthaben in physisches Gold einlösen kann. Um die Gefahr einer Zahlungsunfähigkeit abzuwenden, zieht US-Präsident Richard Nixon (1913–1994) am 15. August 1971 die »Notbremse«.
Er verkündet in einer Fernsehansprache, dass der US-Dollar mit sofortiger Wirkung vorübergehend nicht mehr in Gold einlösbar sei. Mit dieser unilateralen Entscheidung der US-Regierung, die bis zum heutigen Tag andauert (sich also alles andere als vorübergehend erwiesen hat), ist die Goldbindung des US-Dollar gekappt. Der »Greenback« und mit ihm auch alle anderen wichtigen Währungen der Welt werden zu Fiat-Geld degradiert. Wenn Lehrbücher über diese Episode berichten, ist meist zu lesen, die Regierung in Washington hätte »das Goldfenster geschlossen«. Ein Euphemismus, denn in Wahrheit stellte die amerikanische Entscheidung, die Goldeinlösepflicht des US-Dollar per Handstreich zu beenden, den wohl größten monetären Enteignungsakt der Neuzeit dar – mit Folgen, die noch heute zu spüren sind.
Defekte des Fiat-Geldes
Weil das Fiat-Geld auf unnatürliche Weise in diese Welt gekommen ist, mag es nicht allzu verwunderlich sein, wenn man feststellen muss, dass es unter schweren ökonomischen und ethischen Defekten leidet.[6] Sieben dieser Defekte sollen im Folgenden kurz skizziert werden.
Erstens: Fiat-Geld ist inflationär, weil die staatlichen Zentralbanken es unablässig vermehren. Das zeigt sich unübersehbar in chronisch steigenden Güterpreisen, die die Kaufkraft des Geldes schwinden lassen.[7] Inflationäres Geld ist bekanntlich schlechtes Geld.
Zweitens: Fiat-Geld ist unsozial, weil es wenige auf Kosten vieler begünstigt. Die Erstempfänger des neuen Geldes werden reicher auf Kosten derjenigen, die die neue Geldmenge erst später erhalten oder gar nichts von ihr abbekommen. Man spricht in diesem Zusammenhang vom »Cantillon-Effekt«. Zwar führt jede Erhöhung der Geldmenge (ob Waren- oder Fiat-Geldmenge) zu einer Umverteilung von Einkommen und Vermögen. Die Umverteilungswirkungen lassen sich jedoch beim Fiat-Geld besonders gut politisch ausbeuten – und das ist der Grund, warum der Staat das Warengeld durch sein eigenes Fiat-Geld ersetzt hat: Der Staat und die von ihm privilegierten Gruppen profitieren vom Fiat-Geld auf Kosten der anderen.
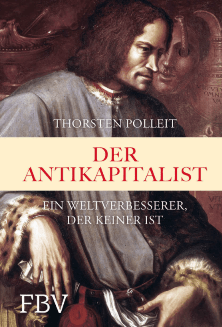 Drittens: Fiat-Geld sorgt für Wirtschaftsstörungen, für Boom und Bust. Die Vermehrung der Geldmenge durch Bankkreditvergabe senkt den Marktzins künstlich ab: Der Zins fällt unter das Niveau, das sich einstellen würde, wenn das Kreditangebot nicht künstlich ausgeweitet worden wäre. Dadurch nimmt das Sparen ab, der Konsum steigt, und zusätzlich werden neue Investitionen getätigt. Ein künstlicher Aufschwung (»Boom«) kommt so in Gang. Die Volkswirtschaft beginnt über ihre Verhältnisse zu leben. Früher oder später platzt der Boom und schlägt in einen Abschwung (»Bust«) um mit Rezession und Arbeitslosigkeit.
Drittens: Fiat-Geld sorgt für Wirtschaftsstörungen, für Boom und Bust. Die Vermehrung der Geldmenge durch Bankkreditvergabe senkt den Marktzins künstlich ab: Der Zins fällt unter das Niveau, das sich einstellen würde, wenn das Kreditangebot nicht künstlich ausgeweitet worden wäre. Dadurch nimmt das Sparen ab, der Konsum steigt, und zusätzlich werden neue Investitionen getätigt. Ein künstlicher Aufschwung (»Boom«) kommt so in Gang. Die Volkswirtschaft beginnt über ihre Verhältnisse zu leben. Früher oder später platzt der Boom und schlägt in einen Abschwung (»Bust«) um mit Rezession und Arbeitslosigkeit.
Viertens: Fiat-Geld treibt die Volkswirtschaft in eine Überschuldungssituation. Der künstlich gesenkte Zins verleitet Privatleute, Unternehmen und vor allem auch Staaten zur Schuldenwirtschaft. Die Kreditlasten wachsen dabei im Zeitablauf stärker, als die Einkommen zunehmen. Besonders heikel ist: Die dabei entstehende Schuldenpyramide kann nicht mehr vollumfänglich und in ehrlicher Weise zurückgezahlt werden. Das heißt, früher oder später kommt es zum Schwur beziehungsweise zur Schuldenkrise.
Fünftens: Fiat-Geld lässt den Staat anwachsen zulasten der bürgerlichen und unternehmerischen Freiheiten. Indem der Staat sich quasi jederzeit und zu günstigen Konditionen Kredite bei seiner Zentralbank beschaffen kann, steigt seine Finanzkraft gewaltig über das reguläre Steueraufkommen hinaus an. Der Staat kann auf diesem Wege recht problemlos Transferzahlungen, Arbeitsplätze und Aufträge an Firmen finanzieren, kann dadurch immer mehr Menschen von sich, dem »tiefen Staat«, abhängig machen und Wählerstimmen kaufen.
Sechstens: Fiat-Geld verformt die Moral- und Wertevorstellungen der Menschen.[8] Wenn die Zentralbank den Zins künstlich absenkt, führt das dazu, dass die Menschen das Heute als noch bedeutender ansehen als das Morgen; ihre Gegenwartsorientierung steigt auf Kosten ihrer Zukunftsorientierung. Das Leben auf Pump kommt in Mode, das Konsumieren wird zulasten des Sparens befördert. Die Lebensführung wird kurzatmiger, weniger reflektiert und verantwortungsvoll. Die Folgen treffen nicht zuletzt auch die Umwelt: Das zeitliche Vorziehen des Konsums erhöht den Ressourcenverbrauch und verschärft die Umweltbelastungen.[9]
Siebtens: Fiat-Geld erlaubt es dem Staat, nicht nur nach innen, sondern auch nach außen eine aggressive Politik zu verfolgen. Denn die Kosten für kriegerische Auseinandersetzungen fallen im Fiat-Geldsystem geringer aus als im Sachgeldsystem.[10] Beispielsweise wurden die beiden großen Weltkriege in ihrer ganzen Unerbittlichkeit letztlich nur deshalb möglich, weil viele Staaten ihren Währungen die Golddeckung entzogen und die Kriegsausgaben auch mit einer inflationären Ausweitung der Geldmenge finanzieren konnten.
Fiat-Geld ist antikapitalistisches Geld
Häufig werden wirtschaftliche und gesellschaftliche Missstände – wie Finanz- und Wirtschaftskrisen sowie eine wachsende Einkommens- und Vermögensungleichheit – dem System freier Märkte – dem Kapitalismus – angelastet. Doch das ist ein Fehlschluss. Denn mit Kapitalismus, das heißt mit einem echten Kapitalismus, hat das Fiat-Geld nichts zu tun.[11]
Der Ökonom Roland Baader (1940–2012) hat in diesem Zusammenhang den Begriff »Geldsozialismus« geprägt.[12] Wie treffend! Fiat-Geld steht nämlich im Widerspruch zum Kapitalismus (der im Kern für eine Privatrechtsgesellschaft[13]steht). Denn das, was einen echten Kapitalismus im Kern auszeichnet, ist der unbedingte Respekt vor dem Eigentum; die strenge Unterscheidung zwischen Mein und Dein ist im Kapitalismus der nicht verhandelbare Maßstab für das Handeln der Menschen.
Eigentum kann im Kapitalismus nur auf drei nicht-aggressiven Wegen erworben werden: durch (1) Inbesitznahme bisher nicht anderweitig beanspruchter Ressourcen (»Homesteading«), (2) Produktion von Gütern mit »eigner Hände Arbeit« und (3) freiwilliges Tauschen beziehungsweise Schenken. Das Eigentum ist nicht, wie vielfach befürchtet, ein Problem, sondern vielmehr ein »Problemlöser«. Denn – und das mag eine verblüffende Einsicht sein – im Kapitalismus befinden sich die Produktionsmittel (Land, Maschinen, Fabriken etc.) zwar rechtlich gesehen im Privateigentum (während sie im Sozialismus Gemeineigentum sind), nicht aber wirtschaftlich gesehen. Wie erklärt sie sich?
Die Eigentümer der Produktionsmittel (die Kapitalisten) setzen ihre Maschinen, Fabriken, Lastwagen etc. nicht für die Deckung des Eigenbedarfs ein (wie es in einer Subsistenzwirtschaft der Fall ist), sondern sie verwenden sie, um das herzustellen, was andere Menschen nachzufragen wünschen. Die Kapitalisten stellen ihre Produktionsmittel in den Dienst der Nachfrager. Gelingt es ihnen, mit den von ihnen erzeugten Produkten die Kundenwünsche zu erfüllen, und können sie die Erzeugnisse zu einem Preis verkaufen, der die Herstellungskosten deckt, machen sie einen Gewinn. Er ist die Belohnung für gute Dienste. Unternehmen, die Gewinne erzielen, können ihre Produktion erweitern und verbessern, um die Kundenwünsche künftig noch besser erfüllen zu können.
Unternehmen hingegen, die schlecht wirtschaften, die Erzeugnisse herstellen, für die der Kunde nicht bereit ist zu zahlen, erleiden Verluste. Das zwingt die Unternehmer, besser zu wirtschaften, ihre Produktion gezielt(er) auf die Kundenwünsche auszurichten. Gelingt ihnen das nicht, scheiden sie über kurz oder lang aus dem Markt aus, machen besseren Produzenten Platz. Das Gewinn-und-Verlust-Prinzip sorgt dafür, dass die knappen Mittel zu den »besten Wirten« gelangen – die so in die Lage versetzt werden, die Güter in der Menge und in der Qualität zu anzubieten, wie sie von den Kunden nachgefragt werden, und zwar zu niedrigsten Preisen. Ohne solch eine kapitalistisch-orientierte Produktionsweise wäre die Güterversorgung für die derzeit 7,7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten gar nicht möglich.
Dass das Fiat-Geld unvereinbar ist mit dem Kapitalismus, offenbart schon seine (voranstehend geschilderte) Entstehung: Es konnte nur durch eine Verletzung von Eigentumsrechten in die Welt kommen – durch Enteignung der Eigentümer des Grundgeldes Gold. Aber auch die staatliche Monopolisierung der (Fiat-)Geldproduktion stellt eine Verletzung der Eigentumsrechte dar: Es schränkt die Freiheit derjenigen ein, die Geld produzieren und es im freien Markt anbieten wollen. Zudem werden die Menschen de facto gezwungen, das staatlich monopolisierte Fiat-Geld und kein anderes Geld zu verwenden. Im Ergebnis führt all das zu nicht-marktkonformer Umverteilung von Einkommen und Vermögen. Fiat-Geld entspringt nicht kapitalistischen Prinzipien (Eigentumsschutz), sondern vielmehr kollektivistisch-sozialistischen (Eigentumsverletzung).
Abwärtsspirale Interventionismus
Kollektivistisch-sozialistische Denker und Agitatoren haben den (echten) Kapitalismus in Misskredit gebracht – und gleichzeitig das Fiat-Geldsystem gegenüber einer sachgerechten Kritik abgeschirmt. Der »Kapitalismus« hat mittlerweile einen üblen Ruf, er gilt vielen als »kalt«, »ungerecht«, »unmoralisch«, »unkontrollierbar« und »krisenstiftend«. Die Missstände der Zeit – ob Finanz- und Wirtschaftskrisen, Rezession und Arbeitslosigkeit, exzessive Managergehälter, Inflation, Wohnungsknappheit und hohe Mietpreissteigerungen oder Altersarmut – werden geradezu reflexartig dem Kapitalismus in die Schuhe geschoben. Doch das ist nicht sachgerecht. Schließlich entsprechen die Wirtschafts- und Gesellschaftsmodelle, die man heute in den entwickelten Volkswirtschaften der Welt vorfindet, in keiner Weise dem (echten) Kapitalismus, sondern sie sind vielmehr Spielarten des Interventionismus.
Der Interventionismus bezeichnet ein Wirtschaftssystem, in dem der Staat durch Weisungen, Vorschriften, Regulierung, Gebote und Verbote den Eigentümern vorschreibt, was sie mit ihrem Eigentum dürfen und was nicht. Anders als im Sozialismus darf zwar jeder Bürger und Unternehmer sein Eigentum formal behalten. Der Staat schränkt jedoch die effektiven Verfügungsrechte der Eigentümer über ihr Eigentum ein. Anders gesagt: Der Interventionismus ist ein System, in dem der Staat das Eigentum der Menschen gezielt relativiert beziehungsweise verletzt, um aus politischer Sicht wünschenswerte(re) Ergebnisse zu erzielen. Doch der Interventionismus ist – und das lässt sich nationalökonomisch überzeugend zeigen – kontraproduktiv. Er verfehlt die Ziele, die seine Befürworter mit ihm erreichen wollen. Ein einfaches Beispiel soll das illustrieren.
Der Staat setzt eine Obergrenze für Mieten, um Wohnraum erschwinglicher zu machen. Fällt die Mietobergrenze niedriger aus als die Miete, die sich durch Angebot und Nachfrage im Wohnungsmarkt einstellen würde, geht das Wohnraumangebot zurück, und gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Wohnraum an. Der sich einstellende Nachfrageüberhang im Wohnungsmarkt führt zu Mauschelei, zu Korruption und Willkür bei der Zuteilung des knapp gewordenen Wohnraums. Zudem sinkt die Neigung der Investoren, das Wohnraumangebot durch Neubauten zu erhöhen – schließlich schmälert ja die Mietobergrenze die Investitionsrendite. Aus dem gleichen Grund wird es für die Eigentümer von Immobilienbeständen weniger attraktiv, in Wartung und Instandhaltung zu investieren. Kurzum: Die Mietobergrenze verknappt und verschlechtert die Lage am Mietmarkt, und das geht vor allem auch zulasten der Mieter.
In wohl keinem anderen Feld aber treten die negativen Konsequenzen des Interventionismus so unverblümt in Erscheinung wie im staatlichen Fiat-Geldsystem. Das Ausgeben von Fiat-Geld verursacht notwendigerweise Finanz- und Wirtschaftskrisen. Um sie zu »bekämpfen«, senken die Zentralbanken die Leitzinsen und weiten die Kredit- und Geldmengen aus. Den Volkswirtschaften wird folglich noch mehr von dem gleichen Mittel verabreicht, das ursächlich für die Krise ist: zu niedrige Zinsen und zu viel Kredit und Geld, geschaffen »aus dem Nichts«! Die Gründe für die Krise (die aufgelaufenen Fehlentwicklungen in Form von Überkonsumption und Kapitalfehllenkungen) werden dadurch nicht gelöst. Vielmehr werden die aufgelaufenen Fehlentwicklungen noch weiter verschlimmert.
Es sind vor allem die durch Fiat-Geld verursachten Krisen, die sich als selbstverstärkendes Wachstumselixier für den Staat erweisen. Denn um die Probleme, die der Interventionismus heraufbeschwört hat, nicht in Erscheinung treten zu lassen, fordern die Interventionismus-Befürworter noch mehr Interventionen. Nach dem Motto: Wenn bisherige Interventionen nicht ihr Ziel verfehlt haben, dann liegt das daran, dass man nicht entschieden genug vorgegangen ist. Erforderlich seien »mehr« und »bessere« Interventionen. Mit ihnen werden sich die angestrebten Ziele ganz sicher erreichen lassen. Doch auch die nächste Welle des Interventionismus behebt nicht die Missstände. Eine unheilvolle Interventionsspirale kommt in Gang.
Der Staat beginnt, Industrien zu subventionieren, neue Verordnungen und Gesetze zu erlassen und vieles andere mehr. Immer mehr Menschen geraten dadurch direkt oder indirekt in wirtschaftliche und finanzielle Abhängigkeit von den Staatsinterventionen. Sie verlieren ihr Interesse am System der freien Märkte, werden zu Befürwortern staatlicher Zwangsmaßnahmen, durch die sie hoffen, bessergestellt zu werden. Die staatlichen Interventionen führen so gesehen zu einer kollektiven Korruption[14], durch die Wirtschaft und Gesellschaft nach und nach in ein kollektivistisch-sozialistisches Gemeinwesen überführt werden. Die Marktkräfte werden im Zuge des Interventionismus immer stärker daran gehindert, aufgelaufene Fehlentwicklungen korrigieren zu können. Die eigentlich notwendige »Bereinigungskrise« bleibt aus, der Preis dafür ist de facto die Abschaffung der freien Marktwirtschaft.
Fehlgeleitete Kritik
Vor diesem Hintergrund sollte deutlich geworden sein, dass die Kritik, das Geld- und Finanzsystem sei ein kapitalistisches Übel, falsch ist. Das Fiat-Geldsystem und all seine Nebenwirkungen sind das Ergebnis des staatlichen Interventionismus. Umso verwunderlicher ist es, dass der Kapitalismus beziehungsweise der Neoliberalismus mehr denn je in der Kritik steht.[15] Wie erklärt sich das? Erinnern wir uns: Der klassische Liberalismus im 19. und frühen 20. Jahrhundert stand für Eigentum, Freiheit des Individuums, Gleichheit vor dem Recht und Frieden als nicht verhandelbare Grundprinzipien des Zusammenlebens und Wirtschaftens. Der Staat ist auf das Notwendigste beschränkt: Seine Aufgabe ist der Schutz des Einzelnen und des Eigentums vor Übergriffen. Doch die kollektivistischen-sozialistischen Ideen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufkamen, ließen die politische Attraktivität des klassischen Liberalismus verblassen, der Interventionismus brach sich zusehends Bahn.
Das einschneidende Ereignis kam mit der Weltwirtschaftskrise 1929–1933. Ihre Ursache erblickte man im Versagen des klassischen Liberalismus und des Interventionismus. Die Suche nach einer Lösung begann. Alexander Rüstow (1885–1963) empfahl den »Neoliberalismus«. Damit meinte er ein Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, in dem der »starke Staat« als unparteiischer Richter über allen Interessengruppen steht, in dem er den Leistungswettbewerb sicherstellt und gleichzeitig für die sozialen Belange der Menschen Sorge trägt.[16] Rüstow deutete – anders als die herrschende Meinung – die damalige Krise richtigerweise als Staatsversagenskrise. Doch die Kernidee seines Neoliberalismus, man könne sich der »guten Seiten« des Staates (wie wir ihn heute kennen) bedienen und gleichzeitig seine »schlechten Seiten« durch Verfassungen und Gesetze neutralisieren, erwies sich als ein folgenschwerer Fehler: Denn ein Staat – der territoriale Zwangsmonopolist, der die Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte in seinem Gebiet hat – lässt sich nicht zähmen und einhegen.
Solch ein Staat wird notwendigerweise zum Spielball von Sonderinteressengruppen, die ihn für ihre Zwecke einnehmen wollen; politische Ideologen und Agitatoren versuchen, die Staatsmacht für ihre Zwecke dienstbar zu machen. Vor allem in einem Mehrheitswahlsystem (Demokratie) entbrennt eine Jagd nach Privilegien. Politiker versprechen Wählern Wohltaten (gute Schulen, sichere Pensionen etc.), heizen Umverteilungsfantasien an (»Reiche besteuern«), um an die Macht gewählt zu werden. Die Wähler geben denjenigen Politikern und Parteien ihre Stimme, von denen sie meinen, sie werden ihre Wünsche bestmöglich bedienen – selbst wenn das auf Kosten der Mitmenschen geht. Es ist absehbar, dass unter diesen Bedingungen der Staat immer größer wird, dass kein Lebensbereich vor seinem Zugriff verschont bleibt; dass selbst ein Minimalstaat früher oder später zu einem Maximalstaat mutiert.[17]
Rüstows Idee des Neoliberalismus fällt jedoch auf fruchtbaren Boden. Aus ihr entwickelt die sogenannte Ordoliberale Schule die »Soziale Marktwirtschaft«, die zum identitätsstiftenden Vorzeigemodell der Bundesrepublik Deutschland aufsteigt.[18] Doch der Neoliberalismus ist kein großer Wurf, er ist lediglich eine Spielart des Interventionismus. Die Kritik am Neoliberalismus, soweit sie sich als Kritik am Kapitalismus versteht, ist daher verfehlt. Dass sie aber heute in genau diesem Sinne vorgetragen wird, liegt vermutlich daran, dass ökonomische Denkschulen ganz unterschiedlichster Provenienz in einen Topf geworfen werden, wie zum Beispiel die Vertreter des Ordoliberalismus, der Chicago School und der Österreichischen Schule der Nationalökonomie. Kapitalismusfeinde, Kapitalismusrelativierer und Kapitalismusbefürworter werden so gleichermaßen dem Neoliberalismus zugeordnet.
Die Dominanz des demokratischen Sozialismus
Das politisch-ideologische Fundament des Neoliberalismus beziehungsweise des Interventionismus ist der demokratische Sozialismus, eine besondere Ausprägung des Sozialismus.[19] Zur Erinnerung: Zum einen gibt es den russischen Sozialismus (Marxismus-Leninismus). Er will die Verstaatlichung der Produktionsmittel durch einen gewaltsamen Umsturz, durch blutige Revolution herbeiführen – wie sie im Jahr 1917 in Russland abgelaufen ist. Zum anderen gibt es den demokratischen Sozialismus (deutscher Herkunft). Er will den Sozialismus »friedvoll«, durch parlamentarische Mehrheiten, mit demokratischen Mitteln errichten. Formal soll dabei das Eigentum an den Produktionsmitteln erhalten bleiben, de facto jedoch schrittweise relativiert und aufgehoben werden.
Im demokratischen Sozialismus geschieht das beispielsweise, indem dem Eigentümer der 100-prozentige Anspruch auf die Erträge, die er mit seinen Produktionsmitteln erzielt, verwehrt wird: Einen Teil seiner Erträge muss er als Steuern dem Staat aushändigen. Oder es erfolgt dadurch, dass der Staat die Verfügungsrechte der Eigentümer über ihr Eigentum einschränkt: Mit Regularien, Ge- und Verboten und Gesetzen erzwingt der Staat die von ihm politisch gewünschte Verwendung der Produktionsmittel. Das erklärt übrigens auch, warum demokratische Sozialisten häufig euphorische Befürworter der Sozialen Marktwirtschaft sind – denn die Soziale Marktwirtschaft ist im Kern nichts anderes als eine Form des Interventionismus: Sie ist ein Alternativentwurf, gewissermaßen ein gesellschaftlich akzeptierter Gegenentwurf zum reinen Kapitalismus.[20]
Der demokratische Sozialismus ist in den letzten Jahrzehnten zur allseits akzeptierten Politideologie aufgestiegen, und der von ihm befürwortete Interventionismus hat mittlerweile alle Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche tief durchdrungen: Ob Erziehung, Bildung, Gesundheits- und Altersvorsorge, Umweltschutz, Transport, Recht und Sicherheit, Geld und Kredit – überall ist der Staat zum dominierenden Spieler aufgestiegen. Dass der Staat dabei insbesondere alles daransetzt, das Geld- und Kreditsystem zu beherrschen, und dass er das Warengeld durch sein eigenes Fiat-Geld ersetzt, kann nicht verwundern. Denn der demokratische Sozialismus verschafft sich seine Zustimmung bei der Wahlbevölkerung durch eine andauernde und wachsende Umverteilung (durch die den einen genommen und den anderen gegeben wird).
Diese Umverteilung lässt sich aus den normalen Steuereinnahmen allein nicht bestreiten. Eine aus politischer Sicht besonders attraktive Finanzierungsquelle bietet die Monopolisierung der Geldproduktion. Der Staat kann sich dann nämlich im wahrsten Sinne des Wortes das benötigte Geld selber drucken. Und die fortgesetzte Vermehrung der Fiat-Geldmenge wirkt wie eine »Inflationssteuer«, durch die der Staat still und heimlich an die Einkommen und Vermögen gelangt.[21] Besonders attraktiv ist es für den Staat, sich das benötigte Geld per Kredit zu beschaffen – bereitgestellt zu günstigen Zinssätzen, für die die staatliche Zentralbank sorgt. Die Geschäftsbanken stehen dem Staat bei diesem Unterfangen hilfreich zur Verfügung. Sie verdienen schließlich prächtig, wenn ihnen von staatlicher Seite erlaubt wird, neues Fiat-Geld per Kredit in Umlauf zu geben.
Das Fiat-Geldsystem spielt dem demokratischen Sozialismus in besonderer Weise in die Hände: Je länger es Bestand hat, desto mehr Arbeitnehmer und Unternehmer werden abhängig von seiner Fortführung. Arbeitsplätze, Altersvorsorge, Aufträge und Gewinne, berufliche Karrieren und sozialer Status – alles hängt am Fortbestand des Wirtschafts- und Gesellschaftssystems, welches das Fiat-Geldsystem (mit-)geformt hat. Eine wachsende Zahl von Menschen wird so zu willigen Unterstützern des Fiat-Geldsystems. In Krisenzeiten eröffnet das dem Staat weitgespannte politische Spielräume, um »Rettungsmaßnahmen« in großem Stile auf den Weg zu bringen – in Form von zum Beispiel Kreditgarantien, Geldspritzen, Null- und Negativzinsen –, die das Fiat-Geldsystem vor dem Zusammenbruch bewahren sollen.
Die Krisen, für die der monetäre Interventionismus notwendigerweise sorgt, ziehen immer mehr und immer weitergehende Interventionen nach sich. Das, was vom System der freien Märkte noch übrig ist, wird so nach und nach ausgeschaltet. Das Fiat-Geld trägt auf diese Weise maßgeblich dazu bei, das Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell im Zeitablauf in eine Befehls- und Lenkungswirtschaft umzuformen, in der der Staat beziehungsweise die ihn beherrschenden Sonderinteressen das Sagen haben und in dem der Endnachfrager, der Konsument, zusehends entmachtet wird. Dass der Interventionismus, wenn man an ihm unbeirrt festhält, in den Sozialismus führt, ist eine zentrale Einsicht, die Ludwig von Mises (1881–1973) in seinem Buch Kritik des Interventionismus (1929) formuliert hat.[22]
Berechtigte Demokratiekritik
Im Interventionismus gerät die Demokratie unter die Räder. Je weitreichender die staatlichen Eingriffe in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben werden, desto komplizierter und unübersichtlicher werden sie. In diesem Umfeld gedeiht die »Herrschaft der Experten«[23], der Fachleute, der Bürokraten. Ihr Fachwissen übersteigt das der Politiker und der breiten Öffentlichkeit, und sie sind es, die quasi hinter den Kulissen des Interventionismus wichtige wirtschafts- und gesellschaftspolitische Weichenstellungen vornehmen: Sie sagen, welche Interventionen notwendig sind, um bestimmte Ziele – wie Wachstum und Beschäftigung – zu erreichen. Und in der Regel sind die Wirkungen, für die die Experten-Interventionen sorgen, für Nicht-Experten nicht übersehbar. Das hält den Widerspruch, den die Expertenempfehlungen erfahren, gering.
Unter der Herrschaft der Experten schwindet die Bedeutung der Parteien und der demokratischen Willensbildung in gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen. Das könnte übrigens auch eine mögliche Erklärung dafür sein, warum in den letzten Jahren in vielen Ländern das Vertrauen in die repräsentative Demokratie gelitten hat: Im Interventionismus wird die Demokratie für die Wähler zusehends schlechter nach ihren Präferenzen kontrollierbar. Der von Experten gesteuerte Interventionismus führt zudem zu Pfadabhängigkeiten: Einmal getroffene Entscheidungen erzwingen quasi häufig nachfolgend bestimmte Folgemaßnahmen und verengen dadurch den künftigen Entscheidungsspielraum. Der demokratische Sozialismus, der sich des Interventionismus bedient, führt letztlich nicht zu mehr, sondern zu weniger Demokratie.
Diese Befürchtung wird durch das »eherne Gesetz der Oligarchisierung«, wie es Robert Michels (1876–1936) bereits 1911 vortrug, gestärkt:[24] In der Demokratie kommt es, so Michels, zu Parteigründungen. Parteien sind Organisationen, und sie bedürfen der festen Führung. Diese wird von einer kleinen Gruppe von Menschen übernommen – die gewieft ist und den Willen zur Macht hat. Es bildet sich eine oligarchische Elitenherrschaft heraus, die sich weitgehend gegen Kritik von innen und außen immunisiert. Über kurz oder lang weichen die Partei-Eliten vom Partei- und Wählervotum ab, verfolgen ihre eigene antikapitalistische Agenda, kooperieren beispielsweise mit Lobbygruppen (»Big Business«). Der Wählerwille bleibt dabei auf der Strecke. Die Demokratie – wenn der Wähler sich von ihr die Selbstbestimmung erhofft – ist eine große Illusion, so Michels: In der Demokratie kommt es zur Herrschaft der Gewählten über die Wähler, der Beauftragten über die Auftraggeber.
Geld im Kapitalismus
Bleibt abschließend die Frage zu klären: Wie sieht das Geld im echten Kapitalismus aus? Antwort: Die Menschen haben hier ein unbeschränktes Selbstbestimmungsrecht bei der Geldwahl, es gibt einen freien Markt für Geld. Jedem steht es folglich frei, das Geld zu wählen, das seinen Bedürfnissen am besten entspricht; und jeder hat die Freiheit, seinen Mitmenschen ein Angebot für »gutes Geld« zu machen. In einem freien Markt für Geld entscheidet letztlich der Geldnachfrager, was Geld ist. Er wird natürlich »gutes Geld« nachfragen und nicht »schlechtes Geld« (genauso wie Menschen »gute Schuhe« und nicht »schlechte Schuhe« nachfragen).
Jeder wird etwas als Geld nachfragen, das erwartungsgemäß von seinen Tauschpartnern als Geld anerkannt wird: Die Wahl des Gutes, das als Geld dient, erfolgt folglich mit Blick auf die Wünsche der Handelspartner. Ein Beispiel: Sie wollen Frühstücksbrötchen kaufen. Was bieten Sie dem Bäcker dafür an? Am besten etwas, mit dem der Bäcker beim Schuster Schuhe oder beim Schneider Hosen erwerben kann. Und genau so ist es: In einem freien Markt für Geld fragen die Menschen ein Gut als Geld nach, das die breiteste Akzeptanz bei der größten Zahl der Menschen findet. Und wenn Freihandel besteht, wenn also den Menschen das größtmögliche Ausschöpfen der internationalen Arbeitsteilung möglich ist, würde sich ein einheitliches internationales Geld herausbilden. Ein Geld, das von allen Menschen der Welt verwendet würde.
Aus der Geldtheorie wissen wir, dass die natürlichen Kandidaten im Wettbewerb um die Geldfunktion Sach- beziehungsweise Edelmetalle sind, allen voran Gold und Silber; mit Blick auf die technologischen Neuerungen wäre prinzipiell auch eine Kryptowährung denkbar.[25] Dass ein freier Markt für Geld problemlos funktionieren würde – so reibungslos wie der Markt für Armbanduhren, Urlaubsreisen, Fährräder oder Wohnhäuser –, steht außer Frage. Das lässt sich nicht nur theoretisch herleiten. Es gibt auch reichlich historisches Anschauungsmaterial: Frei gewähltes Geld – Sach- beziehungsweise Edelmetallgeld – ist, wie gesagt, die historische Norm, während währungsgeschichtlich gesehen ein staatlich monopolisiertes Fiat-Geld ein Ausnahmezustand, kein Normalzustand ist.
Wie sähe die Welt aus, gäbe es einen freien Markt für Geld? Die Frage lässt sich zwar im Voraus nicht exakt beantworten, aber einige grundlegende Unterschiede zum herrschenden Fiat-Geldsystem lassen sich dennoch skizzieren. Es gäbe beispielsweise keine chronische Geldentwertung wie im heutigen Fiat-Geldsystem – denn die Menschen würden vermutlich vorzugsweise nicht-inflationäres Geld nachfragen, Geld, das seine Kaufkraft im Zeitablauf relativ verlässlich bewahrt. Es gäbe keine Geldmengenvermehrung durch Kreditvergabe aus dem Nichts, und monetär verursachte Boom-und-Bust-Zyklen wären nicht mehr an der Tagesordnung. Die Einkommens- und Vermögensverteilung würde sich nach dem Nutzen richten, den ein jeder seinen Mitmenschen erweist. Sie wäre nicht mehr dadurch bestimmt, wie gut jemand die Umverteilungswirkungen des Fiat-Geldes für sich auszunutzen weiß.
In einem freien Markt für Geld würde ein Trennbanksystem entstehen.[26] Verwahr-, Besicherungs- und Zahlungsabwicklungsdienste würden von Depositenbanken angeboten. Kreditbanken würden die Darlehensnachfrage bedienen und sich das für die Darlehensvergabe erforderliche Geld durch Ausgabe von Aktien und/oder verzinslichen Schuldpapieren beschaffen. Eine Ausweitung des Kreditangebots ginge folglich nicht mehr einher mit einer inflationären Ausweitung der Geldmenge. Die Geldverwender könnten in gewohnter Weise ihre Zahlungen bar oder elektronisch (per Überweisung, Lastschrift, Kreditkarte, Apple Pay, Internetbanking etc.) abwickeln.
Der Marktzins würde sich frei und ungehindert durch das Angebot von und die Nachfrage nach Ersparnissen bilden. Das würde sicherstellen, dass genügend Ersparnisse vorhanden sind, um die Investitionen zu vollenden. Die Zeitpräferenz der Menschen würde nicht mehr künstlich in die Höhe getrieben, wie es im Fiat-Geldsystem der Fall ist. Das heißt, die Gegenwartsorientierung der Menschen würde nicht noch weiter in die Höhe getrieben zulasten der Zukunftsorientierung. Die vielfältigen wirtschaftlichen, aber auch sozialpolitischen Probleme, die aus Überkonsum und Fehlinvestitionen, aber auch aus Kurzatmigkeit und Kurzfristorientierung der Handelnden resultieren, würden eingedämmt.
Zu guter Letzt: Es dürfte wenig überraschend sein, dass die Idee des Staates im echten Kapitalismus eine gänzlich andere ist als im demokratischen Sozialismus. Der echte Kapitalismus geht mit einer Privatrechtsgesellschaft Hand in Hand. In ihr gilt gleiches Recht für alle. Ein jeder hat ein Selbstbestimmungsrecht[27], ist Eigentümer seiner selbst (»Selbsteigentum«) und auch der Güter, die er auf nicht-aggressivem Wege erworben hat. Ein Staat, wie wir ihn heute kennen, ist unvereinbar mit einem echten Kapitalismus. Güter wie Recht und Sicherheit würden nicht, wie es heute der Fall ist, von einer (Zentral-)Instanz (zwangs-)monopolisiert, sondern durch Angebot und Nachfrage im freien Markt in der gewünschten Menge und Qualität bereitgestellt.[28]
Vor diesem Hintergrund sollte deutlich geworden sein, dass die Kritik am Neoliberalismus, soweit sie Kapitalismuskritik sein will, fehlgeleitet ist: Die vielen zu Recht angeprangerten Missstände unserer Zeit – wie Finanz- und Wirtschaftskrisen, ein immer stärkeres Auseinanderklaffen der Einkommens- und Vermögensschere und vieles andere mehr – sind aber nicht die Folgen des Kapitalismus, sondern des Interventionismus: Es ist das staatliche Fiat-Geldsystem, das der Interventionismus hervorbringt, das unweigerlich immer neue und auch immer größere Krisen verursacht, und diese Krisen werden dann in der Öffentlichkeit fälschlicherweise – ob aus Unkenntnis oder aufgrund eines bewussten politischen Kalküls – dem System der freien Märkte, also dem Kapitalismus, angelastet.
Die Interventionsspirale, die dadurch in Gang gesetzt wird, zerstört nach und nach die Grundpfeiler der freien Gesellschaft und damit die produktive und friedvolle Kooperation der Menschen. Soll das verhindert werden, muss sich Wesentliches ändern: Man muss sich vom demokratischen Sozialismus, von allen sozialistischen-kollektivistischen Irrlehren abkehren, von jeder staatsverherrlichenden Verblendung loslösen. Diese Änderungen können letztlich nur durch die Einsicht in die Verkehrtheit des demokratischen Sozialismus, seines Interventionismus und vor allem seines Fiat-Geldsystems bewirkt werden. Zugegeben, das ist ein schwieriges – aber kein aussichtsloses Unterfangen.
[1] Siehe hierzu Mises (1953), Theory of Money and Credit, S. 29–37.
[2] Siehe Menger (1871), Grundsätze der Volkwirthschaftslehre, S. 250–285.
[3] Es sei hier angemerkt, dass Fiat-Geld auch geschaffen wird, indem die Zentralbank zum Beispiel Aktien oder Bürohäuser kauft, oder dadurch, dass sie ihren eigenen Mitarbeitern die Löhne bezahlt.
[4] Eine Erklärung dazu findet sich bei Rothbard (2008 ([1963]), What Has Government Done To Our Money?
[5] Das System von Bretton Woods war kein Goldstandard, sondern ein Pseudo-Goldstandard. In einem echten Goldstandard ist die ausstehende Menge an Banknoten und Giroguthaben zu 100 Prozent durch physisches Gold hinterlegt. Das aber war im System von Bretton Woods nicht der Fall – wie es übrigens auch in vielen anderen Episoden der Währungsgeschichte nicht der Fall war. Daher sollte man den gängigen Schilderungen auch nicht kritiklos folgen, für die Finanz- und Wirtschaftskrisen im 19. und frühen 20. Jahrhundert sei das »Versagen« des Goldstandards ursächlich gewesen. Weit gefehlt: Es waren die Verstöße gegen die Regeln des echten Goldstandards, die immer wieder zu Krisen geführt haben und von den Staaten nicht sanktioniert wurden, beziehungsweise es waren die Staaten, die für den Regelbruch verantwortlich waren.
[6] Siehe hierzu Polleit, Prollius (2014), Geldreform.
[7] Die Kaufkraft des Geldes wird üblicherweise wie folgt definiert: Kaufkraft einer Geldeinheit = 1 / P, wobei P für die Güterpreise steht. Steigt (fällt) P, so nimmt die Kaufkraft des Geldes ab (zu).
[8] Siehe hierzu Hülsmann (2013), Krise der Inflationskultur, insb. S. 233–254.
[9] Das Fiat-Geld verursacht Fehlallokationen: Knappe Ressourcen werden verschwendet, und die Produktionsfaktoren (zu denen auch natürliche Ressourcen wie insbesondere Energie zählen) stehen nicht mehr für andere Verwendungen zur Verfügung (Stichwort: »Bauruinen«).
[10] In einem Goldgeldsystem ist eine inflationäre Ausweitung der Geldmenge nicht möglich, und die staatliche Schuldenfinanzierung sorgt für steigende Marktzinsen – die die Wirtschaft abbremsen und so der Öffentlichkeit die Kosten der Kriegstätigkeit unmissverständlich vor Augen führen. Anders im Fiat-Geldsystem: Die Kriegsausgaben lassen sich hier mit der Ausgabe von inflationärem neuen Geld finanzieren. Bei einer steigenden Kreditnachfrage des Staates können zudem das Kreditangebot und die Geldmenge ausgeweitet und gleichzeitig der Zins niedrig gehalten werden. Eine solche Kriegsfinanzierung löst tendenziell einen Konjunkturschub aus – und das reduziert den Widerstand der Öffentlichkeit gegen militärische Abenteuer der Staaten.
[11] An dieser Stelle sei angemerkt, dass es nirgendwo auf der Welt derzeit einen echten Kapitalismus gibt und dass es ihn auch in der Vergangenheit noch nicht in »Reinform« gegeben hat. Die russisch-amerikanische Schriftstellerin Ayn Rand (1905–1982) spricht daher auch treffend vom »Kapitalismus als das unbekannte Ideal«, wie der Titel von Ayn Rands Aufsatzsammlung lautet (»Capitalism: The Unknown Ideal«, 1967).
[12] Siehe Baader (2010), Geldsozialismus.
[13] Siehe hierzu Hoppe (2012), Wettbewerb der Gauner, S. 73–88.
[14] Siehe hierzu Polleit (2011), Fiat Money and Collective Corruption; ders. (2012), Kollektive Korruption.
[15] Zur Geschichte des Neoliberalismus siehe Plickert (2008), Wandlungen des Neoliberalismus.
[16] In seinem Vortrag »Freie Wirtschaft, starker Staat«, den er auf der im September 1932 auf der Dresdner Tagung des Vereins für Socialpolitik hielt, skizzierte Rüstow seine Idee des Neoliberalismus: »Der neue Liberalismus jedenfalls, der heute vertretbar ist, und den ich mit meinen Freunden vertrete, fordert einen starken Staat, einen Staat oberhalb der Wirtschaft, oberhalb der Interessenten, da, wo er hingehört.« Siehe hierzu auch Rüstows Erläuterungen in Prollius (2007), Herrschaft oder Freiheit, S. 155–158.
[17] Diese Einsicht formuliert unmissverständlich Hoppe (2006), On the Errors of Classical Liberalism and the Future of Liberty, S. 229.
[18] Zur Kritik an der Sozialen Marktwirtschaft siehe hier Kapitel 6; Polleit (2018), Die Utopie der Sozialen Marktwirtschaft; ders. (2018), Die »Soziale Marktwirtschaft« Erhardscher Prägung aus Sicht der klassischen liberalen Ökonomik. Der Ordoliberalismus ist in jüngster Zeit auch wieder kritisch betrachtet worden. Zur Kritik am Wettbewerbskonzept des Ordoliberalismus siehe z. B. Rhonheimer (2017), Ludwig Erhards Konzept der sozialen Marktwirtschaft und seine wettbewerbstheoretischen Grundlagen.
[19] Siehe hierzu Hoppe (2010), A Theory of Socialism and Capitalism, S. 31–52 und S. 55–81.
[20] Zu einer grundlegenden Kritik der Sozialen Marktwirtschaft siehe hier Kapitel 6; Polleit (2018), Die Utopie der Sozialen Marktwirtschaft.
[21] Ein Effekt des inflationären Geldes ist »kalte Progression«. Er entsteht, wenn die Eckwerte eines progressiven Steuertarifs nicht angepasst werden.
[22] Mises (2013), Kritik des Interventionismus. Hier bringt er es auf den Punkt (S. 36): »Entweder Kapitalismus oder Sozialismus; ein Mittelding gibt es nicht.«
[23] Hayek (1960), Die Verfassung der Freiheit, S. 369, Fußnote 10.
[24] Siehe Michels (1911), Zur Soziologie des Parteiwesens in der Modernen Demokratie.
[25] Siehe hierzu Polleit (2017), Die Blockchain-Disruption: Geld, Bitcoin und digitalisiertes Goldgeld.
[26] Siehe Rothbard (2008), The Mystery of Banking, S. 85–139; auch Polleit, Prollius (2014), Geldreform, S. 79–86.
[27] Siehe hierzu Mises (1927), Liberalismus, S. 95–98.
[28] Siehe Rothbard (2006), For A New Liberty, S. 249–299; Hoppe (2006), On Government and the Private Production of Defense, S. 239–265; zur Privatisierung des Rechts- und Gewaltmonopols siehe Dürr (2006), Entstaatlichung der Rechtsordnung – Ein Modell ohne staatliches Rechtsetzungs- und Gewaltmonopol.
Thorsten Polleit, Jahrgang 1967, ist seit April 2012 Chefvolkswirt der Degussa. Er ist Honorarprofessor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth, Adjunct Scholar am Ludwig von Mises Institute, Auburn, US Alabama, Mitglied im Forschungsnetzwerk „Research On money In The Economy“ (ROME) und Präsident des Ludwig von Mises Institut Deutschland. Er ist Gründungspartner und volkswirtschaftlicher Berater eines Alternative Investment Funds (AIF). Die private Website von Thorsten Polleit ist: www.thorsten-polleit.com. Hier Thorsten Polleit auf Twitter folgen.
*****
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Institut Deutschland wieder.
Foto: Adobe Stock