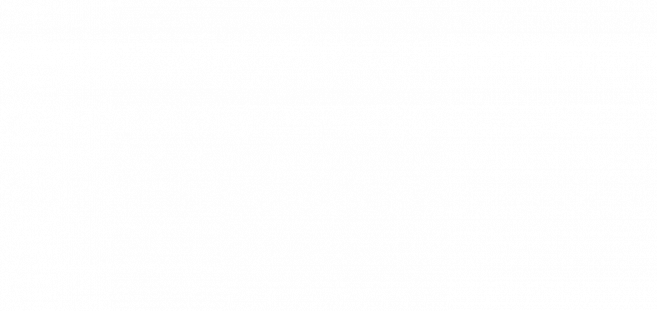Über die Logik des Handelns
21.8.2017 – Antrittsvorlesung, 22. Juni 2017 – Universität Bayreuth – von Thorsten Polleit
*****
[HIER auch als PODCAST zum Anhören verfügbar.]
Spektabilität,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren,
liebe Studentinnen und Studenten,
verehrte Gäste,
in einer Antrittsvorlesung ist es vermutlich ratsam, ein Thema zu behandeln, mit dem man sich als Experte zu erkennen geben kann. Ich habe intensiv und lange nach einem gesucht – doch vergeblich.
Daher habe ich mich entschieden, ein Thema zu wählen, das mich seit geraumer Zeit persönlich ganz besonders interessiert und das ich mit „Über die Logik des Handelns“ überschrieben habe.
Es dreht sich um eine Grundlagenfrage der Wirtschaftswissenschaft – und in Anlehnung an den preußischen Philosophen Immanuel Kant (1724 – 1804) lässt sie sich auch wie folgt formulieren: Was können wir wissen in der Ökonomik?
Genauer: Woher stammt unser Wissen in der Wirtschaftswissenschaft? Rührt es aus Erfahrung? Oder aus Vernunft? Und vor allem: Wie können wir den Wahrheitsgehalt von ökonomischen Theorien überprüfen?
In den kommenden 40 Minuten erwartet Sie eine Reflexion darüber, wie man gut begründet in der Ökonomik vorgehen kann, um Erkenntnisse (also: wahre Aussagen) zu gewinnen:[1] Es geht also um die Frage nach der gut begründeten wissenschaftlichen Methode in der Ökonomik.
Unter der wissenschaftlichen Methode ist das Vorgehen zu verstehen, um Erkenntnis über das Erkenntnisobjekt (in der Ökonomik ist das der handelnde Mensch) zu gewinnen.
Ich denke, das Thema ist zeitgemäß. Denn egal wohin man in diesen Tage blickt: Man gewinnt den Eindruck, dass viele Glaubenssätze auf den Prüfstand kommen.
Im politischen Bereich etwa werden große Paradigmen überdacht. Man denke an das Ringen um die künftige Gestaltung Europas. Das Zentralisierungsmodell, dem Europa seit Jahrzehnten gefolgt ist, hat seine große Anziehungskraft verloren, und das Dezentralisierungsmodell gewinnt Anhänger.
Oder denken Sie an die Veränderungskraft neuer Technologien. Zum Beispiel könnte die „Blockchain“ geradezu revolutionäre Umwälzungen in Wirtschaft und Gesellschaft bringen – vor allem im Geld- und Finanzwesen.
Die aufkommenden Cyberwährungen scheinen den Staaten ihr Währungsmonopol abspenstig zu machen – und sollten sie dabei erfolgreich sein, wird sich auch die Vormachtstellung der Staaten im Wirtschafts- und Gesellschaftsleben fundamental verändern.
All diese möglichen Disruptionen stehen letztlich für das Entstehen und Verbreiten neuer, mitunter auch wiederentdeckter Ideen und Erkenntnisse, die den bestehenden Wissenskanon herausfordern beziehungsweise verändern.
Es ist nicht allzu gewagt zu vermuten, dass auch die Ökonomik von dieser Entwicklung nicht unberührt bleiben wird.
Die Volkswirtschaftslehre steht spätestens seit nach der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise in der Kritik: Sie habe, so ist zu hören, die Krise nicht kommen sehen; und die Frage, wie künftige Krisen zu verhindern seien, habe sie immer noch nicht zufriedenstellend beantwortet.
Das ist eine verständliche Kritik. Bringen sich doch Ökonomen (als Politikberater) öffentlich zu Gehör und erwecken vielfach die Hoffnung, sie hätten richtige Rezepte zur Lösung drängender Probleme.
Zum Beispiel hat man insbesondere auch aufgrund der Empfehlungen vieler Ökonomen die Regulierung im Banken- und Finanzwesen verschärft, um dadurch eine Wiederholung der Krise von 2008/2009 zu verhindern.
Zudem sprechen sich Ökonomen dafür aus, die Zentralbanken sollten die Zinsen auf oder sogar unter die Nulllinie befördern – vielfach mit dem Zusatz versehen, der neue „neutrale Zins“ sei nunmehr negativ; und dass nur ein Negativzins für Vollbeschäftigung sorgen könne.
Um die Politik des Negativzinses durchsetzen zu können, empfehlen einige Ökonomen sogar die Abschaffung des Bargeldes.
Doch können all diese Maßnahmen die erhofften Wirkungen erzielen – also Krisen vermeiden und Wachstum und Beschäftigung schaffen?
Wie ist es um die „Praxistauglichkeit“ ökonomischer Erkenntnisse beziehungsweise um die theoretische Begründung ihrer Gewinnung und Überprüfung bestellt?
Ich habe in vielen Diskussionen die Erfahrung gemacht, dass sich derartige Fragestellungen zu einem produktiven Ergebnis führen lassen, wenn man sich zunächst – quasi als propädeutischer Schritt – über die erkenntnistheoretischen Grundlagen der Ökonomik Klarheit verschafft. Das möchte ich im Folgenden tun.
Suche nach Erkenntnis – der Status Quo
Führen wir uns dazu zunächst vor Augen, wie heutzutage vorgegangen wird, um ökonomische Erkenntnisse zu gewinnen.
In der Ökonomik, in den Sozialwissenschaften, bedient man sich einer wissenschaftlichen Methode, die der Naturwissenschaft entliehen ist.
Sie ist maßgeblich von den Ideen des Positivismus-Empirismus-Falsifikationismus geprägt. Die Begriffe will ich kurz erklären.
Der Positivismus ist eine Wissenschaftsdoktrin. Ihr zufolge soll sich die Wissenschaft am „positiv Gegebenen“ orientieren, an dem, was sinnlich erfassbar und messbar ist, nach dem Motto: „Wissenschaft ist Messen.“
Der Empirismus behauptet zweierlei. (1) Alles Wissen über die Realität stammt aus Sinneseindrücken (aus Beobachtungen). (2) Beobachtungen sind auch der Maßstab, an dem der Wahrheitsgehalt von Theorien zu überprüfen ist.
Der Falsifikationismus geht auf den Kritischen Rationalismus von Karl. R. Popper (1902 – 1994) zurück.[2] Er ist wie der Empirismus der Meinung, dass das Wissen aus der Erfahrung stammt, und dass sein Wahrheitsgehalt der Überprüfung durch Erfahrung bedürfe.
Allerdings lehnt der Falsifikationismus das Verifikationsprinzip, wie es der (klassische) Empirismus verwendet, ab: den Anspruch also, dass durch Erfahrung der Wahrheitsgehalt einer Hypothese abschließend festgestellt werden kann.
Popper argumentiert, dass es bestenfalls möglich sei, eine Hypothese nicht zu verwerfen (sie nicht zu falsifizieren), dass es aber niemals möglich sei, sie ein für alle Mal als wahr zu bestätigen (sie zu verifizieren).
Schließlich kann man nicht sicher sein, dass eine Hypothese, die heute als bestätigt gilt, nicht doch künftig, wenn neue Beobachtungen gemacht werden, abgelehnt werden muss.
Weil absolute Wahrheit nicht gewonnen werden kann, so Popper, sollen im Zuge von „Versuch und Irrtum“ falsche Theorien aussortiert und durch bessere ersetzt werden. (Man kann diese Regel als Verbesserungsprinzip des Wissens, als Meliorismus, bezeichnen.)
Der Falsifikationismus leitet, folgt man Popper, den Wissenschaftsprozess auf vernünftigen Bahnen und bringt Wissensfortschritt. Man kommt der Wahrheit näher, kommt ihr immer näher, wenngleich auch abschließend wahre Erkenntnis nicht erlangt werden kann.
Kritik
Wie schneiden Positivismus, Empirismus und Falsifikationismus erkenntnistheoretisch ab, wenn man sie kritisch Revue passieren lässt?[3] (Kritik ist hier zu verstehen im Kantschen Sinne: als das Untersuchen von Aussagen anhand von Vernunftgründen, nicht ihre bloße Bemängelung.)
Eine der Kernaussagen des Positivismus lautet: Es gibt nur zwei Arten von wissenschaftlichen Aussagen. Das sind zum einen die analytischen Aussagen. Sie sind nicht-hypothetisch wahr, besitzen jedoch angeblich keinerlei empirischen Gehalt.
Zum anderen gibt es empirische Aussagen. Sie sind nur hypothetisch wahr, sie stellen kein gesichertes Realitätswissen dar. Wie aber begründet der Positivist diese (Kern-)Aussagen?
Wenn er sagt „Analytische Aussagen sind nicht hypothetisch wahr“, und er diese Aussage als analytische Aussage deklariert, handelt es sich um nichts als Wortgeplänkel, das nichts über die Realität aussagt.
Deklariert er sie hingegen als hypothetisch wahr, bleibt ungeklärt, ob die Aussage wahr oder falsch ist: Der Wahrheitsgehalt der Aussage muss sich an der Erfahrung bewähren – doch man kann aus Erfahrung keine Allgemeingültigkeit ableiten (das wird nachfolgend noch deutlich).
Man erkennt: Der Positivismus liefert für seine Postulate keine erkenntnistheoretisch akzeptable Begründung. Er ermuntert vielmehr dazu, Wasser auf die Mühlen eines radikalen Wissens-Skeptizismus zu gießen.
Rufen wir uns nun die Kernaussage des Empirismus vor Augen: Alle Erkenntnis entstammt aus der Erfahrung. Wie begründet der Empirismus diese Aussage, die einen Wahrheitsanspruch erhebt?
Sie lässt sich nicht durch Erfahrungen begründen, wie das Induktionsproblem zeigt: Aus einzelnen Beobachtungen oder Erfahrungswerten lässt sich auf keine Allgemeingültigkeit schließen: Weil man bislang nur weiße Schwäne beobachtet hat, kann man daraus nicht schlussfolgern, dass alle Schwäne weiß sind.
Der Empirismus behauptet folglich etwas (und zwar: „Alle Erkenntnis stammt aus der Erfahrung“), was er aus sich heraus nicht nur nicht begründen kann. Er verneint das, was er behauptet – und ist damit widersprüchlich!
Ein weiteres Problem des Empirismus ist das Folgende: Man stellt Hypothesen auf („Wenn-dann-Aussagen“) und überprüft ihren Wahrheitsgehalt anhand von Beobachtungen.
Nehmen wir an, die untersuchte Hypothese wird bestätigt. Ist sie dann verifiziert? Die Antwort lautet nein. Denn es kann ja sein, dass künftige Beobachtungen sie widerlegen.
Und was ist, wenn die Hypothese nicht bestätigt wird? Ist sie dann widerlegt? Nein, denn es kann ja sein, dass die Hypothese durch künftige Beobachtungen gestützt wird.
Man erkennt: Mit dem Empirismus lassen sich keine abschließenden Wahrheitsaussagen auffinden. Erkenntnistheoretisch ist das unbefriedigend, und es stellt sich die Frage nach einer Alternative.
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass zwischen Wahrheit und Wahrscheinlichkeit streng zu unterscheiden ist.[4] Eine immer größere Wahrscheinlichkeit bedeutet nicht, dass man der Wahrheit immer näher kommt.
Bei einer unbeschränkten All-Aussage wie „Alle Schwäne sind weiß“ braucht es nur eine Gegeninstanz („Dieser Schwan ist schwarz“), die die All-Aussage als falsch erweist – obwohl für die All-Aussage immer noch eine Wahrscheinlichkeit (gemessen als das Verhältnis der positiven zu den möglichen Fällen) von 1 als Grenzwert erhalten bleibt.
Nun zur Kritik am Falsifikationismus – der als Weiterentwicklung des Empirismus angesehen wird.[5] Er behauptet (ebenfalls mit einem absoluten Wahrheitsanspruch), dass alles Wissen, das wir durch Aufstellen und Überprüfen von Hypothesen erzielen können, nur hypothetisch wahr ist; dass eine Hypothese nicht verifiziert, sondern dass sie bestenfalls (bis auf weiteres) nicht falsifiziert (also nicht verworfen) werden kann.
Mit dem Falsifikationismus löst Popper zwar das Indukionsproblem, das den klassischen Empirismus plagt. Gleichwohl bleiben Fragen.
Was zum Beispiel ist die Begründung für die Behauptung: „Ein empirisch wissenschaftliches System muss an der Erfahrung scheitern können“, die im Falsifikationismus Gültigkeit beansprucht?
Wenn dieser Aussage ihr Wahrheitsanspruch zugestanden wird (wenn sie also nicht-hypothetisch wahr sein soll), dann widerspricht sie der zentralen Aussage des Kritischen Rationalismus, nämlich dass es kein sicheres Wissen gibt.
Wenn die Aussage hingegen als hypothetisch wahr deklariert wird, dann wird es nihilistisch: Die Wissenschaft hat dann kein sicheres Fundament mehr.
Ein weiteres Problem ist, dass Beobachtungen, die zur Überprüfung von Hypothesen verwendet werden, theorieabhängig sind. Es gibt keine „reine“, keine „theorielose“ Erfahrung, sondern Erfahrung wird stets auf der Grundlage einer Theorie gemacht. Erfahrung ist immer theoretisch präformiert.
Wenn es aber, wie es der Falsifikationismus behauptet, kein sicheres Wissen gibt, so kann es auch kein sicheres Wissen über die Richtigkeit von Beobachtungen und den ihnen zugrundeliegenden Theorien geben.
Die richtigen Theorien können sich schließlich im Zeitablauf ändern, und wenn das der Fall ist, werden sich auch die Beobachtungen ändern – denn Beobachtungen hängen ja von der jeweils als richtig erachteten und angewandten Theorie ab.
Man kann also nicht sicher sein, dass die Beobachtungen, die zur Überprüfung von Theorien Verwendung finden, überhaupt die richtigen sind. Beobachtungen, weil sie theorieabhängig sind, sind ebenfalls fehlbar.
Vor dem Hintergrund des Gesagten wird deutlich, dass eine wissenschaftliche Methode, die auf dem Kritischen Rationalismus ruht, nicht als unanfechtbar gelten kann – eine wichtige Einsicht, wenn es das Ziel ist, den Wissenschaftsprozess unter erkenntnistheoretischen Aspekten rational zu steuern.
Doch bevor wir die konstruktive Frage nach Verbesserung beziehungsweise nach einer Alternative stellen, möchte ich der Frage nachgehen, ob der Positivismus-Empirismus-Falsifikationismus, wie er in den Naturwis-senschaften angewandt wird, überhaupt auf die Sozialwissenschaft, auf die Ökonomik, übertragbar ist.
A priori der Lernfähigkeit
Das ist eine wichtige Frage: Denn Positivismus-Empirismus-Falsifikationismus sind die weithin akzeptierten Grundpfeiler der wissenschaftlichen Methode, die in der modernen Volkswirtschaftslehre breite Akzeptanz gefunden haben.
Dafür dürfte vor allem auch maßgeblich der Aufsatz des US-amerikanischen Ökonomen Milton Friedman „The Methodology of Positive Economics“ (1953) beigetragen haben.[6]
Ich habe bereits Argumente vorgebracht, die zu einer skeptischen Haltung gegenüber Positivismus-Empirismus-Falsifikationismus ermuntern sollten (die aber, so will ich betonen, in der Naturwissenschaft weniger folgenreich sind als in der Sozial- beziehungsweise Wirtschaftswissenschaft).
Doch es gibt ein weiteres Argument, warum man die Anwendung des Positivismus-Empirismus-Falsifikationismus in der Ökonomik kritisch sehen muss.
In der Naturwissenschaft lassen sich reproduzierbare Experimente durchführen, also beliebig viele Versuche unter gleichen Bedingungen, die – wie Popper sie bezeichnet – Protokollsätze liefern.
Beispiel: Chemikalie A wird mit Chemikalie B vermischt, und das führt zu einer bestimmten Reaktion. Dieser Versuch lässt sich prinzipiell heute, morgen, übermorgen hier und woanders auf der Welt beliebig häufig und unter gleichen Bedingungen durchführen.
Das aber ist im Bereich des menschlichen Handels in dieser Weise nicht möglich. Warum? Der Mensch hat (anders als Moleküle, Steine oder ein Regenwurm) nicht nur Ziele und Präferenzen, die sich fortlaufend verändern, sondern er kann auch lernen.
Die Annahme der Lernfähigkeit hat weitreichende Bedeutung. In der Ökonomik ist sie seit der „Lucas-Kritik“ keine Unbekannte. Benannt nach Robert. E. Lucas (*1937), besagt diese Kritik, dass es keine Verhaltens-konstanten gibt, die sich wirtschaftspolitisch ausbeuten lassen.[7]
Man denke beispielsweise an den Fall, in dem die Zentralbank die Geldmenge überraschend erhöht, um durch Inflation die Wirtschaft zu beleben. In der ersten Runde der Politik der Überraschungsinflation mag es der Zentralbank tatsächlich gelingen, die Wirtschaft zu beleben.
Aus dem Inflationsbetrug lernen jedoch die Marktakteure. Sie passen ihre Inflationserwartungen nach oben an, und in der zweiten Runde verpufft die Wirkung der Überraschungsinflation. Die Reaktion der Marktakteure auf eine erneute Geldmengenausweitung hat sich also verändert.
Doch wie lässt sich die Lernfähigkeit (also dass man lernen kann) begründen? Ist sie empirisch zu erklären?
Sollte das der Fall sein, könnte uns das – aus den bereits vorgebrachten Überlegungen – nicht überzeugen: Denn die Erfahrung kann nur zeigen, dass etwas so oder so gewesen ist, nicht aber, dass sich dahinter eine Notwendigkeit verborgen hat.
Doch wir müssen nicht auf Erfahrung zurückgreifen. Die Annahme von Lernfähigkeit lässt sich nämlich logisch begründen. Dazu eine Erklärung (in Form eines argumentum a contrario).[8]
Stellen wir uns zunächst einmal die Frage: Was würde es bedeuten, wenn wir uns (als handelnde Menschen) als nicht lernfähig denken (konzeptualisieren)?
Antwort: Wir wüssten dann heute schon alles, was wir künftig jemals wissen werden – und auch wie wir mit dem heute schon gewussten Wissen künftig handeln werden. Da wir nicht lernen könnten, wäre die Zukunft aus heutiger Sicht sicher.
Das aber entspricht nicht der Lebenserfahrung. Der Gedanke, seine Zukunft zu kennen, erscheint vermutlich den meisten von uns absurd.
Die Begründung, warum der handelnde Mensch als lernend gedacht werden muss, lässt sich im a priori der Argumentation – wie es die Philosophen Karl-Otto Apel (1922 – 2017) und Jürgen Habermas (*1929) in ihrer Diskursethik verwenden – aufspüren.[9]
A priori steht für Aussagen, die anhand von Wahrnehmungen weder als wahr noch als falsch erwiesen werden können. A priori Aussagen sind selbstevident, sind erfahrungsunabhängig und allgemeingültig.
Ein Beispiel ist der Satz des Widerspruchs: Zwei einander widersprechende Aussagen können nicht zugleich zutreffen. Es ist nicht möglich, dass die Erde gleichzeitig eine Kugel ist, und das es nicht der Fall ist, dass die Erde eine Kugel ist.[10]
Nun kommt die entscheidende Überlegung: Die Aussage „Der Mensch kann lernen“ lässt sich argumentativ nicht widerspruchsfrei verneinen. Denn:
(a) Wer sagt „Der Mensch kann nicht lernen“, setzt bereits voraus (bei sich selbst oder seinem Gesprächspartner), dass man das Konzept „Lernen“ versteht – dass man also gelernt hat zu lernen. Das aber ist ein performativer Widerspruch. (Man verneint dadurch den Inhalt seines Arguments.)
(b) Wer sagt „Der Mensch kann lernen, dass er nicht lernen kann“, begeht einen offenen Widerspruch.
Der Satz „Der Mensch kann lernen“ gilt also a priori. Er lässt sich nicht bestreiten, ohne seine Geltung bereits vorausgesetzt zu haben.
Wenn folglich der Mensch als handelnder Akteur als lernfähig konzeptualisiert werden muss, so folgt daraus zweierlei:
(1) Man kann nicht schon heute alle künftigen Wissenszustände kennen und damit auch nicht – darauf kommt es hier an – alle aus diesem Wissen sich ergebenden künftigen Handlungen.
(2) Im Bereich des menschlichen Handelns lassen sich daher aus logischen Gründen keine Ursachen aufspüren, die eine konstante (zeitinvariante) Wirksamkeit auf das menschliche Handeln ausüben – denn sonst würden wir (fehlerhafterweise) Nichtlernfähigkeit unterstellen.
Mit anderen Worten: Das menschliche Handeln lässt sich nicht wie die Erkenntnisobjekte in der Naturwissenschaft erklären oder anhand von „externen Faktoren“ prognostizieren.[11]
Daraus erwächst die Forderung nach einem methodologischen Dualismus.[12] Gemeint ist damit, dass die wissenschaftliche Methode in der Nationalökonomie eine andere sein muss als die, die in den Naturwissenschaften angewandt wird. Doch wie könnte sie aussehen?
Immanuel Kants Beitrag zur Erkenntnistheorie
Um diese Frage zu beantworten, lassen Sie uns einen kurzen Blick werfen auf einen grundlegenden, revolutionären Beitrag zur Erkenntnistheorie, den Immanuel Kant vorgelegt hat. Dazu ein paar kurze begleitende Bemerkungen.[13]
Kants großes Projekt war es herauszufinden, ob die Metaphysik als eine respektable Wissenschaft anzusehen sei – ob sie mithalten kann mit Wissenschaften wie Physik und Mathematik.
Die Metaphysik ist die Wissenschaft, die sich mit Fragestellungen beschäftigt, die nicht sinnlich erfahrbar sind. Hierzu zählen zum Beispiel: Ist Gott die letzte Ursache des Universums? Oder: Verfügt der Mensch über einen freien Willen?
Metaphysische Fragestellungen lassen sich nicht durch Sinneseindrücke, also Beobachtungen oder Experimente, bearbeiten beziehungsweise beantworten.
Kant nennt die Aussagen (er spricht von Urteilen), die sich unabhängig von jeder Wahrnehmung als wahr oder falsch einsehen lassen, a priori. (Wie bereits gesagt: A priori meint selbst-evidente, erfahrungsunabhängige, notwendige und allgemeingültige Erkenntnis.)
Dem gegenüber nennt Kant Aussagen, die anhand von Wahrnehmungen bewahrheitet oder widerlegt werden können, a posteriori.
Entsprechend sind für Kant metaphysische Aussagen a priori. Damit sind jedoch metaphysische Aussagen aber noch nicht hinreichend bestimmt.
Ein Satz wie „Alle Körper sind ausgedehnt“ ist a priori wahr, weil er definitorisch (oder begrifflich) wahr ist: Was Körper ausmacht, ist, dass sie ausgedehnt sind.[14]
Die Aussagen, die wahr oder falsch sind allein aufgrund der in ihnen vorkommenden Begriffe, nennt Kant analytisch.
Das Gegenstück dazu sind synthetische Aussagen: Das sind Aussagen, die nicht allein aufgrund von Bedeutungsfestlegung der in ihnen vorkommenden Begriffe als wahr oder falsch einsehbar sind.
Zum Beispiel ist die Aussage „Wasser gefriert bei null Grad Celsius“ eine synthetische (eine die Erkenntnis erweiternde) Aussage: Dass Wasser bei null Grad Celsius gefriert, geht nicht aus dem Begriff Wasser hervor, sie fügt ihm Erkenntnis hinzu.
Nach Kant ist eine metaphysische Aussagen nicht nur a priori, sondern auch synthetisch: Sie muss erfahrungsunabhängig als wahr oder falsch einsehbar sein, und sie muss gleichzeitig erkenntniserweiternd sein.
Wenn also Kant fragt, ob die Metaphysik eine Wissenschaft sein kann, dann stellt er damit die Frage: Sind synthetische Urteile a priori möglich?
Hinter dieser Frage verbirgt sich Kants „Kopernikanische Wende in der Denkungsart“, und sie lautet:
Wir Menschen erfahren die Gegenstände der Welt nicht so, wie sie objektiv sind, sondern die Gegenstände unserer Erfahrung richten sich nach unserem Erkenntnisvermögen. Synthetische Urteile a priori sind für Kant dabei die notwendigen Bedingungen für die Möglichkeit von Erfahrung.
Unser Realitätswissen ist nach Kant Erfahrung, die von unserem Erkenntnisvermögen geprägt ist. Er drückt das wie folgt aus: „Wenn aber … unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anhebt, so entspringt sie darum doch nicht eben alle aus der Erfahrung.“[15]
Doch welchen Bezug, so werden Sie jetzt fragen, haben Kants erkenntnistheoretische Vorgaben mit meinem Referat, das den Titel trägt „Über die Logik des Handelns“?
Die Logik des Handelns
Es ist bereits mehrfach der Satz „Der Mensch handelt“ angeklungen. Er scheint auf den ersten Blick trivial zu sein. Auf den zweiten Blick jedoch ist er von einer besonderen erkenntnistheoretischen Tragweite.
Der Satz „Der Mensch handelt“ erweist sich bei genauerer Reflexion als a priori: Man kann ihm nicht widersprechen, ohne in einen logischen Widerspruch zu verfallen.
Wer sagt „Der Mensch handelt nicht“, der handelt und widerspricht damit dem Gesagten (er begeht einen performativen Widerspruch).
„Der Mensch handelt“ ist ein apodiktisch wahrer Satz. Es ist keiner Letztbegründung mehr zugänglich – verstanden als das Zurückgehen auf Voraussetzungen, die sich nicht ohne Widerspruch bestreiten lassen.
Der Satz „Der Mensch handelt“ lässt sich daher als wissenschaftlicher Ausgangspunkt wählen. Aus ihm lassen sich weitere wahre Aussagen logisch-deduktiv entfalten – als Kategorien, als Grundbegriffe des Denkens –, die gerade auch für die Ökonomik aufschlussreich sein dürften. Dazu einige Beispiele:
- Menschliches Handeln ist stets individuelles Handeln. Es gibt kein Gruppen- oder Kollektivhandeln. Stets lässt sich das Handeln auf den Einzelnen zurückführen. Der heute akzeptierte methodologische Individualismus hat also eine apriorische Basis.
- Handeln ist stets zielbezogen. Es ist immer darauf gerichtet, einen gewünschten Zustand durch einen anderen, als besser empfundenen Zustand zu ersetzen. Dieser Satz lässt sich nicht widerlegen. Wer sagt: „Handeln ist nicht zielbezogen“, der handelt zielbezogen und widerspricht dem, was er sagt.
- Menschliches Handeln erfordert den Einsatz von Mitteln (Gütern). Beispielsweise komme ich nicht umhin, meine Stimmbänder einzusetzen, um meine Gedanken durch Sprechen hörbar zu machen. Ein Handeln ohne Mitteleinsatz gibt es nicht.
- Mittel (oder Güter) sind knapp. Wären sie nicht knapp, dann müsste man sie nicht bewirtschaften, dann wären sie keine Güter. Knappheit ist also im Satz „Der Mensch handelt“ schon mitgedacht.
- Zeit ist ein Mittel, um Ziele zu erreichen. Zeitloses Handeln lässt sich nicht vorstellen. Wäre Handeln zeitlos, wären alle Ziele sofort und unmittelbar erreicht – und man könnte nicht mehr handeln – aber das ist denkunmöglich.
- Ursache-Wirkung (Kausalität) ist ebenfalls im Satz „Der Mensch handelt“ impliziert. Zielbezogenes Handeln bedeutet, dass der Handelnde durch sein Handeln (Ursache) seinen Zielen (Wirkung) näherkommen kann.
- Aufgrund der Knappheit von Mitteln (Gütern) werden Gegenwartsgüter höher wertgeschätzt als Zukunftsgüter. Darin zeigt sich die Zeitpräferenz. Sie ist immer und überall positiv, kann niemals verschwinden, kann niemals negativ werden.
- Der Zins (genauer: der Urzins oder „neutrale Zins“) ist Ausdruck der Zeitpräferenz. Er steht für den Wertabschlag, den Zukunftsgüter gegenüber Gegenwartsgütern erleiden, und er lässt sich aus dem menschlichen Handeln nicht wegdenken.
- Handeln findet unter Unsicherheit statt, und zwar in dem Sinne, dass wir nicht sagen können, wie wir künftig handeln werden – und das folgt wiederum aus der unbestreitbaren Erkenntnis, dass wir lernen können.
- Auch das Privateigentum (verstanden als das Eigentum am eigenen Körper und den rechtmäßig erworbenen Gütern) ist im Satz „Der Mensch handelt“ mitgedacht; es ist ebenfalls ein a priori.
Es war der österreichische Ökonom Ludwig von Mises (1881 – 1973), der die wissenschaftliche Methode der Wirtschaftswissenschaft auf der Logik des Handelns aufbaut (sie Praxeologie nennt) und die Wirtschaftswissenschaft damit widerspruchsfrei als aprioristische Handlungswissenschaft begründet.
An dieser Stelle verweise ich nur kurz darauf, dass sich jüngst auch Philosophen intensiv mit dem erkenntnis-theoretischen Status der Logik des menschlichen Handelns befassen.[16]
Alle bisher verfügbaren Deutungen weisen eine Gemeinsamkeit auf: Sie fassen den Satz „Der Mensch handelt“ als unwiderlegbar, als nicht hintergehbar auf – und das gilt damit auch für die aus ihm logisch abgeleiteten Sätze.
Richtige Theorien, falsche Theorien
Was folgt daraus für die Ökonomik? Mit den Kategorien des menschlichen Handelns verfügen wir (mit Kant gesprochen) über Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung.
Sie konstituieren unsere Erfahrung, und die Gegenstände menschlicher Erfahrung müssen den Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung genügen.
Damit eröffnet sich ein Weg zu beurteilen, ob eine ökonomische Theorie Richtigkeit beanspruchen kann oder nicht: Ökonomische Theorien, die nicht im Einklang mit den Kategorien des menschlichen Handelns stehen, müssen legitime Zweifel an ihrer Vernünftigkeit wecken.
Dazu zwei Illustrationen. (1) Tauschakte in einem freien Markt sind für alle Beteiligten, die freiwillig daran teilnehmen, vorteilhaft. Sie kommen zustande aufgrund diametral entgegengesetzter Präferenzstrukturen: Ein jeder gibt das hin, was er vergleichsweise weniger wert schätzt, und er erhält dafür etwas, was er vergleichsweise höher wert schätzt. Freiwilliges Tauschen ist daher beidseitig nutzenmehrend.
Es wäre ein Widerspruch zur Logik des menschlichen Handelns – und damit unlogisch – zu behaupten, der beschriebene Tauschakt würde die beiden Tauschpartner nicht besserstellen.
(2) Die Markteffizienzhypothese ist Kernstück der modernen Finanzmarkttheorie. Sie besagt, dass die Börsenkurse informationseffizient sind:
Die Kurse enthalten zu jedem Zeitpunkt alle relevanten Informationen; und neue Informationen treffen zufällig ein, sind daher nicht prognostizierbar.[17]
Was aber ist von dieser Theorie zu halten – die zurückgeht auf den französischen Mathematikers Louis Bachelier (1870 – 1946) und die später von Paul A. Samuelson (1915 – 2009) und seinem Schüler Eugene Fama (*1939) popularisiert wurde?[18]
Für denjenigen, der eine Aktie für, sagen wir, 100 Euro verkauft, sind die 100 Euro wertvoller als die Aktie. Für denjenigen, der die Aktie kauft, gilt das Umgekehrte: Für ihn ist die Aktie wertvoller als die 100 Euro.
Das heißt nichts anderes, als dass der Markt sowohl aus Sicht des Käufers als auch des Verkäufers nicht informationseffizient in dem Sinne ist, dass alle relevanten Informationen im Kurs enthalten sind.
Das Stattfinden der Transaktion ist vielmehr ein untrügliches Indiz dafür, dass Käufer und Verkäufer der Meinung sind, dass die Kurse nicht informationseffizient sind. Ansonsten bestünde für sie kein Anlass, die Aktie zu kaufen beziehungsweise zu verkaufen.
Das Gegenteil zu behaupten (hier: der Markt sei informationseffizient), mutet absurd an. Zu Recht, denn es widerspricht der Logik des Handelns.
Beide Aussagen (dass Tauschen im freien Markt für alle Beteiligten vorteilhaft ist, und dass Finanzmärkte nicht informationseffizient sein können) folgen aus der Logik des Handelns, sind logisch-deduktiv abgleitet.
Mit etwas mehr Worten und Zeit ließen sich auch aufwendigere ökonomische Aussagen logisch-deduktiv aus der Logik des menschlichen Handelns gewinnen: Dass zum Beispiel der Sozialismus als Wirtschaftssystem nicht durchführbar ist; oder dass die Vermehrung der Geldmenge durch Kreditvergabe, die nicht nur echte Ersparnis gedeckt ist, notwendigerweise zu wirtschaftlichen Störungen führt; oder dass ein Vermehren der Geldmenge die Volkswirtschaft nicht reicher macht; oder dass der Urzins aus handlungslogischen Gründen nicht null, geschweige denn negativ sein kann.
All diese Aussagen können wir mit Gewissheit machen: Sie lassen sich nicht widerspruchsfrei verneinen.
Apriorische Handlungswissenschaft
Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren,
meine bisherigen Ausführungen sollten verdeutlichen, dass es gute Gründe gibt, die Ökonomik nicht als Erfahrungswissenschaft zu konzeptualisieren, wie es dem heutigen Konsens entspricht. Das ist das destruktive Ergebnis meiner Ausführungen.
Der konstruktive Teil bestand darin, Argumente herauszuarbeiten und anzubieten, mit denen ein apriorischer Charakter der Ökonomik rationalisiert und die Ökonomik widerspruchsfrei als aprioristische Handlungswissenschaft begriffen werden kann.
Ich habe mich bemüht zu zeigen, dass die Logik des menschlichen Handelns und die aus ihr logisch-deduktiv ableitbaren Erkenntnisse konstruktive Beiträge für das volkswirtschaftliche Forschungsprogramm bereithalten.
Das ist sicherlich ein diametraler Kontrapunkt zum heute gängigen Vorgehen in der Wirtschaftswissenschaft. Aber er ermutigt hoffentlich zu einem produktiven Wettbewerb der Argumente zur Begründung der Erkenntnisgrundlagen der Ökonomik.
In einem solchen Wettbewerb um die gut begründete wissenschaftliche Methode in der Volkswirtschaftslehre liegt meiner Ansicht nach auch der Schlüssel für die Lösung vieler drängender wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Fragen der heutigen Zeit.
In der Hoffnung, dass meine Ausführungen an- und auch etwas aufregend für Sie waren, darf ich abschließend meinen Dank aussprechen: an Sie alle, sehr geehrte Damen und Herren, dass Sie heute gekommen sind und mir Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben;
an die Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Bayreuth für die freundliche Aufnahme und die Möglichkeit, einen Beitrag zur volkswirtschaftlichen Lehre leisten zu dürfen;
und vor allem auch an Herrn Professor Martin Leschke, dem mein ausdrücklicher Dank gilt. Er ist einer der wohl wichtigsten Mentoren meines wissenschaftlichen Denkens.
Vielen Dank!
[1] Die Methodologie als Teildisziplin der Wissenschaftstheorie (als Metawissenschaft) setzt sich mit der Frage auseinander, welche wissenschaftliche Methode angemessen beziehungsweise richtig ist.
[2] Siehe hierzu Popper, K. R. (1973 [1934]), Logik der Forschung, 5. Aufl., Tübingen.
[3] Siehe hierzu Hoppe, H.-H. (2006), On Praxeology and the Praxeological Foundation of Epistemology, S. 265 – 294 sowie Austrian Rationalism in the Age of the Decline of Positivism, S. 347 – 380, beide in: The Economics and Ethics of Private Property. Studies in Political Economy and Philosophy, 2. Aufl., Ludwig von Mises Institute, Auburn, US Alabama.
[4] Siehe hierzu Poser (2001), Wissenschaftstheorie. Eine philosophische Einführung, Philipp Reclam jun., Stuttgart, S. 104 – 107.
[5] Für die Anwendung in der Wirtschaftswissenschaft siehe Hartwig, K.-H. (1977), Kritisch-rationale Methodologie und ökonomische Forschungspraxis. Zum Gesetzesbegriff in der Nationalökonomie, Peter Lang GmbH, Frankfurt a. M., Bern, Las Vegas, S. 66 – 100.
[6] Siehe Friedman, M. (1953), The Methodology of Positive Economics, in: Essays in Positive Economics, University of Chicago Press.
[7] Siehe Lucas, R. E. (1983), Econometric Policy Evaluation: A Critique, in: Theory, Policy, Institutions: Papers from the Carnegie Rochester Conference Series on Public Policy, K. Brunner, A. Meltzer (Hrsg.), North-Holland, Elsevier Science Publishers B. V., S. 257–84.
[8] Hierzu und im Folgenden siehe hierzu Hoppe (1983), Kritik der kausalwissenschaftlichen Sozialforschung. Untersuchungen zur Grundlegung von Soziologie und Ökonomie, Studien zur Sozialwissenschaft, Westdeutscher Verlag GmbH, Opladen, insb. S. 11 – 15, S. 25 – 29 und S. 44 – 49.
[9] Siehe Apel, K. O. (1973), Transformation der Philosophie, Band 2, Das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft, Suhrkamp, Frankfurt a. M.; auch Habermas, J. (1973), Jürgen Habermas, Legitimationsprobleme in Spätkapitalismus Suhrkamp, Frankfurt a. M., Fußnote 160.
[10] Übrigens: Ein a priori, ein Satz von Euklid, findet sich im Kinofilm „Lincoln“, in dem Daniel Day-Lewis den 16. US-Präsident Abraham Lincoln (1809 – 1865) spielt. Er lautet: „Things which are equal to the same thing are equal to each other.“ Eine selbstevidente Aussage, von Hollywood wirkungsvoll inszeniert!
[11] Siehe Tetens, H. (2015), Gott denken. Ein Versuch über rationale Theologie, 2. Aufl., Philipp Reclam jun., Stuttgart, S. 23 – 27. Er kritisiert den Naturalismus mit seinem vergeblichen Bestreben, von physikalischen auf mentale Sachverhalte zu schließen. Eine Einsicht, auf die Ludwig von Mises (1881 – 1973) bereits in Human Action. A Treatise On Economics (1998) sowie insbesondere auch in Theory and History (1957) hingewiesen hat.
[12]Siehe hierzu Mises, L. v. (1957), Theory and History, Ludwig von Mises Institute, Auburn, US Alabama, S. 1 – 2; derselbe (1998), Human Action. A Treatise On Economics, Scholar’s Edition, Ludwig von Mises Institute, S. 17 – 18; derselbe (1962), The Ultimate Foundation of Economic Science. An Essay On Method, D. Van Nostrand Company, Inc., Princeton, New Jersey, S. 38 – 41.
[13] Siehe hierzu die Ausführungen von Tetens, H. (2006), Kants „Kritik der reinen Vernunft“. Ein systematischer Kommentar, Philipp Reclam jun., Stuttgart; auch Höffe, O. (2004), Immanuel Kant, 7. Aufl., Verlag C. H. Beck, München; siehe auch die Beiträge in Dudley, W., Engelhard, K. (Hrsg.) (2011), Immanuel Kant. Key Concepts, Acumen, Durham.
[14]Das Prädikat der Aussage (ausgedehnt) gibt etwas wider, was im Sub-jekt (Körper) bereits mitgedacht ist.
[15]Kant, I. (1968), Kritik der reinen Vernunft, Philipp Reclam jun., Stuttgart, S. 50 [B 1].
[16] Siehe hierzu Puster, R. W. (2014), Dualismen und ihre Hintergründe, Dualismen und ihre Hintergründe, Vorwort zu Mises, L. v. (2014), Theorie und Geschichte. Eine Interpretation sozialer und wirtschaftlicher Entwick-lung, H. Akston Verlags GmbH, München, S. 7 – 50.
[17] Daraus wird beispielsweise geschlussfolgert, dass kein Investor besser abschneiden kann als der Gesamtmarkt (und deshalb sein Geld am besten in den Marktindex investieren sollte).
[18] Siehe hierzu Polleit, T. (2017), Kritik der modernen Finanzmarkttheorie, unveröffentlichtes Manuskript.
—————————————————————————————————————————————————————————-
Thorsten Polleit, 49, ist seit April 2012 Chefvolkswirt der Degussa Goldhandel GmbH. Er ist Honorarprofessor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth, Adjunct Scholar am Ludwig von Mises Institute, Auburn, US Alabama, Mitglied im Forschungsnetzwerk „Research On money In The Economy“ (ROME) und Präsident des Ludwig von Mises Institut Deutschland. Er ist Gründungspartner und volkswirtschaftlicher Berater der Polleit & Riechert Investment Management LLP. Die private Website von Thorsten Polleit ist: www.thorsten-polleit.com. Hier Thorsten Polleit auf Twitter folgen.
*****
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Institut Deutschland wieder.