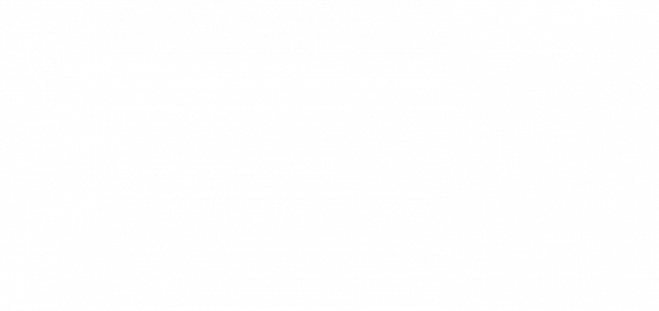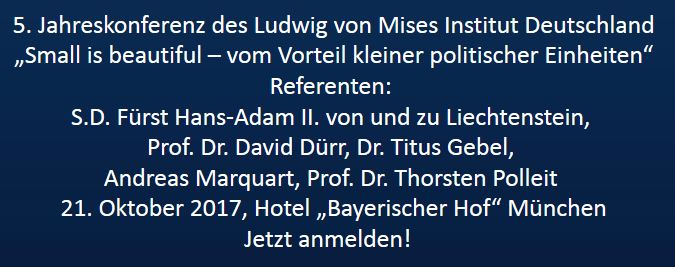Glühbirnenvorschriften sind die Schnurrbartverordnungen unserer Zeit
29.5.2017 – In Zeiten der Globalisierung, in denen ein gefühlter Weltstaat vor der Türe steht, der Gleichmacherei der Völker zu betreiben versucht, wäre die Betonung des Nahen, des Bekannten, des Lokalen das Gegenmittel.
von Marco Gallina.
Den Zentralismus in seinem Lauf hält weder Ochs‘ noch Esel auf – mag der Bürger meinen, wenn er derzeit nach Brüssel blickt. In einem Anflug ludovizianischen Etatismus‘ verkündete Jean-Claude Juncker nach dem Brexit-Referendum, nun müssten alle EU-Mitglieder den Euro übernehmen. Dass die Dänen einen eigenen Vertrag ausgehandelt haben, der sie von einer Euro-Übernahme entbindet, dieses Privileg aber keinerlei Rolle spielt – ist ein Zeichen dafür, dass Subsidiarität zur Auslegungssache geworden ist. Ein Umzug der EU-Regierung von Brüssel nach Versailles böte sich an.
Die Analogie ist mit Bedacht gewählt: die Vorstellung, Zentralisierung bedeute zugleich Modernisierung und Stärkung, entfaltete sich im Europa der Frühen Neuzeit. Bevor Ludwig XIV. zur Tat schritt, legte Thomas Hobbes bereits die theoretische Grundlage: mit seinem Leviathan setzte er dem zentralisierten Machtstaat ein Denkmal. Die Entmachtung regionaler Herrscher zugunsten eigener Autorität lässt sich schon bei Machiavelli nachweisen. Das real existierende, französische Vorbild machte ab dem 17. Jahrhundert Karriere und galt fortan als fortschrittlich.
Zentralisierung ist nicht Modernisierung
Die Erscheinung ist allerdings keine rein europäische, sondern datiert bis ins alte China. Qin Shihuangdi, der erste Kaiser des Reichs der Mitte, löste die regionalen Verwaltungen auf und formte einen zentralistischen Einheitsstaat, in dem er nicht nur Währung und Gewichte, sondern selbst Kleider, Haartracht und Schnurrbärte seiner Untertanen festlegte. Überflüssig zu erwähnen, dass seine Willkürherrschaft sich als äußerst unpopulär erwies, und kurz nach seinem Tod eine Rebellion ausbrach. Das Qin-Reich brach wieder auseinander.
Warum dieses extreme Beispiel? Weil es anschaulich zeigt, dass, je größer und zentralisierter ein Staat ist, er umso mehr zu autoritärem, wenn nicht totalitärem Gehabe neigt. Glühbirnenvorschriften sind die Schnurrbartverordnungen unserer Zeit. Und wie eine EU aussieht, die bereits jetzt Verträge bricht – Maastricht, Schengen und Dublin lassen grüßen – wenn der Zeitpunkt weiterer Zentralisierung gekommen ist, will man sich nicht ausmalen. Wer Freiheit und Selbstverantwortung wahren will, muss auf möglichst kleine Komponenten setzen, um den Leviathan zu bekämpfen.
Auch der klassische Nationalstaat scheitert oftmals daran. Kaum hatte sich das Bismarckreich 1871 gegründet, schaffte der Reichskanzler mit den Sozialversicherungen einen Moloch, der bis in unsere Zeiten fortlebt. Dabei existieren auf regionaler und lokaler Ebene durchaus Gegenbeispiele, wie das Problem hätte gelöst werden können: über Jahrhunderte sorgten Berufsgenossenschaften für Mitglieder, die nicht mehr arbeitsfähig waren. Zünfte, Gilden und Bergbaubruderschaften legten gemeinsame Kassen an, deren Beiträge an Berufsgenossen in Not gingen, wenn das Schicksal zuschlug.
Bismarcks zentralistische Erblast
Bismarcks staatlich verordnete Sozialversicherung war damals jedoch nicht ökonomisch, sondern politisch motiviert, um den Sozialdemokraten die Arbeiter abspenstig zu machen und mit dem neuen deutschen Staat zu versöhnen. Die deutsche Sehnsucht nach Sicherheit begründet, dass es heute anscheinend Gottgesetz ist, das jeder in eine nationale Sozialkassenzwangsjacke gesteckt wird, mit allen, längst bekannten Negativfolgen – inklusive der staatlichen Schraube betreffend der Beiträge, mit denen sich Wahlkampf machen lässt.
Schlimmer traf es freilich nur den anderen großen Nationalstaat, der sich im Laufe des 19. Jahrhunderts gründete: Italien. Indes das Deutsche Reich verglichen mit seinen Nachbarn immerhin föderal organisiert war, und das Königreich Bayern weiterhin Unabhängigkeiten bezüglich Eisenbahn, Postwesen und Abgaben (selbstverständlich inklusive Biersteuer) genoss, orientierte man sich im neu gegründeten Königreich Italien durchweg am französischen Zentralstaat. Einer Halbinsel, deren verschiedene Territorien über Jahrhunderte völlig verschiedene Wege gegangen waren, wurde ein völlig unpassendes Konzept übergestülpt, dessen Verwerfungen bis heute sichtbar sind. Das einheitliche italienische Steuersystem führte im Süden zu einer Verarmung der Landbevölkerung, was sich zuerst in Aufständen, anschließend in Auswanderung niederschlug. Randgebiete Italiens, die für Rom nachrangiges Interesse besaßen, stagnierten in ihrer Entwicklung – das betraf im Übrigen auch Gebiete des Nordens, wie etwa Venetien, das jahrhundertelang zu den reichsten Gebieten Italiens gezählt hatte, und bald als „zweites Sizilien“ galt.
Italien ist daher das Menetekel eines irgendwie gearteten EU-Staates, der dasselbe auf kontinentaler Ebene versucht: die Zusammenführung verschiedener politischer Systeme, historisch und kulturell unterschiedlich geprägter Territorien und nicht zuletzt die Einheit von wirtschaftlichen und fiskalischen Besonderheiten. Dass der Norden für den Süden zahlt, wie es in Italien seit 155 Jahren der Fall ist, offenbart sich heute schon den wacheren Geistern – mit dem feinen Unterschied, dass selbst der italienische Nationalstaat mit der Einführung einer gemeinsamen Währung erst nach seiner eigenen Gründung begann.
Menetekel Italien
Die Regionalisierung erscheint deswegen aus gleich mehreren Gründen erstrebenswert. Je kleiner eine staatliche Organisation ist, desto weniger autoritäre Kraft muss sie entwickeln. Historisch bemerkenswert bleibt, dass kleine Republiken bürgerliche Freiheiten am ehesten verteidigten: in den Vereinigten Provinzen der Niederlande und noch heute in der Schweiz. Die Urform der Demokratie entwickelte sich in Stadtstaaten, und es waren mittelalterliche Kommunen in Italien und Reichsstädte in Deutschland, in denen sich das Individuum am ehesten entfalten konnte. Das Ludwig von Mises Institut geht in einem Beitrag so weit, dass „Freie Städte“ in letzter Hinsicht sogar ganz privat existieren könnten, ohne jedweden staatlichen Eingriff.
Die Aufteilung größerer Gebiete in kleinere Regionen führt zudem zu einer erhöhten Wettbewerbsfähigkeit. Das bezieht sich nicht nur auf die Ökonomie, sondern treibt auch kulturelle Blüten. Dass Deutschland und Italien bis heute mehrere Zentren besitzen, und selbst mittelgroße Städte mit ansehnlichen Schlössern, Theatern, Gemäldegalerien oder Sehenswürdigkeiten aufwarten, liegt in der historischen Dezentralisierung des einstigen Heiligen Römischen Reiches begründet. Bischöfe, Fürsten und Bürgermeister wollten die Überlegenheit ihres Territoriums gegenüber dem Nachbarn demonstrieren. Noch heute treiben Nachbarschaftsstreitigkeiten die kuriosesten Blüten; historisch betrachtet sind sie ein Grund dafür, warum man in Italien alle 10 Meilen einen Ort mit eigener Küche, sehenswerter Barockkirche und Stadtpalazzo antrifft. Von diesen Investitionen zehren manche Gebiete bis heute.
Kleinere Körperschaften bedeutet zudem gleichzeitig: mehr Körperschaften, und damit mehr Möglichkeiten. Der vielgescholtene Bildungsföderalismus der Bundesrepublik mag hier als Beispiel dienen. So wird die Unvergleichbarkeit von Bildungsabschlüssen bemängelt. Doch gerade hier zeigt sich der Vorteil des Regionalismus: wäre Bildung Sache des Bundes, so hätte eine zentralistisch orientierte Partei längst dafür gesorgt, dass das bundesweite Bildungsniveau dem des Bundeslandes NRW entspräche. In diesem Sinne konnten wenigstens einige Bundesländer ihre regionale Besonderheit wahren.
Hier wird deutlich, warum auch der Nationalstaat einer Auflockerung in autonomere Gebiete bedarf. Einwohner ähnlicher Sprache und Kultur würden eher „mit den Füßen abstimmen“, wenn ihre eigene Region weniger Freiheiten gewährt als die benachbarte. Auch hier existiert ein historisches Beispiel, nämlich der Wettbewerb zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Ein völlig autonomes Bayern, losgelöst von jeder Bundespolitik, könnte seine immigratorischen Fliehkräfte weitaus stärker entfalten; im Umkehrschluss müssten die Nachbarregionen dafür sorgen, ebenfalls attraktiv zu bleiben.
Zuletzt ist die Region der beste Garant für Identitätspflege. Menschen identifizieren sich üblicherweise mit der nächsten Umgebung. Kulturschocks sind selbst auf nationaler Ebene immer noch der Fall; selbst ein Vierteljahrhundert nach dem Mauerfall besteht ein Mentalitätsgefälle zwischen Ost und West. In einer Willensnation wie der Schweiz ist dieser Gegensatz noch schärfer ausgeprägt, wird aber dadurch behoben, dass die starke kantonale Identität durch weitreichende Autonomie gewahrt wird. In Zeiten der Globalisierung, in denen ein gefühlter Weltstaat vor der Türe steht, der Gleichmacherei der Völker zu betreiben versucht, wäre die Betonung des Nahen, des Bekannten, des Lokalen das Gegenmittel. Die Integration Bayerns in das Deutsche Reich funktionierte vor allem deswegen, weil die Preußen die Bayern Bayern sein ließen.
Ähnliches könnte man der Brüsseler Administration ins Buch schreiben. Aber anscheinend müssen manche Großreichsträume erst in Sezessionsbestrebungen untergehen, ob regional oder national, damit sich aus letzteren Neues formen kann. Von der EU wird dann nicht einmal eine Terrakotta-Armee oder ein Versailler Schloss bleiben, aus denen man zumindest noch touristischen Nutzen ziehen kann.
*****
Dieser Beitrag ist mit der Überschrift „Regionalismus ist reich und sexy“ am 3.9.2016 zuerst bei Tichys Einblick erschienen.
—————————————————————————————————————————————————————————–
Marco Gallina studierte Geschichte und Politikwissenschaften, Schwerpunkt europäische Diplomatiegeschichte, und schloss mit einer Arbeit über Machiavelli das Masterstudium ab. Er nennt sich Italo-Deutscher Mischling, kulturell bilingual aufgewachsen und im Rheinland sozialisiert. Doktorand in spe.
*****
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Institut Deutschland wieder.
Foto Startseite: © Peter Wienerroither – Fotolia.com