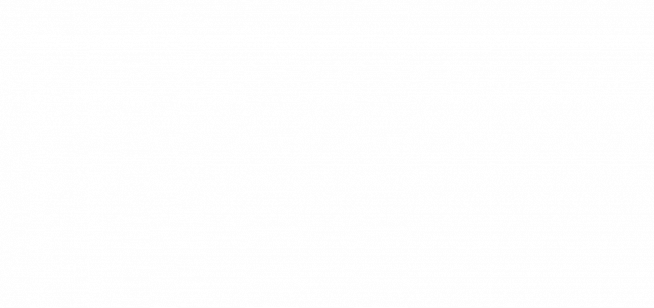Die Inflationierung der Immobilienpreise
12.6.2015 – von Ryan McMaken.
In jüngster Vergangenheit wurden immer mehr Preisindizes für Wohnimmobilien geschaffen. Der Case-Shiller Home Price Index ist ja schon lange bekannt, aber im Verlauf des letzten Jahrzehnts wurden von z.B. Trulia, CoreLogic und Zillow, um nur einige zu nennen, weitere mit Macht ins öffentliche Bewusstsein gerückt.
Den Preisen für Wohnimmobilien wird eine Bedeutung weit über die Immobilienbranche hinaus beigemessen, sofern sie als Indikator für die Entwicklung der Gesamtwirtschaft gesehen werden. Steigen die Immobilienpreise, so die Annahme, geht es der Wirtschaft gut. Entsprechend können wir ganz entspannt sein, wenn die Preise ansteigen gehen, bei sinkenden Preisen aber sollten wir uns Sorgen machen.
Streng genommen ist das aber eine merkwürdige Sichtweise, denn schließlich handelt es sich bei Immobilien um ein grundlegendes Gut. Wenn die Lebensmittelpreise mit einer Rate von 7 % oder 8 % p.a. stiegen (wie es auf vielen Immobilienmärkten in den letzten Jahren geschah), würden wir uns dann gegenseitig auf die Schultern klopfen wegen der wunderbaren Wirtschaftsentwicklung? Oder wären wir nicht eher besorgt, sofern die Einkommen nicht in gleichem Maße stiegen? Oder wie wäre es bei den Preisen für Schuhe, Kleidung oder Ausbildung?
Hinsichtlich der Kosten für Wohnen hingegen wird uns erzählt, einen Anstieg sei selbst dann zu begrüßen, wenn er die Lohnsteigerung übertrifft.
Wir sollen uns hohe Preise für Wohnimmobilien wünschen
Wenn aber wie aktuell das Wachstum der Immobilienpreise an dem der Löhne vorbeizieht, kann man sich nur noch weniger „Wohnen“ leisten. Das wird zwar von den Befürwortern florierender Immobilienpreise nur widerwillig eingestanden, aber die Bezahlbarkeit von Wohnraum wird gegenüber dem Ziel, das Niveau der Immobilienpreise unbedingt hoch zu halten, in den Hintergrund gerückt.
Dahinter steht die Vorstellung, dass selbst für den Fall, dass die Relation von Wohnungspreisen zu Haushaltseinkommen aus der Balance gerät, die meisten Schwierigkeiten sich noch lösen lassen, sofern es nur gelingt, den Menschen Wohnraum zu verschaffen. Ist man erst einmal Hausbesitzer, so die Theorie, verfügt man über ein großes Vermögen, dessen Preis (immer) steigt, was wiederum bedeutet, dass das Nettovermögen des Hausbesitzers in gleichem Maße zunimmt.
In der Folge kann der Hauseigentümer sein Nettovermögen zum Kauf von Möbeln, Einrichtungen und einer ganzen Reihe weiterer Konsumgüter nutzen. Angesichts dieser Konsumausgaben hebt die Wirtschaft nur so ab, wovon alle profitieren. Steigende Hauspreise sind eine Lapalie, sofern es nur gelingt, den Menschen erst einmal Wohnraum zu verschaffen, denn letztlich ist der wirtschaftliche Gesamteffekt immens positiv.
Mit billigen Kredite wird Wohneigentum bezahlbar
Es überrascht nicht, dass hinter einer derartigen Auffassung ganz primitiver Keynesianismus steckt. Bei Wohneigentum geht es nicht um die Befriedigung eines Schutzbedürfnisses, sondern um die Generierung von Ausgaben, die weiteren Konsum stimulieren. Wohnungseigentum soll also letztlich die aggregierte Nachfrage anregen. Dass man in einem Haus auch leben kann, stellt einen bloßen Nebeneffekt dar. Diese Makroobsession ist zumindest zum Teil der Grund dafür, dass die Regierung in den letzten Jahrzehnten eine derart aggressive Politik zur Förderung des Wohneigentums verfolgte.
Es gibt jedoch ein Haar in der Suppe: steigen nämlich die Immobilienpreise längere Zeit stärker als die Löhne, sind ceteris paribus immer weniger Menschen in der Lage, hinreichend Eigenkapital für den Immobilienkauf anzusparen.
Kein Grund zur Beunruhigung, versichern uns die Experten. Wir ermöglichen die Aufnahme großer Darlehen durch inflationäres Drucken von Papiergeld. Folglich wurden Niedrigstzinsen und minimale Eigenkapitalanforderungen seit Ende der 1980er zum Normalzustand.
Den Verlauf des „Endspiels“ konnten wir 2005 während der letzten Immobilienblase beobachten, als Fannie Mae eine 40-jährige Hypothek auflegte. Auf dem Weg zum Wohnungseigentum ging es also gar nicht mehr darum, die Hypothek zurückzuzahlen, sondern nur noch darum, das Haus zu „kaufen“ und die monatlichen Raten zu zahlen, bis man in ein neues Haus umzieht und wieder eine Hypothek mit 30 bis 40 Jahren Laufzeit aufnimmt.
Es lohnt sich, verschuldet zu sein
Oberflächlich lässt sich dabei kein grundlegender Unterschied mehr zu einem Wohnen zur Miete erkennen. Wenn der Wohnungseigentümer seine monatliche Hypothekenrate nicht bedient, setzt ihn die Bank als neue Eigentümerin auf die Straße. Ein ganz ähnliches Szenario wie bei einem Mietverhältnis, wenn der Mieter nicht mehr zahlt. Einen großen Unterschied gibt es allerdings. Aus Sicht des Eigentümers ist es durchaus sinnvoller zu kaufen als zu mieten, weil sich bei Festzinsdarlehen die monatliche Rate im Zuge einer Inflation real immer weiter entwertet. Wohnungsmieten hingegen tendieren mit der Inflation anzusteigen.
Aber warum bieten Kreditinstitute derartige Langfristdarlehen überhaupt an, wenn die Zahlungen real immer weniger werthaltig werden? Schließlich kann im Verlauf von 30 Jahren einiges schief gehen.
Kreditgeber sind dazu bereit und können dies auch, weil derartige Darlehen subventioniert und abgesichert werden durch Regierungsinstitutionen wie Fannie Mae (die diese Darlehen auf dem Sekundärmarkt aufkauft), durch Rettungskäufe und durch zahllose andere Bundesprogramme wie z.B. FHA (Federal Housing Administration). Auf einem ungestörten Markt würde ein derart langfristiges Darlehen natürlich hohe Zinsen fordern, um die Risiken abzudecken. Aber der Kongress und die Fed kamen zu Hilfe mit Rettungsversprechen und billigem Geld, so dass günstige Darlehen mit 30 Jahren Laufzeit weiter bestehen können.
So bildete sich ein komplexes System von Subventionen und Begünstigungen für Kreditgeber, Hauseigentümer, Regierungsinstitutionen und die Fed. Die Preise für Wohneigentum weisen ständig nach oben, wodurch das Nettovermögen der Eigentümer steigt, und Banken können recht riskante Kredite vergeben in Erwartung von Rettungsmaßnahmen, die im Notfall ergriffen werden.
Wenn jedoch die Immobilienpreise stärker steigen als das Angebot billigen Geldes und günstiger Kredite, können Probleme nicht ausbleiben. Tatsächlich beobachtet man aktuell trotz niedriger Zinsen ein Sinken der Hauseigentumsrate und einen Rückgang des Leerstandes am Mietwohnungsmarkt wie seit 20 Jahren nicht mehr. Gleichzeitig befindet sich die Fertigstellung neuer Häuser auf dem Niveau von 1992, so dass wenig Hoffnung auf Entspannung auf dem Wohnungsmarkt besteht. Irgendetwas läuft offensichtlich nicht nach Plan.
Wer sind die Verlierer?
Die alten Schuldentricks zur Steigerung der Wohneigentumsrate trotz steigender Immobilienpreise scheinen nicht mehr zu funktionieren.
Vom Standpunkt eines freien Marktes aus gesehen ist es an sich weder gut noch schlecht, zur Miete zu wohnen. Nur haben sich die US-Politiker vor langer Zeit entschieden, dem Wohnungseigentum gegenüber der Miete den Vorrang einzuräumen. Folglich leben wir in einem Wirtschaftssystem, das Mieter zum Erwerb von Wohneigentum drängt – Inflation ebenso wie das Steuersystem strafen Mieter stärker als Eigentümer – während die Preise für Wohnimmobilien immer weiter nach oben getrieben werden.
Als während der letzten Immobilienblase die Eigentumsrate anstieg, schienen dies wenige zu bemerken oder sich darum zu kümmern. Zwischen 2004 und 2009 wurden so viele Mieter zu Wohnungseigentümern, dass der Mietwohnungsleerstand auf Rekordhöhen anstieg. In der aktuellen Situation ist es allerdings unmöglich, steigenden Mieten zu entkommen oder sich gegen Inflation zu sichern, indem man Wohneigentum erwirbt.
Diesmal steigen die Kosten des Erwerbs von Wohneigentum mit einer Rate von 6 bis 10 % p.a., aber nur wenige Mieter sind in der Lage, ins Lager der Eigentümer zu wechseln und von der Wertsteigerung zu profitieren. Stattdessen sehen sie sich rekordverdächtigen Mietsteigerungen ausgesetzt, bei einem gleichzeitig extrem niedrigem Bestand an Häusern, die zum Verkauf stehen.
Es gab eine Zeit, als steigende Immobilienpreise und steigende Wohneigentumsraten Hand in Hand gingen. Da war es der Regierung möglich, an der inoffiziellen Politik der Förderung steigender Wohnungspreise festzuhalten und gleichzeitig die Eigentumsrate zu fördern. Diese Zeiten sind nun vorbei.
*****
Aus dem Englischen übersetzt von Dr. Bernhard Pieper. Der Originalbeitrag mit dem Titel Why Do We Celebrate Rising Home Prices? ist am 23.5.2015 auf der website des Mises-Institute, Auburn, US Alabama erschienen.
Foto-Startseite: © Gina Sanders – Fotolia.com
—————————————————————————————————————————————————————————
Ryan McMaken ist Editor von Mises Daily und The Free Man.