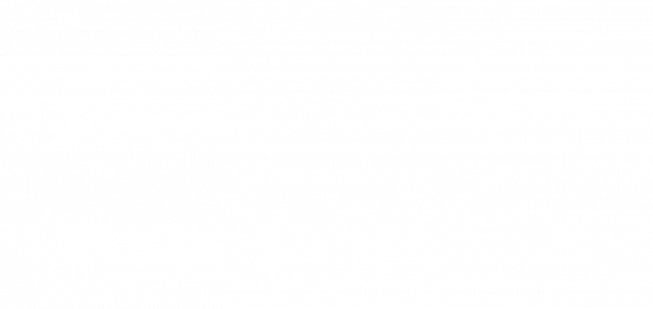Zehn große ökonomische Mythen (Teil 2)
3.12.2014 – Der folgende Beitrag ist Murray N. Rothbard‘s Buch “Making Economic Sense” (1995) entnommen. Es handelt sich um das Kapitel “Ten Great Economic Myths” (Seite 7 – 19), das hier in drei Teilen veröffentlicht wird. Teil 1 der Reihe wurde am 26.11.2014 veröffentlicht, Sie finden ihn hier. Übersetzt von Dr. Bernhard Pieper.
——————————————————————————————————————————————————————————–

Murray N. Rothbard (1926 – 1995)
Zahlreiche ökonomische Mythen plagen unser Land, vernebeln das Denken der Öffentlichkeit über wichtige Probleme und verführen uns dazu, falsche und gefährliche wirtschaftspolitische Maßnahmen zu akzeptieren…
Mythos 4: Wenn die Fed das Geldangebot verknappt, steigen die Zinsen (oder sie fallen); wenn die Fed das Geldangebot ausweitet, steigen die Zinsen (oder sie fallen)
Die Finanzpresse heute versteht so viel von Wirtschaft, dass sie sich wie Habichte auf die wöchentlichen Daten zum Geldangebot stürzt; nur leider interpretiert sie diese Daten in äußerst chaotischer Weise. Ein steigendes Geldangebot wird als Hinweis auf sinkende Zinsen und mehr Inflation gedeutet, es wird aber ebenso – und dies oft im selben Artikel – als Auslöser für steigende Zinsen dargestellt. Gleiches gilt auch umgekehrt; ein Bremsen der Geldmengenwachstums durch die Fed wird als Ursache sowohl für steigende wie auch für sinkende Zinsen erklärt. Manchmal scheint es, dass gleichgültig, was die Fed auch unternimmt, dies als Erklärung für steigende Zinsen herhalten muss. Offensichtlich läuft da einiges falsch.
Das Problem besteht darin, dass – ähnlich wie beim Preisniveau – verschiedene Faktoren die Zinsrate in jeweils unterschiedlicher Richtung beeinflussen. Die Fed weitet die Geldmenge aus, indem sie den Geschäftsbanken mehr Reserven einräumt und so eine Steigerung des Kreditvolumens und der Bankeinlagen ermöglicht. Die Kreditexpansion bedeutet zwangsläufig vermehrtes Angebot auf dem Kreditmarkt und damit ein Sinken des Preises für Kredite, d.h. einen niedrigeren Zins. Wenn die Fed umgekehrt Kredit- und Geldangebot beschränkt, sinkt das Angebot auf dem Kreditmarkt, was die Zinsen steigen lassen sollte.
Genau dies passiert in der ersten oder in den ersten ein oder zwei Dekaden chronischer Inflation. Eine Expansionspolitik der Fed senkt das Zinsniveau, restriktive Maßnahmen lassen es steigen. Aber nach dieser Periode beginnen die Marktteilnehmer zu kapieren, was sich abspielt. Sie verstehen, dass aufgrund der expansiven Geldpolitik eine chronische Inflation vorliegt. Wenn diese Tatsache einmal verinnerlicht ist, realisieren die Akteure auch, dass Inflation den Gläubiger zugunsten des Schuldners schädigt. Wenn einer also einen Kredit zu 5% p.a. vergibt, bei einer Inflationsrate von 7% im betroffenen Jahr, macht er Verlust anstatt Gewinn. Er verliert 2%, da die Rückzahlung in Dollar mit 7% weniger Kaufkraft erfolgt. Der Schuldner gewinnt entsprechend durch die Inflation. In dem Maße, wie die Gläubiger sich darauf einstellen, verlangen sie eine Inflationsprämie zusätzlich zum reinen Zins und die Schuldner werden bereit sein, diese zu zahlen. Folglich wird alles, was die Inflationserwartungen schürt, die Inflationsprämien anheben; was diese Erwartungen dämpft, reduziert diese Prämien. Deshalb wird eine restriktive Geldpolitik der Fed unter diesen Umständen über die Dämpfung der Inflationserwartungen das Zinsniveau senken; eine expansive Fed wird die Erwartungen befeuern und die Zinsen steigen lassen. Es sind also zwei entgegengesetzt wirkende Mechanismen aktiv. Folglich kann eine expansive oder restriktive Politik der Fed die Zinsen entweder steigen oder sinken lassen, je nachdem welche Wirkungskette gerade dominiert.
Welche das sein wird? Dies läßt sich unmöglich sicher vorhersagen. In den frühen Jahrzehnten einer Inflationsperiode gibt es noch keine Prämie; zu späterer Zeit, wie der heutigen, ist sie vorhanden. Die relative Stärke der Anpassung, wie auch die Reaktionszeit, hängen von den subjektiven Erwartungen der Akteure ab und diese lassen sich nicht mit Sicherheit vorhersagen. Genau darin besteht einer der Gründe, warum es keine sicheren Wirtschaftsprognosen gibt.
Mythos 5: Ökonomen können mit Hilfe von Chartanalysen oder computergestützten Modellen die Zukunft vorhersagen
Die Schwierigkeit, das Zinsniveau zu prognostizieren, illustriert die Fußangeln von Wirtschaftsprognosen ganz allgemein. Menschen sind nun mal je ganz eigene Käuze, deren Verhalten – Gott sei Dank – sich nicht präzise vorhersagen lässt. Ihre Werte, Vorstellungen, Erwartungen und ihr Wissen ändern sich ständig und dies in einer völlig unvorhersehbaren Weise. Welcher Ökonom hätte z.B. die Kohlkopfpuppen-Manie von Weihnachten 1983 vorhersagen können? Jede ökonomische Größe, jeder Preis, Kauf oder Einkommensbetrag stellt die Verkörperung tausender, ja millionenfacher unvorhersehbarer Entscheidungen von Individuen dar.
Es gibt zahllose Studien zur Qualität ökonomischer Prognosen, alle mit verheerenden Ergebnissen. Prognostiker beklagen häufig, dass sie gute Ergebnisse produzieren könnten, wenn nur die jeweils aktuellen Trends Bestand hätten; die Schwierigkeiten bestünden im Erfassen der Trendänderungen. Ganz genau, es ist kein Kunststück, bestehende Trends in die Zukunft zu extrapolieren. Dafür benötigt man keine komplizierten Computermodelle, ein Lineal tut es auch oder gar noch besser und ist obendrein billiger. Das Kunststück besteht ja gerade in der Vorhersage, wann und wie sich Trends ändern, und genau darin erweisen sich Prognostiker als notorisch schlecht. Kein Ökonom sagte die Schwere der Depression von 1981-82 voraus und keiner prognostizierte die Stärke des Boom von 1983.
Wenn Sie sich das nächste Mal dabei ertappen, sich gerade vom Fachjargon oder der scheinbaren Expertise ökonomischer Prognostiker einwickeln zu lassen, stellen Sie sich die folgende Frage: Wenn er wirklich die Zukunft vorhersähe, warum verschwendet er dann seine Zeit mit der Publikation von Marktanalysen oder mit Beratungsleistungen, wenn er stattdessen an der Börse oder auf den Rohstoffmärkten Billionen von Dollar verdienen könnte?
Mythos 6: Es besteht ein „tradeoff“ zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation
Wann immer die Regierung zur Beendigung der Inflationspolitik aufgefordert wird, warnen Ökonomen des Establishments und Politiker vor gravierenden Folgen für die Arbeitslosigkeit. Demnach sitzen wir in der Falle und müssen Inflation gegen Arbeitslosigkeit abwägen. Man will uns weis machen, zumindest ein wenig von beidem hinnehmen zu müssen.
Bei dieser Lehre handelt es sich um eine Rückfallposition für Keynesianer. Anfangs versprachen die Keynesianer, durch Manipulation und „fine-tuning“ von Defiziten und Regierungsausgaben in der Lage zu sein, uns dauerhaft Wohlstand und Vollbeschäftigung ohne Inflation zu bescheren. Als dann aber die Inflation chronisch wurde, mit steigender Tendenz, änderten sie ihr Liedchen und warnten vor dem vermeintlichen „tradeoff“, um die Regierung von jeglichem Druck zu entlasten, ihr inflationäres Geldschöpfen zu beenden.
Die Lehre vom „tradeoff“ gründet auf der sogenannten „Phillips-Kurve“, einem vom britischen Ökonom A. W. Phillips vor vielen Jahren ausgedachten Zusammenhang. Phillips korrelierte Lohnwachstumsraten mit Inflation und behauptete, dass sich beide invers zueinander veränderten: Je höher das Lohnwachstum, umso niedriger die Arbeitslosigkeit. Bereits auf den ersten Blick handelt es sich um eine merkwürdige Doktrin, weil sie sowohl gegen jegliche Logik, als auch gegen den gesunden Menschenverstand verstößt. Theoretisch sollte man erwarten, dass die Arbeitslosigkeit mit der Höhe der Löhne zunimmt und umgekehrt. Wenn wir etwa morgen zu unseren Arbeitgebern gingen und eine Verdoppelung oder gar Verdreifachung unsere Löhne forderten, wären die meisten von uns umgehend ohne Arbeit. Gleichwohl nahmen die Keynesianer diese bizarre Entdeckung für bare Münze.
Mittlerweile sollte klar sein, dass diese statistische Beobachtung im Widerspruch sowohl mit den Tatsachen, wie auch mit der logischen Theorie steht. Denn in den 50er Jahren lag die Inflationsrate bei ein bis zwei Prozent während die Arbeitslosigkeit um drei bis vier Prozent pendelte. Später hingegen bewegte sich die Arbeitslosigkeit zwischen acht und elf Prozent bei einer Inflationsrate zwischen fünf und dreizehn Prozent. Im Verlauf der letzten zwei bis drei Jahrzehnte stiegen also beide, Inflation und Arbeitslosigkeit, steil und erheblich an. Wenn überhaupt bestand also eine inverse Phillips-Kurve. Von einem tradeoff kann überhaupt keine Rede sein.
Aber Ideologen beugen sich selten den Tatsachen, nicht einmal diejenigen, die selbst permanent beanspruchen, ihre Theorien an den Fakten zu „testen“. Um das Konzept zu retten, behaupten sie einfach den Fortbestand des Inflation-Arbeitslosigkeit-tradeoffs der Phillips-Kurve, nur eben bei einer unerklärlichen Verschiebung zu einem neuen Datensatz von Tradeoff-Positionen. Gegen eine solche Geisteshaltung lässt sich nicht argumentieren.
Fest steht, dass – selbst wenn die aktuelle Inflation kurzfristig die Arbeitslosigkeit verringert, indem die Preise den Löhnen vorauseilen (und so den Reallohn senken) – sie langfristig für mehr Arbeitslosigkeit sorgen wird. Letztlich werden die Löhne die Inflation einholen, und die Inflation wird dann unausweichlich Rezession und Arbeitslosigkeit herbeiführen. Nach mehr als zwei Jahrzehnten mit Inflation leben wir mittlerweile in diesem “langfrist”-Szenario.
“Zehn große ökonomische Mythen (Teil 3)” werden wir am 10. Dezember 2014 veröffentlichen.
——————————————————————————————————————————————————————————
Murray N. Rothbard wurde 1926 in New York geboren, wo er an der dortigen Universität Schüler von Ludwig von Mises wurde. Rothbard, der 1962 in seinem Werk Man, Economy, and State die Misesianische Theorie noch einmal grundlegend zusammenfasste, hat selbst diese letzte Aufgabe, die Mises dem Staat zubilligt, einer mehr als kritischen Überprüfung unterzogen.