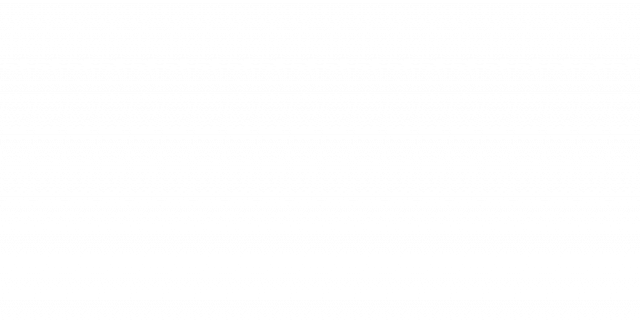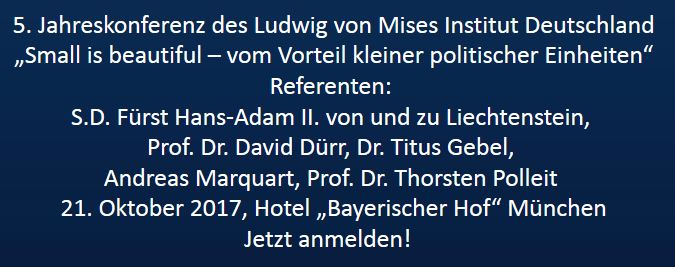„Ludwig von Mises hat so tief wie kaum jemand vor ihm über die Natur der Freiheit nachgedacht“
15.5.2017 – Interview mit Rolf W. Puster, Professor für Philosophie an der Universität Hamburg.
[HIER KLICKEN, um den Beitrag als Podcast auf Misesde.org anzuhören.]
*****
Herr Professor Puster, im Vorgespräch zu unserem Interview sagten Sie, Ludwig von Mises würde „unter Wert gehandelt“. Bitte erläutern Sie unseren Lesern, was Sie damit meinten.
Lassen Sie mich an eine Erfahrung anknüpfen, die jeder Freiheitsfreund kennt, der seine Überzeugungen gelegentlich außerhalb des Kreises von Gleichgesinnten artikuliert; dort wird er nämlich regelmäßig mit moralischen Einwänden konfrontiert, wenn er für die Freiheit eine Lanze bricht. Da die Ignorierung derartiger Einwände massive soziale Sanktionen im Gefolge zu haben pflegt, mobilisieren Freiheitsfreunde ihrerseits moralische Argumente, in denen Freiheit als „Wert“ präsentiert und konkurrierenden Werten entgegengehalten wird. Fraglos sind viele Freiheitsfreunde auch tatsächlich tief von der Sittlichkeit ihrer Grundsätze und der sich daraus ergebenden politischen Empfehlungen durchdrungen.
Leider ändert die Lauterkeit, mit der sich Freiheitsfreunde auf moralische Argumentationen einlassen, nichts daran, dass sie aus einem derartigen Werte-Poker selten als Gewinner hervorgehen. Mag auch die Verbreitung freiheitlicher Auffassungen, in absoluten Zahlen gesehen, weltweit ansteigen – dass sie substanziellen Einfluss auf den Verlauf öffentlicher Debatten und die Gestaltung realer Politik gewinnen, ist nicht zu sehen; massiver Etatismus ist – nicht nur hierzulande und nicht nur in den Köpfen der Eliten – das vorherrschende Denkmuster.
In meinen Augen ist der besagte Werte-Poker als Mittel, die Vorzüge der Freiheit ins rechte Licht zu rücken, nicht nur strategisch aussichtslos, sondern auch sachlich verfehlt. Moralische Intuitionen, die – wie die Auszeichnung der Gerechtigkeit als höchsten Wert – mit Freiheitsforderungen notorisch in Konflikt geraten, lassen sich de facto (von seltenen Ausnahmen abgesehen) nicht mit moralischen Gegenintuitionen zugunsten der Freiheit neutralisieren oder überwinden.
Ludwig von Mises hat so tief wie kaum jemand vor ihm über die Natur der Freiheit nachgedacht. Dabei hat er erkannt, dass sie sich aus der Natur des homo agens, des handelnden Menschen, verstehen und begründen lässt. Die besondere Stärke dieser Freiheitsbegründung besteht darin, dass sie nicht auf die Inanspruchnahme umstrittener Werte oder moralischer Intuitionen angewiesen ist. Daraus ergibt sich umgekehrt – und das ist vor dem Hintergrund realer politischer Auseinandersetzungen eine geradezu unerhörte Pointe -, dass die auf der Handlungsnatur des Menschen fußende Freiheitsbegründung auch nicht mit moralischen Argumenten angegriffen und schon gar nicht übertrumpft werden kann.
Bedauerlicherweise hat Mises mit dieser Sicht selbst bei seinen Schülern und Anhängern nur begrenzten Anklang gefunden. Das lässt sich daran ablesen, dass sein Bekenntnis zur Wertfreiheit der Wissenschaft von Misesianern selten betont (und noch seltener exerziert) wird, obwohl Mises seine freiheitsfundierende Lehre vom Handeln, die Praxeologie, eindeutig als wertfreie Wissenschaft verstanden hat. – Solange dieser Punkt einer vor- bzw. außermoralischen Freiheitsbegründung mit Hilfe der von Mises bereitgestellten theoretischen Mittel noch nicht voll ausbuchstabiert ist, wird Mises „unter Wert gehandelt“.
Wie würde ich einem Gesprächspartner gegenüber argumentieren, wenn ich „Freiheit wertfrei begründe“?
Die Argumentation setzt bei einer rein beschreibenden Analyse von Begriffen an, die für das Feld des menschlichen Handelns zentral sind. Auch ohne vollständig zu sein, kann eine derartige Analyse wesentliche Zusammenhänge zwischen diesen Begriffen aufdecken und argumentativ fruchtbar machen. Der Vorzug eines solchen Ansatzes besteht darin, dass er Begriffe ins Visier nimmt, die fernab von normativen und politischen Meinungsverschiedenheiten angesiedelt und daher in ihrem Verständnis unkontrovers sind.
Zunächst macht man sich klar, dass jedes Handeln einem Wollen entspringt — wo nicht gewollt wird, wird nicht gehandelt: Dem handelnden Akteur geht es immer darum, sein Wollen durch eigenes Tun zu realisieren. (Die geläufige Rede, dass beim Handeln Ziele, Zwecke oder Absichten verfolgt werden, lässt sich auf den fundamentalen Umstand zurückführen, dass Akteure etwas wollen.) Sodann vergegenwärtigt man sich, dass Freiheit und Zwang sich gegenseitig ausschließen: Wer in seinem Handeln frei ist, unterliegt keinem Zwang; wer hingegen unter Zwang steht, ist unfrei, weil er sich durch das Tun anderer an der Realisierung seines Wollens gehindert sieht.
Aus diesen schlichten begrifflichen Klarstellungen folgt bereits, dass jeder Akteur mit Blick auf sich und sein Handeln dem Zwang ablehnend gegenübersteht. Denn wer etwas wirklich will und sich demzufolge anschickt, sein Wollen handelnd zu realisieren, kann Hindernisse unmöglich gutheißen, die andere der Realisierung seines Wollens in den Weg legen. Auf die je eigenen Handlungsambitionen bezogen, ist mithin jeder Akteur – hartgesottene Diktatoren eingeschlossen – ein naturwüchsiger Gegner des Zwangs und ein Freund der Freiheit.
Obwohl damit erst der Grundstein einer Freiheitsbegründung gelegt ist, sollte eines deutlich geworden sein: Wenn jeder Akteur, ganz gleich, was er will, der Freiheit im eigenen Fall prinzipiell positiv gegenübersteht, dann liegt die Beweislast bei denen, die Zwang befürworten, und nicht bei denen, die ihn ablehnen. (Dass die Freiheitsgegner die Beweislast der Zwangsbefürwortung nicht tragen können, ist das Resultat späterer Argumentationsschritte.)
Offenkundig stützt sich der skizzierte Ansatz einer Freiheitsbegründung nicht auf moralische, metaphysische, religiöse oder weltanschauliche Lehrmeinungen. Wer versteht, wie Handeln und Wollen sowie Freiheit und Zwang begrifflich zusammenhängen, der hält bereits die wichtigsten Bausteine einer wertfreien Freiheitsbegründung in der Hand.
Täuscht der Schein — oder spielen in Ihrer Argumentation nicht subjektive Phänomene eine herausgehobene Rolle?
In der Tat, Subjektives nimmt in meinen Überlegungen einen prominenten Platz ein. Aber die grundlegenden Einsichten der Praxeologie gelten nicht schon deswegen, weil sie subjektive Phänomene betreffen, sondern weil zwischen einigen subjektiven Phänomenen – nämlich denen, die das Handeln ausmachen – bestimmte Zusammenhänge mit begrifflicher Notwendigkeit bestehen.
Die folgende (stark vereinfachte) Handlungsdefinition mag meinen Punkt illustrieren: Jemand handelt genau dann, wenn er etwas tut, weil er etwas will und zudem glaubt, das Gewollte durch das, was er tut, verwirklichen zu können. – Hier ist ausgesprochen, dass Wollen, Glauben und Tun (alles subjektive Phänomene) in einer bestimmten Weise verknüpft sind, wenn jemand handelt, und dass kein Handeln vorliegt, wenn die besagte Verknüpfung nicht vorliegt. Dass es sich genau so verhält und auch gar nicht anders verhalten kann, ist eine echte Entdeckung, und Mises hat für diese Entdeckung mehr geleistet als alle Denker der Philosophiegeschichte. Es handelt sich dabei also nicht um die Entdeckung von bestimmten subjektiven Phänomenen, sondern um die Entdeckung eines zwischen bestimmten subjektiven Phänomenen objektiv bestehenden Zusammenhangs. Das klingt vielleicht paradox, ist es aber keineswegs.
Hat Ihre Betonung der Subjektivität des Handelns auch Auswirkungen auf Ihr Freiheitsverständnis?
Ganz entschieden: Ja! Auch Freiheit ist ein subjektiver Begriff. Subjektive Begriffe sind entweder in einer direkten oder in einer indirekten Weise subjektiv: (i) Die direkt subjektiven Begriffe beziehen sich unmittelbar auf subjektive Phänomene, etwa auf die Einstellungen des Wollens und Glaubens. Ohne Rückgriff auf die ihnen zugrundeliegenden subjektiven Phänomene lassen sich die direkt subjektiven Begriffe nicht richtig verstehen. (ii) Die indirekt subjektiven Begriffe lassen sich nicht richtig verstehen, wenn man dabei nicht auf direkt subjektive Begriffe zurückgreift. So haben wir beispielsweise den indirekt subjektiven Begriff des Handelns (u.a.) mit Hilfe der direkt subjektiven Begriffe des Wollens und Glaubens erläutert. – In beiden Fällen ist die explikative Einbeziehung der subjektiven Phänomene unumgänglich, wenn das, was unter diesen Begriffen üblicherweise verstanden wird, zutreffend erfasst werden soll.
Handlungsfreiheit ist allein schon deswegen ein subjektiver Begriff, weil man zu seinem Verständnis auf den seinerseits subjektiven Begriff des Handelns angewiesen ist. Damit ist der subjektive Charakter des Freiheitsbegriffs jedoch noch längst nicht erschöpft. Er erschließt sich erst dann, wenn man den komplexen Begriff des Zwangs durchschaut hat; dorthin führt allerdings ein Weg, den zu gehen eine Reihe von Schritten erfordert.
Skizzieren Sie uns doch, wie die nächsten Schritte auf diesem Weg aussehen.
Beginnen wir mit der vagen, im Kern aber richtigen Überzeugung, dass Freiheit etwas mit der Abwesenheit von Hindernissen zu tun hat. Auch der Begriff des Hindernisses erweist sich bei näherem Zusehen als subjektiv: Hindernisse sind nicht einfach in der Welt. Eine Schneeverwehung ist zunächst nichts als eine Schneeverwehung. Zum Hindernis wird sie nur dadurch, dass ein Subjekt in ihr etwas sieht, was der Realisierung seines Wollens im Weg steht. In einer Welt, in der niemand etwas will oder sich niemand an der Realisierung seines Wollens gehindert sieht, gibt es keine Hindernisse. Sofern also Freiheit etwas mit der Abwesenheit von Hindernissen zu tun hat, verweist sie uns auf die subjektiven Einstellungen des Wollens und Glaubens.
Freiheit ist (qua Handlungsfreiheit) ein Zustand, den auch der einsame Robinson kennt. Unser eigentliches Interesse gilt jedoch der Handlungsfreiheit im sozialen Kontext; erst in einem solchen Kontext bekommt die Freiheit ihre politische Dimension. Unter den Vorzeichen dieses eigentlichen Interesses wird unser Freiheitsbegriff spezifischer, enger und damit auch anspruchsvoller: Unter politischer Freiheit verstehen wir dann nicht mehr die Abwesenheit von Hindernissen beliebiger Art, sondern die Abwesenheit von solchen Hindernissen, die wir uns von anderen Akteuren in den Weg gelegt sehen, also die Abwesenheit von Zwang.
Der Zwangsbegriff gewinnt damit sogar auf zweifache Weise einen subjektiven Charakter: Zum einen beruht der Hindernischarakter des Zwangs darauf, dass er (nicht anders als eine Schneeverwehung) subjektiv als Hindernis gesehen wird. Zum anderen führt jeder Gezwungene den Zwang auf eine Quelle zurück, der er (anders als einer Schneeverwehung) ihrerseits einen subjektiven Charakter attestiert, nämlich auf fremdes Handeln.
Diese Subjektivierung des Zwangs bereitet nach meiner Erfahrung vielen Freiheitsfreunden erhebliches Kopfzerbrechen. Das liegt daran, dass sie nicht Zwang, sondern Gewalt als den Gegenpol der Freiheit behandeln. Doch wer als Freiheitsfreund primär auf die Ächtung von Gewalt setzt, setzt freiheitstheoretisch aufs falsche Pferd.
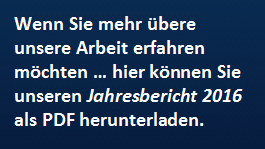 Was ist denn an der Ächtung von Gewalt unplausibel?
Was ist denn an der Ächtung von Gewalt unplausibel?
Der Zusammenhang zwischen Gewalt und Freiheit ist weit lockerer, als viele meinen: Zweifellos sehen sich Akteure in vielen Fällen dadurch, dass ihnen durch fremdes Tun Gewalt widerfährt, an der Realisierung ihres Wollens gehindert (und sind folglich unfrei). Gleichwohl gibt es klare Ausnahmen, die trotz ihrer Seltenheit belegen, dass das Erleiden von Gewalt nicht immer eine Wollensbeugung und mithin eine Freiheitsminderung darstellt. Selbstschädigung bis hin zum Tod kann durchaus gewollt werden, und wem es gelingt – etwa durch geeignete Provokationen – das gewaltsame Tun anderer Akteure seinem Wollen dienstbar zu machen, der hat von seiner Handlungsfreiheit einen vielleicht ungewöhnlichen Gebrauch gemacht, sie durch die betreffende Gewalteinwirkung jedoch ganz sicher nicht eingebüßt. Fälle von Verzweifelten, die den Tod in der Schlacht oder im Duell gesucht haben, mögen unalltäglich sein, doch wir können sie nicht deswegen einfach willkürlich aus der Welt hinausdefinieren. – Offenbar ist das Vorliegen von Gewalt also nicht hinreichend, um eine Beeinträchtigung der Freiheit zu begründen.
Zudem ist Gewalt noch nicht einmal notwendig dafür, dass sich jemand an der Realisierung seines Wollens gehindert sieht. Manchmal genügt schon ein Blick, eine bedeutungsvoll gehobene Augenbraue oder ein besonderer Tonfall, um jemanden zu zwingen, von seiner Wollensverwirklichung abzulassen (und zwar ohne dass in solchem Tun die Ankündigung künftiger Gewaltanwendung läge!). Einfach zu behaupten, das alles seien keine Fälle echten Zwangs bzw. keine ernstzunehmenden Freiheitsbeeinträchtigungen, ist nicht bloß apsychologisch und lebensfremd; es ist vor allem auch theoretisch unbefriedigend, denn es kommt einer vom Himmel fallenden normativen Setzung gleich, die anderen vorschreibt, wodurch sie sich gezwungen sehen dürfen und wodurch nicht. Wer sich hingegen wertfrei an die vorfindlichen Fakten des gesellschaftlichen Zusammenlebens hält, muss einräumen, dass jedes denkbare Tun, also auch gewaltfreies Tun, prinzipiell dazu taugt, auf andere Zwang auszuüben.
Dass manche psychologisch sensibleren Freiheitsfreunde den Gewaltbegriff weiter fassen – etwa so, dass zum Beispiel jemanden anzuschreien als „verbale Gewalt“ gilt -, zeigt ganz deutlich die Verlegenheit, in die man gerät, wenn man versucht, in roher physischer Gewalt den Gegenpol der Freiheit auszumachen. Auch die gängige Behandlung von Gewaltandrohung als Form der Gewalt ist ein Indiz derselben Verlegenheit.
Wenn nun, wie gezeigt, die Ausübung von Gewalt weder notwendig noch hinreichend dafür ist, jemandes Freiheit einzuschränken, dann ist Gewalt (ungeachtet ihrer Relevanz für die Beurteilung politisch-praktischer Kontexte) für das Verständnis von Freiheit in theoretischer Hinsicht schlechterdings irrelevant.
Freiheitsfreunde sollten also den Zwang ächten?
Wenn es nur so einfach wäre! Da wir eben gesehen haben, dass schon das Heben einer Augenbraue die Ausübung von Zwang sein kann, ist die vollständige Ächtung von Zwang weder plausibel noch praktikabel. Man wird sich daher wohl oder übel von der Utopie vollkommener Freiheit verabschieden müssen, von der Utopie einer Welt ohne Zwang. Denn vollkommen frei ist man allenfalls als Robinson. Wo sich hingegen die Wirkungskreise von Akteuren überschneiden, lässt sich das Auftreten von Zwang niemals ausschließen.
Wer ein zu simples Verständnis von Zwang hat, hat auch ein zu simples Verständnis von Freiheit, und wer das eine korrigiert, muss auch das andere korrigieren. Bei der Klärung und Korrektur des keineswegs trivialen Wechselverhältnisses von Freiheit und Zwang kann uns das folgende zweiteilige Gedankenexperiment helfen.
(i) Wird in einer Gesellschaft kein Akteur jemals durch eine überpersonale Zwangsinstanz (wie den Staat oder eine private Sicherheitsagentur) daran gehindert zu tun, was ihm beliebt, dann befindet sich diese Gesellschaft in dem (von Hobbes und anderen so genannten) Naturzustand. In ihm sind dem Zwang, der von jedermanns Tun ausgehen kann, keinerlei Grenzen gezogen. Die Naturzustandsgesellschaft ist mithin eine Gesellschaft, in welcher es – wegen der Unkalkulierbarkeit des Auftretens von Zwang – letztlich von glücklichen Zufällen abhängt, ob man seine Ziele verwirklichen, also erfolgreich handeln kann.
Unvorhersehbarer Zwang bedroht dabei nicht bloß den Erfolg isolierten Handelns, sondern auch den Erfolg kooperativen Handelns. Damit gerät aber gerade der Vorteil in Gefahr, um dessentwillen Akteure das Leben in Gesellschaft der ungeschmälerten Handlungsfreiheit Robinsons selbst dann vorzögen, wenn ihnen Einsamkeit gleichgültig wäre. Für jeden Akteur ist nämlich ein Leben in Gesellschaft attraktiver als ein isoliertes, sofern und solange er den Nutzen möglicher Kooperationen höher veranschlagt als die Nachteile möglicher Zwangserleidung. Diese Bilanz wird jedoch in einer Naturzustandsgesellschaft, die dem Auftreten von Zwang nichts entgegenzusetzen hat, unvermeidlich negativ. Eine Naturzustandsgesellschaft ist somit aus Sicht erfolgsbedachter Akteure – und zwar ganz gleich, worin sie ihren Erfolg suchen – eine extrem ungünstige Handlungsumgebung.
(ii) Zur Naturzustandsgesellschaft lässt sich ein (zwar fiktives, aber instruktives) Gegenmodell entwerfen: die Vetogesellschaft. In ihr kann jeder eine überpersonale Zwangsinstanz (wie den Staat oder eine private Sicherheitsagentur) zu Hilfe rufen, um andere an jedem Tun hindern zu lassen, durch welches er sich an seinem eigenen Tun gehindert sieht. Auf diese Weise würde in einer Vetogesellschaft jede Zwangsausübung – mit Ausnahme jener Zwangsausübung, die für die Vetorealisierung unabdingbar ist – vollständig vereitelt.
Da nun aber von keinem Tun je ausgeschlossen werden kann, dass es Zwang ausübt (nämlich immer dann, wenn es den Grund dafür darstellt, dass ein anderer von seiner Wollensrealisierung Abstand nimmt), ist in einer Vetogesellschaft jedes Tun von seiner zwangsweisen Verhinderung bedroht. Solche Verhinderung ihres Tuns durch das Veto anderer in der Vetogesellschaft ist für Akteure ähnlich unvorhersehbar wie die Verhinderung ihres Tuns durch den Zwang anderer in der Naturzustandsgesellschaft. Deshalb ist die Vetogesellschaft aus Sicht erfolgsbedachter Akteure eine nicht minder ungünstige Handlungsumgebung als die Naturzustandsgesellschaft.
Was ist das Resultat unseres zweiteiligen Gedankenexperiments? Offenbar dies: Systematisch erfolgreiches Handeln – d.h. ein Handeln, das nicht auf glückliche Zufälle angewiesen ist – ist weder im Naturzustand noch in der Vetogesellschaft möglich. Im Naturzustand ist Handlungsfreiheit durch unvorhersehbaren direkten Zwang bedroht, in der Vetogesellschaft durch den unvorhersehbaren indirekten Zwang, der sich aus den Einspruchsmöglichkeiten jedermanns gegen jedes Tun ergibt.
Sie meinen also, wenn Zwang schon unvermeidlich ist, dann sollte er wenigstens vorhersehbar sein?
In der Tat: Wenn ein Zwang, weil er regelgeleitet ausgeübt wird, vorhersehbar ist, können sich Akteure darauf einrichten und zum Misserfolg verurteilte Handlungsversuche unterlassen. Wenn jedoch ein gleichartiger Zwang überraschend ausgeübt wird, wird der dadurch bewirkte Schaden subjektiv größer sein, weil nicht nur der intendierte Handlungserfolg ausbleibt, sondern auch noch unnütze Kosten entstehen. Daher werden Akteure eine Umgebung, in der die Ausübung von Zwang erkennbaren Regeln folgt und damit vorhersehbar ist, einer Umgebung vorziehen, in der die Ausübung von Zwang regellos geschieht und somit unvorhersehbar ist.
Diese Überlegung stellt keine empirische Spekulation dar, sondern sie fußt auf einem Grund, der in der Natur des Handelns liegt: Man handelt nämlich nur, wenn man glaubt bzw. erwartet, damit Erfolg zu haben. Naturzustands- und Vetogesellschaft haben wir als diejenigen Gesellschaften eingeführt, in denen Zwang weniger regelgeleitet und mithin unvorhersehbarer ist als in allen Gesellschaften, die in dieser Hinsicht zwischen den Extremen liegen. Damit findet die Erwartung, erfolgreich handeln zu können, auch in einer jeden solchen ‚Zwischengesellschaft‘ einen vergleichsweise besseren Nährboden vor. Akteure werden sie daher den beiden Extremgesellschaften vorziehen.
Dass regelgeleiteter Zwang gewisse Vorzüge gegenüber regellosem Zwang hat, leuchtet ein. Aber auch von regelgeleitetem Zwang ist zu erwarten, dass er die Freiheit beeinträchtigt. Deshalb kommt es doch wohl darauf an, welche Regeln zwangsweise durchgesetzt werden und es stellt sich die Frage: Welche Regeln sind die richtigen Regeln für eine freie Gesellschaft?
Meine Antwort dürfte manchen überraschen. Denn das Kriterium der ‚Richtigkeit‘ von Regeln sehe ich nicht in ihrem Inhalt, sondern in der Art und Weise ihres Zustandekommens. Ich sage also nicht, so-und-so müssen die richtigen Regeln lauten. Vielmehr halte ich danach Ausschau, ob sie aus wiederholtem, freiwilligem Handeln hervorgegangen sind. Regeln können nämlich auch dann Geltung erlangen, wenn sie nicht ausdrücklich verabredet worden sind. Sie können einfach das evolutionäre Resultat von Handlungs- und Unterlassungsgepflogenheiten sein, die Akteure aus freien Stücken entwickeln, und zwar für gewöhnlich aus dem Grund, dadurch den eigenen Handlungserfolg zu befördern. Findet eine solche Handlungsgepflogenheit in einer Gesellschaft im Laufe der Zeit eine genügend große Anhängerschaft, wird sie also von immer mehr Akteuren freiwillig eingehalten, so verfestigt sie sich zunächst zu einer sozialen Konvention und wird dann mitunter zusätzlich in positives (und zwangsweise durchgesetztes) Recht überführt.
Der Drang vieler Freiheitsfreunde, die von Ihnen gestellte Frage in substantieller Weise zu beantworten, ist wohl der Hauptgrund dafür, dass sie nach inhaltlichen Kriterien für die Regeln suchen, die einer freien Gesellschaft angemessen sind. Und in der Tat ist ja von manchen Regeln hochplausibel, dass sie sich tatsächlich entwickeln werden. Da jeder Akteur seinen Handlungserfolg will und da die meisten Akteure in Mord und Raub eine Bedrohung ihres Handlungserfolgs sehen, werden sich vermutlich Gepflogenheiten herausbilden, die diese Bedrohung tendenziell mindern. Ein besonders naheliegender Beitrag zur Herausbildung von Gepflogenheiten, die Mord und Raub das Wasser abgraben, ist der Verzicht darauf, andere mit Mord und Raub zu überziehen (und solch ein eigener Beitrag liegt natürlich umso näher, je stärker ein Akteur glaubt, seinen Handlungserfolg durch friedliche Kooperation und Arbeitsteilung befördern zu können). Man kann es daher für empirisch wahrscheinlich halten, dass sich in Gesellschaften die Regel entwickelt, andere nicht zu attackieren oder zu bestehlen – zumindest dann, wenn die Gesellschaftsmitglieder die Aussicht auf wechselseitige Regelbeachtung als günstig einschätzen.
Gleichwohl halte ich es für einen Vorzug meiner nicht-inhaltlichen, formalen Antwort, dass ihre Triftigkeit weder davon abhängt, genau welche Ziele Akteure de facto anstreben, noch davon, durch genau welches Handeln anderer sie sich Zwang angetan sehen. Angesichts der großen Unterschiede zwischen Individuen scheint es mir ganz folgerichtig, dass die definitive Auskunft darüber, welchen Zwang jemand hinzunehmen hat und welchen er nicht hinzunehmen braucht, nicht von der Freiheitstheorie kommen kann, sondern dass sie letztlich aus dem tatsächlich stattfindenden freiwilligen Handeln hervorgeht, hinter dem das Wollen der beteiligten Akteure steht. Das ist, nebenbei bemerkt, die gehaltvollste Deutung, die ich dem Gemeinplatz geben kann, dass die Freiheit des einen da endet, wo die des anderen beginnt.
Die Ächtung von Mord und Raub wird in der von Ihnen favorisierten Freiheitstheorie also weder gefordert noch vorausgesetzt, aber immerhin wahrscheinlich gemacht. Wenn aber Zwang so subjektiv ist, wie Sie betonen, dann benötigen Gesellschaften doch sicher sehr viele Regeln, um den Zwang zu minimieren; wie stellen Sie sich das konkret vor?
Um hier Klarheit zu schaffen, muss ich nochmals ein wenig ausholen. Verlassen wir vorläufig das Szenario der evolutionären Regeletablierung und betrachten wir zunächst einen einfachen Fall der expliziten Regelsetzung. Angenommen, Karl darf für das Haus, in dem er zusammen mit anderen wohnt, festlegen, wann man geräuschvollen (für die Mitbewohner hörbaren und sie vielleicht störenden) Tätigkeiten nachgehen darf und wann nicht. Dabei steht Karl unter der Bedingung, dass jede Regel, die er festlegt, auch für ihn selbst gilt bzw. dass die Einhaltung der Regel von allen Hausbewohnern gleichermaßem erzwungen werden kann. Und damit unser Fall lebensnah ist, stellen wir uns Karl als jemanden vor, der weder gänzlich lärmunempfindlich noch hyperaltruistisch ist: Er möchte also manchmal seine Ruhe haben, manchmal aber auch ohne Rücksicht auf andere einer geräuschvollen Tätigkeit nachgehen.
Natürlich können wir ohne nähere Kenntnisse über Karl nicht wissen, welche Regel er festlegen wird. Dennoch können wir die Bahnen formal charakterisieren, in denen Karl sich bei seiner Regelfindung bewegt. Das können wir deshalb, weil Karls Regelsetzung ein Handeln darstellt, von welchem wir wissen, dass es nur stattfindet, wenn er erwartet, dass sich durch sein Handeln seine Situation verbessert (also ein subjektiver Gewinn für ihn entsteht). Als ein von seiner Lärmschutzregel selbst Betroffener muss Karl zwei Quellen des ihm möglicherweise widerfahrenden Zwangs gewichten und gegeneinander abwägen: (i) Wenn er innerhalb der von ihm festgelegten Ruhezeiten geräuschvoll tätig werden möchte, ist er dem Zwang ausgesetzt, den er in der – dann zulässigen – Berufung seiner Mitbewohner auf das Lärmverbot sieht. (ii) Wenn er außerhalb der von ihm festgelegten Ruhezeiten seine Ruhe haben möchte, ist er dem Zwang ausgesetzt, den er in den – dann zulässigen – geräuschvollen Tätigkeiten seiner Mitbewohner sieht.
Ersichtlich enthalten beide Auswirkungen der Regel ein Zwangspotential für Karl, und zwar eines, das in seinen Augen kostenträchtig ist. Ebenso ersichtlich enthalten beide Auswirkungen der Regel freilich auch ein Zwangspotential für seine Mitbewohner, und zwar eines, das in Karls Augen nutzenträchtig ist. Karl wird daher die Regel so festlegen, dass ihr inhärentes Nutzenpotential das ihr ebenfalls inhärente Kostenpotential in seinen Augen überwiegt: So würden beispielsweise längere als von Karl festgelegte Lärmschutzzeiten ihm zwar den zusätzlichen Zwang ersparen, den er von geräuschvollen Tätigkeiten seiner Mitbewohner ausgehen sieht; dafür aber würde sich zusätzlicher, Karls eigene geräuschvolle Tätigkeiten einschränkender Zwang einstellen (dasselbe würde für kürzere Lärmschutzzeiten in entsprechender Umkehrung gelten).
Obwohl also für Karl jede denkbare Regel (mit den beiden praktisch vernachlässigbaren Ausnahmen, dass er völlig lärmunempfindlich oder hyperaltruistisch ist) zwei Zwangsquellen enthält, steht Karl nicht allen Regeln indifferent gegenüber; manchen Regeln (im einfachsten Fall sogar nur einer einzigen) wird er deshalb den Vorzug geben, weil für sie seine persönliche Zwangsbilanz besser ist als für die alternativen Regeln, nämlich die Bilanz aus Nutzen und Kosten, die Karl von der Einhaltung der Regel erwartet: Als Nutzen liegt dabei in der Waagschale einerseits die Aussicht darauf, zu den von ihm festgelegten Ruhezeiten vom Lärm anderer verschont zu bleiben, sowie andererseits die Lizenz, zu den komplementären Zeiten selbst ungestraft Lärm machen zu dürfen. Als Kosten liegt demgegenüber in der Waagschale einerseits der Zwang, zu den von ihm festgelegten Ruhezeiten keinen Lärm zu machen, sowie andererseits der Zwang, den andere ihm in den komplementären Zeiten durch ihren Lärm antun.
Kehren wir nun zurück zur evolutionären Regeletablierung, konzentrieren uns aber weiterhin auf den Beispielsbereich des Lärmschutzes. Wie gesagt, entstehen Regeln durch wiederholtes freiwilliges kooperatives Handeln. Da allen Akteuren an der Minimierung des Zwangs liegt, dem sie selbst ausgesetzt sind, wären ihnen Kooperationspartner besonders willkommen, die sich freiwillig auf genau diejenigen Regeln einlassen, die sie selbst festsetzen würden, wenn sie darüber bestimmen dürften.
Angesichts der Subjektivität des Zwangs ist nun aber empirisch mit erheblichen intersubjektiven Unterschieden hinsichtlich der individuellen Zwangsbilanzen zu rechnen – und damit auch hinsichtlich der Regeln, die Akteure am liebsten in Geltung sähen. Aus diesem Grund spielt es eine große Rolle, mit welchen Akteuren man kooperiert: Kooperieren Akteure, die hinsichtlich ihrer Zwangs- bzw. Kostensensitivität gegenüber eigenem und fremdem Lärmmachen weit auseinanderliegen, so werden die sich daraus entwickelnden Regeln aus Sicht der Beteiligten notwendig kostenträchtiger sein, als wenn sie ceteris paribus in der genannten Hinsicht nahe beieinanderliegen. (Das ändert freilich nichts daran, dass auch solche kostenintensiven freiwilligen Kooperationen – wie alle freiwilligen Kooperationen – für beide Kooperateure vorteilhaft sind.) Untereinander können sich die Lärmempfindlichen, denen wenig am Lärmmachen gelegen ist, auf eine Hausordnung einigen, die in ihrer aller Augen weniger Zwangspotential enthält, als wenn sie sich mit Lärmunempfindlichen und gerne Lärmmachenden auf eine Hausordnung einigen müssten.
Ganz generell können wir festhalten: Zum Zwecke der Minimierung subjektiven Zwangs zieht jeder Akteur ceteris paribus solche Kooperationspartner vor, deren Zwangssensitivität seiner eigenen so ähnelt, dass sie tendenziell dieselben Regeln festlegen würden wie er selbst. Da sich – wie unser Lärmbeispiel exemplarisch vor Augen geführt hat – aus jeder Regel eine subjektiv-individuelle Zwangsbilanz ergibt, wäre ein Zwangsbilanz-„Zwilling“ für jeden Akteur ein idealer Partner der kooperativen Regeletablierung.
Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die folgende Entwicklung eine gewisse Wahrscheinlichkeit hätte, wenn Akteure ihr soziales Miteinander freiwillig und ohne Interventionen selbst organisieren könnten: Es würde sich ein reich gegliedertes föderatives System von Kooperationsgemeinschaften herausbilden, die durch komplexe Bündel von ähnlichen Zwangsbilanzen bezüglich der jeweils als zentral erachteten Regeln des Zusammenlebens gekennzeichnet wären. Diese Gemeinschaften samt der in ihnen geltenden Regelsysteme würden untereinander im Wettbewerb um die Einbeziehung weiterer Akteure stehen, so dass diese Akteure die Wahl hätten, welcher Gemeinschaft mit ihren (freiwillig etablierten) Regeln sie sich anschließen wollen – freilich um den Preis der Anerkenntnis der dort geltenden Regeln, auf deren Einhaltung die jeweilige Gemeinschaft pochen würde. Dabei ist davon auszugehen, dass jede Regelgemeinschaft Zwangsmaßnahmen zur Durchsetzung ihrer Regeln bereithält. (Ein in der Realisierung befindliches Modell, dass unserem Gedankenspiel nahekommt, ist das private-cities-Projekt von Titus Gebel, in welchem der Weg in die Gemeinschaft über das Akzeptieren eines Vertrags führt, der elementare Regeln des Zusammenlebens festlegt und der ansonsten der Freiheit des einzelnen Akteurs keine weiteren Schranken auferlegt; eine exit option in Gestalt einer Vertragskündigung ist prinzipiell vorhanden; sie geht jedoch mit der Nötigung einher, die Gemeinschaft wieder zu verlassen.)
Langer Rede kurzer Sinn: Freie Gemeinschaftsbildung (welche vor allem durch die weltweite massive Bekämpfung von Sezessionsbestrebungen verhindert wird) ist der Schlüssel zum optimalen Abbau von Zwang. Denn nach diesem Prinzip stößt jeder Akteur mit seinem Willen, den auf ihn ausgeübten Zwang zu minimieren, lediglich auf die Grenzen, die ihm durch den analogen Willen der anderen gezogen werden. Trotz der Allgegenwart subjektiven Zwangs können Akteure auf diese Weise ihr Zusammenleben erträglich gestalten – erträglicher jedenfalls als in jedem gesellschaftlichen System, in welchem ein Staat in doppelter Hinsicht Zwang anwendet: einerseits zur Durchsetzung von Regeln, die sich nicht in freiwilliger Kooperation (als zwangsminimierende Regeln) etabliert haben, und andererseits zur Einschränkung der Möglichkeit, sich mit ähnlich zwangssensitiven Partnern zur freiwilligen Regeletablierung zusammenzuschließen.
Dass Freiheit die Abwesenheit von Zwang ist, ist eine alte, aber in ihrer pauschalen Formulierung wenig aufschlussreiche Einsicht. Erst in einer Rekonstruktion, welche – in konsequenter Ausfaltung der Misesʼschen Praxeologie – der Subjektivität des Zwangs ohne Wenn und Aber Rechnung trägt, zeigt sich, was diese Einsicht eigentlich besagt.
Vielen Dank, Herr Professor Puster.
*****
Das Interview wurde per email geführt. Die Fragen stellte Andreas Marquart.
—————————————————————————————————————————————————————————–
Professor Dr. Rolf W. Puster ist Professor für Philosophie an der Universität Hamburg. Dort hat er zusammen mit seinem Kollegen Dr. Michael Oliva Córdoba das „Theory of Freedom Research Project“ gegründet, auf dessen Agenda eine neuartige, nämlich philosophische Erschließung des Werks von Ludwig von Mises einen herausragenden Platz einnimmt. Diese – maßgeblich von Oliva Córdoba entwickelte – „Hamburger Deutung“ der Mises’schen Praxeologie ist in den letzten Jahren zu einer zentralen Inspirationsquelle für Pusters philosophische Arbeit geworden.
*****
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Institut Deutschland wieder.