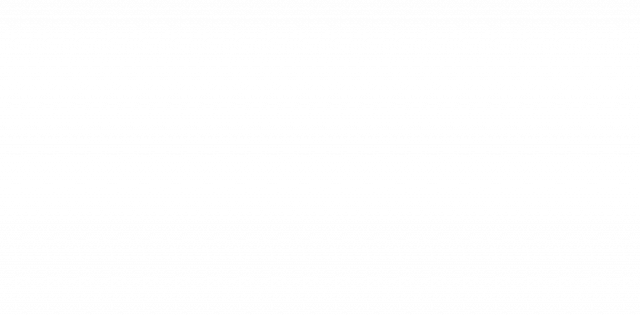Die Vorteile privater Währungen und der Weg dorthin
30.11.2012 – von Michael Rasch und Michael Ferber.
«Freiheit ist Sklaverei», hieß eine Maxime des Wahrheitsministeriums in George Orwells Überwachungsroman 1984. Das war natürlich schon damals Fiktion, doch kann es in der Realität tatsächlich anstrengend sein, die Freiheit zu haben, zwischen verschiedenen Möglichkeiten wählen zu dürfen. Die Menschen in Demokratien haben diese Anstrengung in den letzten Jahrzehnten jedoch zu schätzen gelernt. Das gilt besonders für die Freiheit, zwischen den Gütern und Dienstleistungen verschiedener Anbieter wählen zu können. In einem Bereich gilt das jedoch nicht. In fast allen freien, demokratischen Ländern gibt es noch «Zwangsgeld», d.h. nur eine einzige, als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannte Währung.
Die segensreichen Wirkungen des Wettbewerbs haben sich letztlich in immer mehr Branchen durchgesetzt. Die freie Wahl zwischen verschiedenen privaten Angeboten führt in aller Regel zu besseren Produkten mit einem höheren Nutzen für die Kunden, als staatlich orchestrierte Planung. So wurden staatliche Monopolfirmen wie die Bahn, die Post, die Telekommunikation oder Fluggesellschaften in vielen Ländern mit Erfolg privatisiert und dem Wettbewerb ausgesetzt. Beim Geld verteidigt der Staat sein Monopol jedoch bis aufs Messer, und für viele Menschen ist die Privatisierung kaum vorstellbar, ja geradezu eine absurde Idee. Der Staat hat weiterhin das Währungsmonopol. Doch das Verlangen nach der Privatisierung von Währungen nimmt in einem Umfeld nahezu grenzenloser Staatsschulden und auf Hochtouren laufender Gelddruckmaschinen der Zentralbanken zu.
Was ist Geld? Es ist das allseits akzeptierte Tauschmittel, weil es das Gut ist, das sich am besten und einfachsten gegen andere Güter tauschen lässt, da es gut transportierbar, lagerfähig und homogen ist. Dabei erfüllt Geld verschiedene Funktionen. Die Tauschfunktion gilt als die wichtigste Funktion, die Wertaufbewahrungs- und Recheneinheitsfunktion sind zudem wesentliche Unterfunktionen der Tauschfunktion. Sonst ist Geld aber ein Gut, wie jedes andere Gut auch. Beispielsweise gilt auch hier das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens – je mehr man davon hat, desto geringer ist der zusätzliche Nutzen. Steigt zudem die Menge des vorhandenen Geldes in einer Volkswirtschaft, sinkt bei sonst gleichbleibenden Bedingungen der Tauschwert. Auch beim Geld gelten also die Gesetze von Angebot und Nachfrage.
Der Zukunftsforscher John Naisbitt prognostiziert, dass Währungen früher oder später privatisiert werden. Der Durchbruch werde erfolgen, sobald die Menschen verstünden, dass Geld, ebenso wie beispielsweise Autos, Kühlschränke oder Fernseher, eine Ware sei. Zentralbanken würden in der Zukunft nicht mehr gebraucht, meint Naisbitt. Viele Befürworter der Privatisierung von Währungen unterscheiden zwischen «gutem» und «schlechtem» Geld. Laut Thorsten Polleit bildet sich gutes Geld im freien Wettbewerb, also durch Angebot und Nachfrage. Es stehe daher im Einklang mit den ökonomischen und ethischen Prinzipien einer Marktwirtschaft, da es die Eigentumsrechte aller Marktteilnehmer schütze. Schlechtes Geld sei hingegen Geld, das unter Verletzung der ökonomisch-ethischen Prinzipien einer Marktwirtschaft in Umlauf gebracht werde. Das staatliche Papiergeld sei also schlechtes Monopolgeld, so Polleit, weil es mit Privilegien ausgestattet sei und per Kreditvergabe durch Geschäftsbanken aus dem Nichts geschaffen werde, was ökonomisch gesehen einer legalisierten Geldfälschung gleichkomme. Die Privilegien des Staatsgeldes sind beispielsweise, dass es das einzige gesetzliche Zahlungsmittel ist, mit dem schließlich auch die Steuern und Abgaben entrichtet werden müssen. Laut Michael von Prollius, Gründer des Forums Ordnungspolitik und Koautor des Buchs Geldreform, beeinträchtigt schlechtes Geld zudem den Austausch von Gütern und Dienstleistungen und untergräbt die soziale Ordnung. Das Preissystem, das Herzstück der Marktwirtschaft, werde durch die Inflationspolitik gestört, und die Zinsen könnten ihre Koordinationsfunktion nicht mehr ausreichend wahrnehmen.
Der Staat kann jedoch noch nicht alle Gegenbewegungen unterbinden, denn im Prinzip läuft die Schaffung eines alternativen Geldsystems schon seit einigen Jahren. Anleger ersetzen Geld nämlich immer mehr durch Gold. Im wirtschaftlichen Boom der 1980er- und 1990er-Jahre wurde Gold vor allem als Edelmetall angesehen, und es geriet ein wenig in Vergessenheit, dass Gold nicht nur ein Rohstoff ist, sondern vor allem auch die ultimative Währung. Im Zuge der immer stärker steigenden Staatsverschuldung in vielen Ländern sowie vor allem durch die Finanzkrise und die laufenden Notenpressen der Zentralbanken kletterte der Goldpreis jedoch von 300 Dollar pro Unze im Jahr 2002 auf in der Spitze fast 2000 Dollar im Jahr 2011. Das Edelmetall entwickelte sich zu einer Versicherung gegen ausser Kontrolle geratene Regierungen und Zentralbanken. Allerdings erfüllt Gold derzeit vor allem eine Funktion von Geld, nämlich jene der Wertaufbewahrung, weniger hingegen die des Tauschmittels.
Seit Jahrzehnten neigen Zentralbanken zu einer chronischen Niedrigzinspolitik und weiten kontinuierlich die Geldmenge aus. Komme es zu einer Krise, versuchten die Notenbanker mit noch mehr Geld und noch niedrigeren Zinsen der Lage Herr zu werden, obwohl sie mit genau dieser Politik die Krise erst verursacht hätten, sagt Polleit. Allein seit US-Präsident Richard Nixon im Jahr 1971 die verbliebene Golddeckung der Weltleitwährung Dollar aufgab, hätten sich mehr als 100 Finanzkrisen ereignet. Die wesentliche Ursache der Krisen sei die massenhafte Liquidität, sagt Michael von Prollius. Die Liquidität habe ihren Ursprung im staatlichen Zentralbanksystem. Erst die Zentralbanken hätten eine unbegrenzte Vermehrung der Geldmenge ermöglicht, wobei die privaten Geschäftsbanken als Transmissionsakteur dienten. Zugleich bestehe aufgrund ähnlich gelagerter Interessen eine sehr enge Verbindung zwischen Big Government und Big Business.
Friedrich August von Hayek, Wirtschaftsnobelpreisträger und Schüler von Ludwig von Mises, – beide sind führende Vertreter der Österreichischen Schule der Nationalökonomie – forderte in seinem 1976 erschienenen Buch Denationalisation of Money ein Ende des staatlichen Geldangebotsmonopols und die Privatisierung des Geldsystems. Der Wettbewerb zwischen den privaten Geldern würde wie bei anderen Gütern für ein gutes Produkt, in dem Fall also für gutes Geld sorgen. Hayek wies ferner daraufhin, dass keine Behörde von vorneherein feststellen könnte, welches die optimale Geldmenge sei. Dies könne nur der Markt entdecken. Werde immer mehr Geld neu geschaffen, gebe es Gewinner und Verlierer. Diejenigen, die das neu geschaffene Geld als Erste erhielten, gehörten zu den Gewinnern, weil sie zu unveränderten Preisen kaufen könnten – und würden reicher. Diejenigen, die dagegen das neue Geld erst später oder überhaupt nicht bekämen, gehörten zu den Verlierern – und würden ärmer. Die Ausweitung der Geldmenge geht daher laut den Ökonomen der Österreichischen Schule stets mit einem Geldwertschwund und einer Umverteilung in der Bevölkerung einher.
Ludwig von Mises zeigte ferner, dass eine Ausweitung der Geldmenge durch die Vergabe von Bankkrediten, die nicht durch echte Ersparnisse gedeckt sind, – so wie es im heutigen Kredit- und Papiergeldsystem der Fall ist – notwendigerweise zu Fehlentwicklungen und Krisen führt. Die Erhöhung der Geldmenge per Kredit sei nämlich nicht nur inflationär, weil die damit finanzierbare Nachfrage das Angebot an Ressourcen übersteige. Die Ausweitung der Geldmenge senke die Marktzinsen künstlich und setze damit Investitionen in Gang, die sonst nicht realisiert worden wären und deren Erfolg davon abhänge, dass die Zinsen künstlich tief bleiben. Die Folgen davon seien Fehlinvestitionen, Spekulationswellen, Boom-and-Bust-Zyklen und Überschuldung, die zu einem Kollaps des Papiergeldsystems führen müssen – so jedenfalls die Theorie von Ludwig von Mises.
Erkennt man da Parallelen zur gegenwärtigen Entwicklung? Ja, denn genau die angeprangerte Ausweitung der Geldmenge passiert seit Jahren. In den USA hat sich die Geldmenge, gemessen an der Geldmengendefinition M2, allein seit dem Jahr 2000 mehr als verdoppelt. Das gleiche gilt für die Eurozone und auch für die Schweiz. Aufgrund des seit Jahrzehnten teilweise zweistelligen jährlichen Geldmengenwachstums bezeichnen Kritiker die Zentralbanken oft als Inflationsbehörden. Auch laut dem Austrian Economics Center ist eine wichtige Ursache der jüngsten Krise die Flut des billigen Geldes. Sie führe zu schlechten Investitionen, die dann in Zeiten der Krise korrigiert werden müssten. Erst beim Platzen einer Blase würden nämlich Investitionsfehler offenkundig, schreibt etwa Barbara Kolm in ihrer Präsentation Was die Konzepte der Austrians in der aktuellen Krise bringen. Die österreichische Lösung sei die Privatisierung des Geldes und die Einführung eines fixen Währungssystems, zum Beispiel mit einem Goldstandard, einer hundertprozentigen Deckung der Einlagen und einer Abschaffung der Zentralbanken. Letztere sind nicht unbedingt eine Erfindung von Kapitalisten, sondern ihre Installation wurde auch im kommunistischen Manifest gefordert, das Karl Marx und Friedrich Engels um die Jahreswende 1847/48 verfassten.
Für Norbert F. Tofall liegen die tieferen Ursachen der Finanzkrise daher ebenfalls im herrschenden Geldsystem und dem staatlichen Papiergeldmonopol, in dem Geld und Kredite aus dem Nichts geschöpft werden. Das staatliche Geldsystem sei ein Schneeballsystem aus ungedeckten, künftigen Zahlungsversprechungen, schreibt Tofall in einem Beitrag für das Liberale Institut Zürich, und werde wie jedes Schneeballsystem früher oder später zusammenbrechen. Für den wissenschaftlichen Mitarbeiter des Bundestagsabgeordneten und «FDP-Rebellen» Frank Schäffler soll durch den Einstieg in die monetäre Planwirtschaft dieser Zusammenbruch möglichst weit in die Zukunft verschoben werden, damit man nicht über die möglichen Alternativen nachdenken muss. Die Alternative wäre für die Regierungen und die staatlichen Zentralbanken auch unerfreulich. Sie bestünde nämlich in einer marktwirtschaftlichen Geldordnung und in der Zulassung eines allumfassenden Währungswettbewerbs.
Um Geld tatsächlich dem Wettbewerb auszusetzen und zu privatisieren, müsste der Staat als Erstes sein Monopol aufgeben, also jene Gesetzesklauseln abschaffen, die die jeweilige Währung eines Landes zum einzigen zugelassenen Zahlungsmittel bestimmt. In der Europäischen Union ist dies beispielsweise im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) geregelt. Gemäss Artikel 128 sind die von der Europäischen Zentralbank ausgegebenen Banknoten die einzigen Banknoten, die in der Währungsunion als gesetzliches Zahlungsmittel gelten. Sollte der Staat sein Geldmonopol dereinst tatsächlich aufgeben, läge es dann an den Marktteilnehmern, etwas daraus zu machen, sagt Thorsten Polleit. Eine Alternativwährung brauchte als Erstes wohl eine gewisse Popularisierung, also eine steigende Anerkennung und Wahrnehmung innerhalb der Bevölkerung. Befürworter einer Privatisierung des Geldes erhoffen sich dabei bereits vom Auftreten ernst zu nehmender Wettbewerber für den Euro bzw. von der Zulassung privater Geldproduktion eine disziplinierende Wirkung auf den Rat der Europäischen Zentralbank. Wettbewerb ist schliesslich der beste Regulator. Das Gleiche würde im Prinzip auch für andere Währungsräume und ihre Notenbanken gelten, wie beispielsweise die USA und die Schweiz. Erst Ende Juli 2012 hat die Europäische Zentralbank unter ihrem italienischen Präsidenten Mario Draghi mehr oder weniger unverhohlen angekündigt, erneut Staatsanleihen von Krisenländern kaufen zu wollen. Diesem Anliegen stehen Vertreter der Deutschen Bundesbank äusserst skeptisch gegenüber, liegt doch der Verdacht nahe, dass es sich um eine strikt verbotene Staatsfinanzierung durch die Hintertür handelt.
Nach der Aufgabe des Geldangebotsmonopols, sagen die Befürworter des Währungswettbewerbs, müssten die Verbindlichkeiten der Banken in einem festen Umtauschverhältnis an das Gold gebunden werden, das noch im Besitz der Zentralbanken ist. Dann würde den Geldbesitzern das Recht eingeräumt, ihre Bankguthaben jederzeit in Gold tauschen zu dürfen. Das hätte den Vorteil, sagt Polleit, dass Bankenpleiten nicht mehr die volkswirtschaftliche Geldmenge vermindern würden und Steuerzahler nicht mehr für die Verluste der Banken haften und somit bezahlen müssten. Danach könnte man das Geldsystem privatisieren und ein «free banking» schaffen, sodass die Menschen ihr Zahlungsmittel frei wählen und vertraglich vereinbaren könnten. Dann herrschte eine Freiheit der Geldwahl, wie bei allen anderen Gütern.
Welches Geld sich dann durchsetzen würde, ist offen. Vermutlich würde jedoch einmal mehr Geld mit einer Gold- oder Silberdeckung der neue Marktstandard, so wie es in der Geschichte über viele Jahrhunderte der Fall war. Das würde auch in die Theorie von Carl Menger passen. Laut dem Gründer der Österreichischen Schule entsteht Geld in einem freien Marktprozess notwendigerweise aus einem Sachgut, das aufgrund seiner Eigenschaften schon geschätzt wurde, bevor es sich in Geld verwandelte. Die gilt beispielsweise für Gold, Silber und andere Metalle. Zentralbanken würden dabei die Hoheit über das Geld verlieren und vermutlich durch privat organisierte Einlagensicherungsfonds ersetzt.
—————————————————————————————————————————————————————————
aus “DIE HEIMLICHE ENTEIGNUNG – So schützen Sie Ihr Geld vor Politikern und Bankern”.
Das Buch, das die beiden NZZ-Wirtschafts- und -Finanzmarkt-Journalisten Michael Rasch und Michael Ferber zur Finanz-, Banken- und Schuldenkrise geschrieben haben, richtet sich vor allem an Bürger und Anleger, um ihnen die Hintergründe und Gefahren der Geldentwertung und der «finanziellen Repression» darzulegen. Der Inhalt des Buches beruht zu einem guten Teil auf den Erfahrungen und Arbeiten der Autoren im Rahmen ihrer langjährigen Tätigkeit für die Zeitung.
Finanzbuchverlag, € 24,99, ISBN 978-3-89879-713-9
NZZ-Libro, Zürich 2012, Fr. 30.-
Foto Startseite: © Wilm Ihlenfeld – Fotolia.com