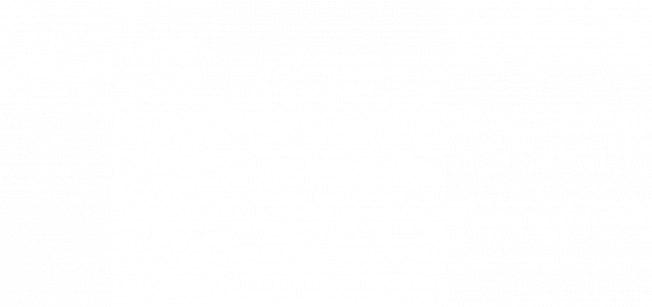Wider die Tobin-Steuer
25.1.2013 – von Guido Hülsmann.
Am 22. Januar 2013 haben die EU-Finanzminister die Pläne zur Einführung einer Kapitalverkehrssteuer bzw. Börsenumsatzsteuer in elf Mitgliedstaaten abgesegnet, nachdem der entsprechende Antrag bereits im Oktober letzten Jahres von der Brüsseler Kommission angenommen wurde. Mit dieser Börsensteuer soll die Spekulation auf den Finanzmärkten gedämpft werden, und ausserdem soll sie der EU (genauer gesagt: der Kommission) eine eigenständige Einkommensquelle erschließen.
Obwohl der französische Finanzminister gleich am nächsten Tag verlauten liess, dass mit der Einführung der Börsensteuer nicht vor dem Jahr 2015 zu rechnen sei, lohnt es sich bereits jetzt, zu diesem Thema ein paar grundsätzliche Bemerkungen zu machen.
Erinnern wir uns, dass es solche Steuern früher bereits in allen Mitgliedsstaaten der EU gab. Im Zuge der Umsetzung einer EG-Richtlinie vom 20. Dezember 1985 wurden diese Steuern dann in den meisten Mitgliedsstaaten abgeschafft, in Deutschland mit dem sogenannten „Ersten Finanzmarktförderungsgesetz“ aus dem Jahre 1991. In den USA wurde die bundesstaatliche Besteuerung der Börsenumsätze bereits 1966 abgeschafft (seitdem erfolgt nur noch eine Besteuerung durch die Einzelstaaten). Im Vereinigten Königreich besteht die aus dem Jahre 1694 stammende Börsensteuer nach wie vor, betrifft aber nur die Endkunden, nicht die Intermediäre.
Die traditionellen Kapitalverkehrssteuern hatten reine fiskalische Zwecke. Sie wurden beseitigt, als man sie staatlicherseits als zweckwidrig erkannte. Dabei muss man sich vor Augen halten, dass die allermeisten Umsätze auf den Finanzmärkten bei äußerst geringen Gewinnspannen erfolgen, die typischerweise im Bereich von geringen Bruchteilen eines Prozentes liegen. Selbst eine sehr niedrige Besteuerung, etwa im Promillebereich, zerstört diese Margen und führt somit zu drastischen Rückgängen des Gesamtumsatzes. Schweden machte diese schmerzhafte Erfahrung in den 80er Jahren. Von der erhöhten Börsenumsatzsteuer versprach man sich Mehreinnahmen von 1,5 Milliarden Kronen, aber es wurden nur 80 Millionen, da die Umsätze dramatisch zurückgingen. Nun mag man denken, dass auch 80 Millionen eine hübsche Summe sind und den Finanzmärkten eine kleine Verschlankung durchaus zum Guten gereicht. Dabei übersieht man allerdings den Zusammenhang zwischen Liquidität, Risiko und Zinsen. Je höher die Börsenumsätze, desto liquider die dort gehandelten Wertpapiere und desto geringer ist also das Risiko, diese Wertpapiere bei plötzlichem Bedarf nur unter starken Abschlägen veräußern zu können. Daher ist die in den Zinsen enthaltene Risikoprämie umso geringer je liquider der Markt ist. Der schwedische Staat machte seinerzeit die bittere Erfahrung, dass die Einnahmen von 80 Millionen aufgrund der höheren Börsenumsatzsteuer keine Nettoeinnahmen waren, sondern mit den höheren Zinsen auf die Staatsschulden verrechnet werden mussten.
Wenden wir diese Erwägungen auf die heutige Lage in Deutschland an. Von der Wiedereinführung einer Kapitalverkehrssteuer verspricht man sich Einnahmen von etwa 20 Milliarden Euro, und zwar unter der gleichen irrigen Annahme wie seinerzeit in Schweden, dass nämlich die Finanzmarktumsätze unter der Steuer nicht leiden. Die tatsächlichen Einnahmen dürften also zehnmal niedriger liegen (oder vielleicht sogar knapp zwanzig Mal niedriger, wie in Schweden). Aber selbst wenn sich die 20 Milliarden wie durch ein Wunder erzielen ließen, stünden uns immer noch höhere Zinsen ins Haus. Die Staatsverschuldung in Deutschland liegt zurzeit bei knapp 2.000 Milliarden Euro. Wenn also die Zinsen nur um ein Prozent stiegen, wäre der Ertrag der Kapitalverkehrssteuer bereits wieder zunichte gemacht. Aber selbst dieses neutrale Ergebnis gälte wie gesagt nur unter völlig realitätsfernen Annahmen. Tatsächlich hätte eine solche Steuer aller Wahrscheinlichkeit nach negative Auswirkungen auf die Haushaltslage des Bundes. Das Haushaltsloch würde sich natürlich umso stärker vergrößern, wenn die Einnahmen aus der neuen Steuer der EU-Kommission und nicht der Bundesregierung zuflössen.
Seit etwa vierzig Jahren werden Kapitalverkehrssteuern auch anders begründet als mit rein fiskalischen Erwägungen. 1972, inmitten des Zusammenbruchs des Systems von Bretton Woods, plädierte der amerikanische Ökonom und spätere Nobelpreisträger James Tobin unter Berufung auf seinen Lehrmeister Keynes dafür, mit Hilfe einer möglichst weltweiten Kapitalverkehrssteuer auf Devisengeschäfte die Spekulation einzudämmen und dadurch allzu starke Schwankungen der Wechselkurse zu verhindern. Diese Argumentation wurde in der Folge auch auf alle anderen Finanzmärkte angewandt und führte die Idee einer Besteuerung des Kapitalverkehrs unter dem Schlagwort der „Tobin-Steuer“ zu neuer Popularität. Heute wird sie mit einigem Nachdruck von der französischen Regierung vertreten. Auch die Bundesregierung scheint zunehmend auf diese Linie einzuschwenken, während die meisten deutschen Ökonomen weiterhin wohl eher der Auffassung zuneigen, es handele sich hier um eine Schnapsidee.
Die Fallstricke der Tobin’schen Argumentation sind in der Tat nur allzu offensichtlich. Sicherlich führt die Besteuerung des Kapitalverkehrs zu verringerten Finanzmarktumsätzen. Aber es ist überhaupt nicht klar, warum dies zu verringerten Schwankungen irgendwelcher Wertpapierkurse oder Devisenkurse führen sollte. Um eine Analogie zu bemühen: Wenn ein Arzt einer Mutter empfiehlt, das Fieber ihres Kindes nur einmal am Tag und nicht jede Stunde zu messen, so würde dies keineswegs die Schwankungen, sondern lediglich die Kenntnis über den augenblicklichen Stand der Temperatur verringern. Wenn überhaupt, so sind infolge von Kapitalverkehrssteuern stärkere Schwankungen der Finanzmarktkurse zu erwarten, da sich die Marktliquidität verschlechtert und Intermediäre somit nur bei höheren Margen tätig werden. Die Ergebnisse der bisherigen empirischen Studien zeigen mehrheitlich genau in diese Richtung.
Die Tobin-Steuer erfreut die blindwütigen Kämpfer gegen die Marktwirtschaft, und sie dient jenen, die noch mehr deutsche Steuergelder nach Brüssel abzweigen wollen. Genau aus diesen Gründen schadet sie allen anderen Menschen.
————————————————————————————————————————————————————————-
Jörg Guido Hülsmann ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirates des “Ludwig von Mises Institut Deutschland”. Er ist Professor für Ökonomie an der Universität Angers in Frankreich und Autor von «Ethik der Geldproduktion» (2007) und «Mises. The Last Knight of Liberalism» (2007).
Seine Website ist guidohulsmann.com