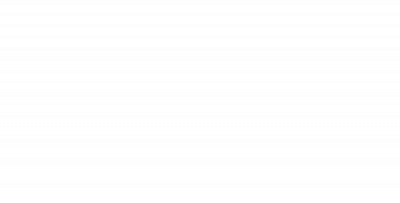Robert Nef: “Erzwungene Einfalt zerstört spontane Vielfalt.”
1.11.2012 – “Die europäische Politik sollte jede Tendenz zur imperialen und bürokratischen Großorganisation vermeiden.”
Robert Nef im Interview mit dem “Ludwig von Mises Insitut Deutschland”.
Herr Nef, lassen Sie uns zu Beginn einen Begriff definieren. Professor Habermann hat Sie in einem Buch als “wortmächtigen liberalen Publizisten” bezeichnet. Was ist für Sie “Liberalismus”?
Der Liberalismus ist jene Überzeugung, die dem Wert der Freiheit höchste Priorität gibt. Freiheit bedeutet die Abwesenheit von fremdbestimmendem Zwang und die Fähigkeit, seine Bindungen und Verbindlichkeiten selbst wählen zu können. Sie beginnt damit, dass man lernt, im richtigen Moment Nein zu sagen und findet ihren Fortgang durch selbstbestimmte Kommunikation und durch einvernehmlichen Tausch.
Eine Aussage von Ihnen: um die individuelle Freiheit zu verteidigen, ist es notwendig, die Politik in die Schranken zu weisen. Hayek forderte gar, die Politik zu entthronen. Was empfinden Sie, wenn Sie die Entwicklungen in Europa im Zusammenhang mit der Finanzkrise beobachten?
Ich empfinde die Bestätigung meiner Vermutung, dass sich Zwang und Tausch auf die Dauer nicht befriedigend koordinieren lassen. Das Zentralisieren und Harmonisieren durch politischen Zwang verschärft und vergrößert die Probleme, selbst wenn dieser Zwang durch temporäre Mehrheiten legitimiert ist, bzw. toleriert wird, weil es angeblich keine Alternative gibt. Ich meine allerdings nicht, dass demnächst „alles an die Wand knallt“. Das politische und wirtschaftliche Zusammenleben war stets krisenanfällig und in fast jeder Zeit gab es die Empfindung, man lebe in einer besonders spannungsreichen und gefährlichen Epoche. Die Chancen der Krisenbewältigung durch gemeinsames Lernen in kleineren Einheiten und durch schrittweises nonzentrales Problemlösen sind m.E. intakt.
Die Finanzkrise ist eine Krise des Korporatismus, d.h. jener Politik, die versucht politische Entscheidungen mit ökonomischen Entscheidungen zu koordinieren, zu harmonisieren und zu zentralisieren. Die Politik handhabt das staatliche Zwangsmonopol und die Marktökonomie beruht auf dem fremdherrschaftsfreien Tausch. Das sind zwei ihrem Wesen nach eigenständige Bereiche. Die Notwendigkeit von Zwang wird von jenen, die ihn handhaben (und oft zum Beruf gemacht haben) meist massiv überschätzt. Eine konsequentere Trennung von Politik einerseits Wirtschaft und Kultur anderseits und die Einschränkung der Politik auf die wirklich notwendige Ordnungs- und Friedensgewährleistung sind aus meiner Sicht die vordringlichsten liberalen Postulate. Weniger Politik als Zwangsmanagement und Zwangsumverteilung, kleinere politische Gebietskörperschaften und mehr Wirtschaft im Sinn der privatautonom tauschenden Kommunikation wäre für alle Betroffenen und Beteiligten von Vorteil, wenn auch nicht für alle gleich schnell und im gleichen Ausmaß.
Man versucht in Europa aber doch derzeit, die Probleme nicht nonzentral, sondern immer zentraler zu lösen?
Dieser Versuch ist nicht neu. Zentralismus ist in einer ersten Phase nicht unweigerlich zum Scheitern verurteilt. Die meisten Liberalen des 19. Jahrhunderts waren Zentralisten, weil sie hofften, vom Zentrum aus mehr Freiheit für alle gewährleisten zu können. Wenn tatsächlich die freiheitsfreundlichsten, vernünftigsten und effizientesten Leute zentral regieren, können viele Missbräuche, Doppelspurigkeiten und Leerläufe beseitigt werden. Ja, wenn…Die zentralen Regenten und ihre Apparate werden aber früher oder später von ihrer zentralen Macht korrumpiert. Sie verfallen dem Wahn der Vereinheitlichung und Angleichung, selbst dort wo die Unterschiede lebenswichtig wären, weil sie ein Lernen durch Vergleichen ermöglichen. Kurz: Ohne den Wettbewerb als permanentes nonzentrales Experimentieren für bessere Lösungen, verfetten und verdummen sie.
Der Zerfallsprozess kann Jahrzehnte, ja, Jahrhunderte dauern, ist aber nach allen bisherigen historischen Erfahrungen unvermeidlich. Wenn die politische Macht zentralisiert ist, werden meist auch die Medien, das Bildungswesen und die Wissenschaft zum Teil des Systems, und die zur Entgiftung der Macht notwendigen Gegenkräfte verkümmern selbst in demokratischen Strukturen.
Nicht wenige machen gerade die demokratischen Strukturen für Machtzentralisierung verantwortlich. Stimmen Sie dem zu?
Die Beobachtung, dass die Zentralisierung der Macht durch das Mehrheitsprinzip gefördert wird, ist zutreffend. Die These, Demokratie führe unweigerlich zu mehr Zentralismus, ist hingegen zu wenig differenziert. Mit dem Begriff „Demokratie“ werden sehr viele unterschiedliche politische Organisationsformen bezeichnet. Sogar der Markt als „tägliches Plebiszit“ bei dem eine große Zahl von Individuen privatautonom vielfältigste Entscheidungen treffen, ohne eine Einigkeit erzielen zu müssen, ist schon als demokratische Institution bezeichnet worden, wenn ich mich recht erinnere, von Ludwig von Mises. Anderseits werden auch Entscheidungsverfahren, die Einstimmigkeit voraussetzen oder anstreben bzw. „ohne Gegenstimme“ oder „ohne Veto“ beschließen, mit guten Gründen als Demokratie bezeichnet. In solchen Strukturen wird es kaum „automatisch“ zu mehr Zentralismus kommen. Jene Demokratie, die nach dem Prinzip „ein Mensch eine Stimme“, und „die einfache Mehrheit gibt den Ausschlag“ entscheidet, ist aus liberaler Sicht suspekt, weil schlimmstenfalls fast die Hälfte der Beteiligten bzw. Betroffenen fremdbestimmt wird. Das ist gemessen am Ziel einer möglichst hohen Selbstbestimmung keine gute Lösung, denn gerade der Wert der individuellen Selbstbestimmung wird oft von Mehrheiten unterschätzt.
Das Mehrheitsprinzip begünstigt tatsächlich die Zentralisierung, wobei vermutlich auch viele andere politökonomische Faktoren mitspielen. Offen ist die Frage, ob nicht auch die Exit option, d.h. das Recht, mit den Füssen abzustimmen, als „demokratisches Recht“ bezeichnet werden kann. Ein oft unterschätztes aber wichtiges demokratisches Recht ist die Kompetenz, über die Zugehörigkeit potentiell Mitbestimmender abstimmen zu können. Das verkompliziert die Fragestellung zusätzlich. Eine direkte kausale Verknüpfung von Demokratie und Zentralismus ist deshalb fragwürdig. Bestimmt gibt es diesbezüglich wesentliche Unterschiede zwischen direktdemokratischen und indirekt demokratischen Entscheidungsverfahren.
In politischen Systemen, die via Steuerprogression eine Umverteilung von reich zu arm praktizieren, führt das Mehrheitsprinzip früher oder später zu einer permanenten Überstimmung der relativ Reichen durch die relativ Armen, das heißt es findet jener Zerfallsprozess von Demokratie zur Ochlokratie (Herrschaft der unstrukturierten Masse) statt, der schon von Aristoteles beschrieben worden ist. Die unstrukturierte Masse wird nicht „immer mehr Zentralität“ fordern, sondern einen nationalen Gruppenegoismus durch entsprechende Feindbilder fördern und zum politischen Hauptziel erheben.
Sie sprechen das Thema “Umverteilung” an. Diese findet mittlerweile nicht mehr nur auf Ebene der Nationalstaaten, sondern zunehmend auch auf europäischer Ebene statt. Wie gefährlich könnte das für den “sozialen” Frieden in Europa werden?
Umverteilung ist ein Fass ohne Boden und fördert die allgemeine Unzufriedenheit. Jene, denen man zwangsweise etwas wegnimmt, finden es zuviel, jene denen man von Staates wegen etwas gibt, finden es zu wenig. Jene Bevölkerungsgruppe, die aufgrund ihrer Bedürftigkeit als Umverteilungsempfänger definiert wird, tendiert zur schrittweisen Erweiterung, weil es stets möglich ist, nachzuweisen, dass die Grenze zu Ungunsten von „tatsächlich auch noch Bedürftigen“ gezogen worden ist, die sich von der bereits definierten Gruppe nur marginal unterscheiden. Umverteilung von Personengruppe zu Personengruppe, d.h. von reichen zu armen Individuen verändert sich durch die Generationenfolge und durch die natürliche Begrenzung des Lebens. Die Abhängigkeit vom Umverteilungsstaat endet mit dem Tod. Sie wird nicht automatisch vererbt, weil es in einer mobilen Gesellschaft viele Individuen schaffen, aus der Umverteilungsfalle auszubrechen und ökonomische Eigenständigkeit zu begründen. Wenn es gelingt, die Umverteilungsspirale politökonomisch zu stabilisieren und das Ausmaß durch politische Entscheidungen einzuschränken, gefährdet sie den sozialen Frieden nicht. Sobald aber eine Mehrheit der Bevölkerung auf der Empfängerseite steht, kommt es zur Ausbeutung der Produktiven, und zu einem generellen Absinken der Produktivität. Interpersonelle Umverteilung ist wahrscheinlich nicht nachhaltig praktizierbar, aber es ist möglich, sie wenigstens zum Teil politisch „im Griff“ zu behalten.
Die interregionale Umverteilung, die nicht von reichen zu armen Personen, sondern von reichen zu armen Regionen geht, ist für den sozialen Frieden viel gefährlicher, weil sie eine große Zahl von falschen Anreizen setzt und die Abhängigkeit verschärft statt mildert. Die Abhängigkeit entsteht nicht zwischen sterblichen Personen, sondern zwischen dauerhaften Gebietskörperschaften. Sie wird so politisch zementiert. Es kommt zum Phänomen jener Entwicklungshilfe, das man satirisch schon wie folgt beschrieben hat: Man nimmt relativ armen Leuten einer reichen Region Geld weg, um es relativ reichen Leuten in armen Regionen zu geben. Die beidseitigen und allseitigen Frustrationen der an der regionalen Umverteilung Beteiligten (d.h. das bereits erwähnte permanente „Zuviel“ und „Zuwenig“), werden politisch thematisiert und führen früher oder später zu Spannungen, die den sozialen Frieden insgesamt ernsthaft gefährden.
In Ihren Buch “Lob des Non-Zentralismus” mahnen Sie zur “Lösung gemeinsamer Probleme auf der kleinstmöglichen Ebene” und warnen vor der “Flucht in den höheren Verband”. Welchen Rat geben Sie der europäischen Politik?
Die Europäische Union steht vor schwer lösbaren Problemen, die sie mit mehr Harmonisierung, mehr Zentralisierung und mehr gemeinsamer Regulierung lösen will. Dies steht im Widerspruch zur historischen Erfahrung, dass Europa als Kontinent weltweit eine führende Rolle spielen konnte, weil es seine interne Vielfalt nicht durch ein zentral geführtes Großreich unterdrückt hat. Ein vielfältiges Nebeneinander ermöglicht den friedlichen Wettbewerb und, was noch wichtiger ist, das gegenseitige Lernen aus Erfolgen und aus Fehlschlägen. Vielfalt hat auch ihren Preis, denn die jeweils schwächste und unfähigste Gebietskörperschaft ist schlechter als dies bei einem zentral geführten Großverband der Fall wäre. Bei offener Kommunikation kommt es aber zur Lern- und Anpassungsprozessen, die diese Schwäche mehr als kompensieren. Das politische Zusammenleben ist ein permanentes Experiment, in dem die jeweils optimale Lösung gesucht wird, die nicht für alle stets dieselbe ist.
In vielfältigen Systemen gibt es Vorreiter und Nachzügler, wobei sich langsamere Entwicklungen oft als nachhaltiger erweisen. Zudem eignen sich viele Lösungen für die eine Gebietskörperschaft besser als für die andere. Neben der gemeinsamen Suche nach der bestmöglichen Lösung durch Selbstbestimmung und Mitbestimmung, muss es für die Individuen die Möglichkeit geben, mit den Füssen abzustimmen, und die sogenannte Exit option wahrzunehmen. Diese wiederum muss mit der Möglichkeit kombiniert werden, über die Zugehörigkeit oder Nicht-Zugehörigkeit zu einer politischen Gemeinschaft, innerhalb dieser Gemeinschaft zu entscheiden. Sie bildet die Basis der Loyalität und der gegenseitigen Rücksichtnahme, die erfahrungsgemäß kleinräumig eher gewährleistet werden kann als großräumig.
Wenn es in einer ersten Phase der Zentralisierung gelingt, die Begabtesten und Fähigsten in den Dienst der Zentralen zu stellen, erweist sich Zentralisierung tatsächlich als effizient und erfolgreich. Dieser Erfolg ist aber durch eine schwer vermeidbare Degenerationstendenz mittel- und langfristig gefährdet. Die nachhaltige Ergänzung fähiger Eliten, die in der Zentralen eine rechtlich beschränkte politische Macht mit großer Weisheit und zur Zufriedenheit großer Mehrheiten ohne Unterdrückung von Minderheiten handhaben, ist, wie die historische Erfahrung zeigt, ein kaum lösbares Problem.
Zentrale Machtsysteme haben die Tendenz, diese Macht permanent auszudehnen. Wer die zentrale Macht hat, steht nicht mehr unter dem Druck des Vergleichens und des gegenseitigen Lernens, was, wie bereits erwähnt, zu einer schrittweisen Verdummung und Verfettung des Gesamtsystems führt. Das sind die langfristigen Kosten der Zentralisierung, die oft erst nach Jahrzehnten oder Jahrhunderten in Erscheinung treten. Der Zerfall großer, zentral geführter Imperien ist auf diesen schleichenden Verlust der Lern- und Anpassungsfähigkeit als Begleiterscheinung der Machtkonzentration zurückzuführen.
Die europäische Politik sollte jede Tendenz zur imperialen und bürokratischen Großorganisation vermeiden und sich auf jene kulturelle und politische Vielfalt zurückbesinnen, die ihr historisches Erfolgsgeheimnis gewesen ist, und die in diesem Kontinent bisher leider immer wieder durch kriegerische Auseinandersetzungen um eine zentral organisierte Vorherrschaft über andere gefährdet worden ist.
Vielen Dank, Herr Nef.
Das Interview wurde per e-mail geführt.
Die Fragen stellte Andreas Marquart, Ludwig von Mises Institut Deutschland.
———————————————————————————————————————————————————————-
Robert Nef, geboren 1942, ist Präsident des Stiftungsrats des Liberalen Instituts und der Stiftung für Abendländische Ethik und Kultur sowie des Vereins „Gesellschaft und Kirche wohin?“. Seine zahlreichen Publikationen befassen sich mit Grundsatzfragen der Politik und ihrem Verhältnis zur Wirtschaft und zur Ethik.
Bei Fragen erreichen Sie Robert Nef unter robertnef@bluewin.ch