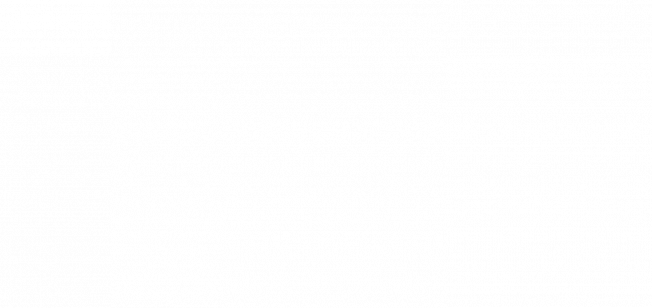Zehn große ökonomische Mythen (Teil 1)
26.11.2014 – Der folgende Beitrag ist Murray N. Rothbard‘s Buch “Making Economic Sense” (1995) entnommen. Es handelt sich um das Kapitel “Ten Great Economic Myths” (Seite 7 – 19), das hier in drei Teilen veröffentlicht wird. Übersetzt von Dr. Bernhard Pieper.
—————————————————————————————————————————————————————————–

Murray N. Rothbard (1926 – 1995)
Zahlreiche ökonomische Mythen plagen unser Land, vernebeln das Denken der Öffentlichkeit über wichtige Probleme und verführen uns dazu, falsche und gefährliche wirtschaftspolitische Maßnahmen zu akzeptieren. Hier folgen die zehn gefährlichsten dieser Mythen, mit einer Analyse, was an ihnen falsch ist.
Mythos 1: Staatsdefizite verursachen Inflation; Staatsdefizite haben mit Inflation nichts zu tun
In den vergangenen Jahrzehnte erlebten wir auf Bundesebene ständig staatliche Budgetdefizite. Die regelmäßige Reaktion der Oppositionspartei, wer auch immer es gerade war, bestand darin, diese Defizite als Ursache beständiger Inflation anzuprangern. Und ebenso monoton erfolgte als Erwiderung der Partei an der Macht, um wen es sich auch immer gerade handelte, die Behauptung, dass Budgetdefizite nichts mit Inflation zu tun hätten. Bei beiden Behauptungen handelt es sich um Mythen.
Defizite bedeuten, dass die Bundesregierung mehr ausgibt, als sie an Steuereinnahmen erzielt. Diese Defizite lassen sich auf zwei Wegen finanzieren. Bei einem Verkauf von Staatsanleihen auf dem Kapitalmarkt wirken Defizite nicht inflationär. Es wird nämlich kein neues Geld geschöpft; Privatpersonen oder institutionelle Anleger zahlen mit ihren Bankguthaben für die Anleihen und der Finanzminister gibt dieses Geld dann wieder aus. Das Geld wird also einfach von der Öffentlichkeit auf den Fiskus übertragen, der das Geld anschließend an andere Marktteilnehmer weitergibt.
Alternativ lässt sich das Defizit durch den Verkauf von Anleihen an den Bankensektor finanzieren. Sofern dieser Weg beschritten wird, schöpfen die Banken neues Geld, indem sie durch den Ankauf der Anleihen dem Fiskus Bankguthaben einräumen. Das neue Geld wird dann vom Fiskus ausgegeben und auf diesem Wege dauerhaft in den Wirtschaftskreislauf eingeschleust, wodurch das Preisniveau in die Höhe getrieben bzw. Inflation erzeugt wird. Die Federal Reserve ermöglicht es den Geschäftsbanken über einen komplizierten Mechanismus, neues Geld zu schöpfen, sofern letztere i.H.v. einem Zehntel des Betrages Zentralbankreserven anlegen. Wenn Banken also beabsichtigen, zur Finanzierung des Budgedefizits neue Staatsanleihen i.H.v. 100 Mrd. US$ zu kaufen, kauft die Fed ca. 10 Mrd. US$ an alten Anleihen auf. Entsprechend erhöhen sich die Reserven der Geschäftsbanken, was letzteren eine Vervielfachung an neuen Bankeinlagen um den Faktor zehn ermöglicht. Mit einem Wort: Regierung und Bankensektor kontrollieren praktisch das Drucken neuen Geldes zur Finanzierung von Budgetdefiziten.
Defizite wirken demnach inflationär, sofern sie über den Bankensektor finanziert werden; sie sind nicht inflationär, sofern die allgemeine Öffentlichkeit das Geld aufbringt.
Einige Wirtschaftspolitiker verweisen auf die Jahre 1982-83, als die Defizite zunahmen, die Inflation hingegen zurückging, als empirischen Beweis dafür, dass Budgetdefizite und Inflation nichts miteinander zu tun haben. Tatsächlich ist damit gar nichts bewiesen. Änderungen des allgemeinen Preisniveaus resultieren aus zwei Bestimmungsfaktoren: Dem Angebot von und der Nachfrage nach Geld. In den Jahren 1982-83 schuf die Fed neues Geld mit einer sehr hohen Wachstumsrate von ca. 15 Prozent p.a. Ein Großteil davon floss in die Finanzierung des wachsenden Staatsdefizits. Auf der anderen Seite erhöhte die tiefe Rezession die Geldnachfrage (d.h. sie reduzierte die Neigung, Geld für Güterkäufe auszugeben) in Reaktion auf die immensen Verluste der Unternehmen. Diese vorübergehend kompensierende Mehrnachfrage nach Geld bedeutet nicht, dass Defizite nicht inflationär wirken. Tatsächlich nahmen im Maße der wirtschaftlichen Erholung die Ausgaben zu und die Geldnachfrage ab. Die Ausgaben mit neuem Geld heizten dabei die Inflation wieder an.
Mythos 2: Staatsdefizite verdrängen keine privaten Investitionen
In den vergangenen Jahren herrschte in den USA eine verständliche Sorge über die niedrigen Spar- und Investitionsquoten. Man befürchtete, dass die enormen Budgetdefizite des Bundes Ersparnisse zu Lasten produktiver Investitionen in unproduktive Ausgaben der Regierung lenkten und damit langfristig einer Anhebung des allgemeinen Lebensstandards oder auch nur seines Erhalts Probleme bereiten würden.
Einige Wirtschaftspolitiker versuchten – wieder einmal -, diese Befürchtungen durch Verweis auf Statistiken zu entkräften. In den Jahren 1982-83, so ihre These, bestanden hohe und steigende Defizite bei gleichzeitig sinkenden Zinsen, so dass es kein „crowding-out“ gegeben haben könne.
Bei diesem Argument handelt es sich um ein weiteres Beispiel für den Irrtum, zwingende Logik durch bloße Zahlen widerlegen zu können. Das Zinsniveau sank, weil rezessionsbedingt die unternehmerische Kreditnachfrage ausblieb. Die „realen“ Zinsen (Nominalzins minus Inflationsrate) blieben jedoch unverändert hoch, teils weil hohe Inflationsraten allgemein erwartet wurden, teils genau wegen des Crowding-out-Effekts. Jedenfalls lassen sich Argumente der Logik niemals durch Statistiken widerlegen. Und pure Logik besagt, dass, wenn Ersparnisse in Regierungsausgaben fließen, notwendigerweise weniger Ersparnisse für produktive Verwendungen zur Verfügung stehen als sonst. Gleichzeitig müssen die Zinsen höher sein als ohne diese Defizite. Finanziert die Öffentlichkeit diese Budgetdefizite, werden die Ersparnisse direkt und ganz offenkundig in Regierungsvorhaben umgelenkt. Erfolgt die Finanzierung durch „Bankeninflation“, ist die Umlenkung nur indirekt. Das „crowding-out“ vollzieht sich hier, indem das von der Regierung neu gedruckte Geld mit dem alten Geld der übrigen Wirtschaftssubjekte um Ressourcen konkurriert.
Milton Friedman bestreitet den Crowding-out-Effekt von Budgetdefiziten mit dem Hinweis darauf, dass alle Staatsausgaben, nicht nur die Defizite, gleichermaßen private Investitionen verdrängen. Es stimmt, dass das durch Steuern abgeschöpfte Geld für private Ersparnisbildung bzw. Investitionen hätte verwendet werden können. Aber Defizite bewirken einen viel größeren Verdrängungseffekt als allgemeine Staatsausgaben, weil durch die Öffentlichkeit finanzierte Defizite offensichtlich die Ersparnisse und nur diese anzapfen, wohingegen Steuern den Konsum ebenso wie die Ersparnisbildung belasten.
Folglich verursachen Staatsdefizite erhebliche ökonomische Probleme, gleichgültig von welcher Perspektive aus man sie betrachtet. Finanziert durch das Bankensystem wirken sie inflationär. Aber auch wenn sie durch die allgemeine Öffentlichkeit finanziert werden, verursachen sie immer noch Verdrängungseffekte, sofern dringend benötigte private Ersparnisse weg von produktiven privaten Investitionen hin zu verschwenderischen Staatsvorhaben gelenkt werden. Nicht zuletzt gilt, dass mit steigenden Defiziten auch die Einkommenssteuerlast der US-Bevölkerung dauerhaft zunimmt, um für die wachsenden Zinsverpflichtungen aufzukommen. Ein Problem, das sich noch dadurch verschärft, dass inflationäre Defizite das Zinsniveau nach oben treiben.
Mythos 3: Lieber höhere Steuern als Budgetdefizite
Auch diejenigen, die sich zu Recht über Staatsdefizite sorgen, empfehlen unglücklicherweise eine inakzeptable Problemlösung: Steuererhöhungen. Das Problem der Defizite mittels Steuererhöhungen heilen zu wollen, gleicht in etwa dem Versuch, eine Bronchitis zu kurieren, indem der Patient erschossen wird. Die Therapie wirkt viel schlimmer als die Krankheit.
Worauf bereits viele Kritiker hingewiesen haben, besteht ein Grund darin, dass höhere Steuern der Regierung mehr Geld in die Kassen spülen, und Politiker und Bürokraten dies höchstwahrscheinlich nutzen werden, ihre Ausgaben noch um so mehr zu steigern. Wie Parkinson es in seinem berühmten „Gesetz“ formulierte: “Die Ausgaben steigen mit den Einnahmen.“ Wenn eine Regierung willens ist, mit einem Defizit von sagen wir 20 Prozent zu arbeiten, dann wird sie höhere Einnahmen dazu nutzen, entsprechend mehr auszugeben und so die Defizitquote unverändert zu belassen.
Aber auch abgesehen von dieser „bösartigen“ Lehre aus der politischen Psychologie stellt sich die Frage, warum eine Steuer besser sein sollte als ein hohes Preisniveau? Es ist richtig, dass Inflation eine Form der Besteuerung darstellt, sofern die Regierung und andere frühzeitige Bezieher des neuen Geldes in die Lage versetzt werden, die übrige Öffentlichkeit, deren Einkommen erst später im Zuge der Inflation steigen, zu enteignen.[1] Aber auch diese Akteure sind bei einer Inflation wenigstens in der Lage, zumindest einen Teil der Vorteile aus Handelstransaktionen einzufahren. Wenn der Brotpreis auch auf 10 USD je Laib steigt, ist das zwar bedauerlich, aber zumindest kann man das Brot noch essen. Wenn hingegen die Steuern steigen, wird einem das Geld genommen zugunsten von Politikern und Bürokraten. Man selbst hat keinen Nutzen mehr davon. In Konsequenz wird also das Geld bei den Produzenten konfisziert zum Wohle der Bürokraten und, um auf Unrecht auch noch Spott zu türmen, nutzen letztere das Geld auch noch zur Schikanierung der Allgemeinheit.
Nein, das einzige Heilmittel gegen Budgetdefizite lautet ganz einfach, auch wenn es praktisch immer unerwähnt bleibt: Budgetkürzung. Wie und wo? Irgendwo und überall.
“Zehn große ökonomische Mythen (Teil 2)” werden wir am 3. Dezember 2014 veröffentlichen.
[1] „Enteignung“ in dem Sinne, dass mit dem neu – aus dem Nichts – geschaffenen Geld preistreibend auf Ressourcen zugegriffen wird, ohne dass zuvor wie beim alten – fundierten – Geld eine Wirtschaftsleistung am Markt erbracht wurde. Die Altgeldbesitzer können nur noch weniger für ihr Geld erwerben und werden insofern enteignet. [Anmerkung des Übersetzers]
—————————————————————————————————————————————————————————–
Murray N. Rothbard wurde 1926 in New York geboren, wo er an der dortigen Universität Schüler von Ludwig von Mises wurde. Rothbard, der 1962 in seinem Werk Man, Economy, and State die Misesianische Theorie noch einmal grundlegend zusammenfasste, hat selbst diese letzte Aufgabe, die Mises dem Staat zubilligt, einer mehr als kritischen Überprüfung unterzogen.