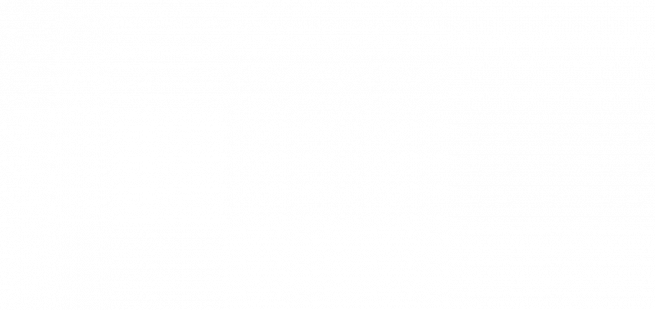Fiskalpolitik: ‚Keynesianer‘ versus ‚Austrians‘
1.6.2016 – von Thorsten Polleit.
Das nachstehende Referat wurde auf der 12. Gottfried von Haberler Conference 2016 „Central Banks, Fiscal Policy and the Betrayed Citizen“ am 20. Mai 2016 in Vaduz, Liechtenstein, gehalten.
*****
„Trotzdem kann die Theorie der Produktion als Ganzes, die den Zweck des folgenden Buches bildet, viel leichter den Verhältnissen eines totalen Staates angepaßt werden als die Theorie der Erzeugung und Verteilung einer gegebenen, unter Bedingungen des freien Wettbewerbes und eines großen Maßes von laissez-faire erstellten Produktion“
―John Maynard Keynes, Vorwort zur
deutschen Ausgabe, 7. September 1936.
„Der flüchtigen Betrachtung erscheinen Obrigkeitsstaat und Sozialdemokratie als unversöhnliche Gegensätze, zwischen denen es keine Vermittlung gibt.“
―Ludwig von Mises (1919), Nation, Staat und Wirtschaft, S. 143.
Einleitung
„Fear the Boom and Bust“ ist ein YouTube-Video aus dem Jahr 2010, produziert von John Papola und Russ Roberts. Es geht darin um die Theoriekontroverse „Keynes versus Hayek“ – künstlerisch aufbereitet als Hip-Hop-Rap-Song.
Hier möchte ich mit meinem Referat anknüpfen, nicht musikalisch, sondern inhaltlich. Ich möchte zentrale keynesianische Positionen, die in der Mainstream-Volkswirtschaftslehre vorherrschend sind, einer kritischen Betrachtung unterziehen.
Das soll aber nicht aus Sicht der Lehre, die Friedrich August von Hayek (1899 – 1992) vertritt, geschehen, sondern aus der Sicht der Erkenntnisse, die Ludwig von Mises (1881 – 1973) anbietet.
Mises ist der Auffassung, dass die Nationalökonomie sich widerspruchsfrei nur als Lehre des menschlichen Handelns – als apriorische Handlungswissenschaft – begreifen lässt, die er selbst als Praxeologie bezeichnet.[1]
Hayek folgt Mises in diesem Punkt nicht. Hans-Hermann Hoppe bezeichnet Hayeks wissenschaftliche Methode als Ultra-Subjektivismus – und so gesehen übt Hayek quasi einen Schulterschluss mit der wissenschaftlichen Methode, die die Hauptstrom-Volkswirte vertreten.[2]
Ich werde die Kontroverse über die richtige wissenschaftliche Methode in der Nationalökonomie aber an dieser Stelle nicht weiter thematisieren.
Nur so viel sei betont: Die Unterschiede in den theoretischen Positionen, die zwischen Keynesianern (und ‚Hayekianern‘) und ‚Misesianern‘ zutage treten, finden ihre Begründung vor allem in den jeweils angewandten wissenschaftlichen Methoden.
Annahmen
Wie vergleichen sich nun die Positionen der Keynesianer und Austrians mit Blick auf die Fiskalpolitik? Unter Fiskalpolitik sind alle Maßnahmen des Staates zu verstehen, die seine Einnahmen und Ausgaben betreffen.
Für Keynesianer ist die Fiskalpolitik vor allem ein Konjunkturinstrument: Lahmt die Wirtschaft, soll der Staat mit zusätzlichen Ausgaben die Nachfrage und damit Wachstum und Beschäftigung fördern.
In der keynesianischen Theorie werden dabei (mehr oder wenig stillschweigend) einige Annahmen getroffen wie vor allem die folgenden vier:
(1) Die freie Marktwirtschaft ist störanfällig. Daher ist es Aufgabe des Staates, mittels Fiskalpolitik den Wirtschaftsablauf zu glätten – beziehungsweise für Vollbeschäftigung zu sorgen.
(2) Der Staat handelt wie ein wohlmeinender Diktator. Er wird von den Wählern beauftragt, das Gewünschte in die Tat umzusetzen – und der Staat setzt dann alles daran, diesem Auftrag nachzukommen.
(3) Der Staat ist allmächtig: Keynesianer meinen, dass der Staat die Ziele, die er erreichen will, beziehungsweise die er vorgibt erreichen zu wollen, auch erreichen kann.
(4) Staatliches Handeln führt eine Win-Win-Situation herbei: Eine Situation, in der das Gemeinwohl (was immer das auch sein soll) verbessert wird (was jedoch nicht heißen muss, dass dabei alle besser und niemand schlechter gestellt wird).
Diese Sichtweise der Keynesianer teilen die Ökonomen der Österreichischen Schule – in ihrer Misesianisch-liberalen-libertären Ausprägung (die ‚Austrians‘) – nicht beziehungsweise lehnen sie ab.
Um die Position der Austrians besser zu verstehen, sollen ihre Argumente nachfolgend näher betrachtet werden. Ausgangspunkt der Überlegungen ist die Frage: Wie finanziert sich der Staat?
Wie der Staat sich finanziert
Der Staat hat eine (und nur eine) Finanzierungsquelle: Und das sind die Einkommen seiner Bürger, an die er mittels Besteuerung gelangt.
Die Besteuerung kann verschiedene Formen haben: (1) Offene Besteuerung (in Form der direkten und indirekten Steuererhebung), (2) das Aufnehmen von Krediten (was künftige Besteuerung bedeutet), (3) Verkauf von zuvor verstaatlichtem Vermögen (was einer Doppelbesteuerung gleichkommt) und (4) das Inflationieren des Geldes (das ist die Inflationsteuer).
Nehmen wir an, der Staat erhebt eine Steuer auf die Gewinne, die der Unternehmer erzielt (oder, was quasi auf dasselbe hinausläuft, er besteuert die Einkommen der Arbeitnehmer).
Für den Unternehmer ist es fortan weniger lohnend, unternehmerisch tätig zu sein, also Konsumverzicht zu üben, zu sparen und zu investieren.[3] Denn der Grenzertrag seiner Arbeit nimmt ab, und der Grenzertrag der Nichtarbeit (Freizeit) steigt.
Der Unternehmer wird nun mehr konsumieren und weniger sparen und weniger investieren. Die materielle Wohlfahrt der Volkswirtschaft sinkt dadurch, und zwar notwendigerweise (im Vergleich zu einer Situation, in der der Unternehmer nicht besteuert wird).
Das ist ein denknotwendiges Ergebnis. Es folgt aus der Erkenntnis, dass der handelnde Mensch eine Zeitpräferenz hat. Die Zeitpräferenz ist aus dem menschlichen Handeln nicht wegzudenken und sie besagt, dass (1) Gegenwartsgüter höher wertgeschätzt werden als Zukunftsgüter, und dass (2) ein Mehr einem Weniger vorgezogen wird.[4]
Die Steuern vermindern das Einkommen des Besteuerten, und das erhöht seine Zeitpräferenz, und zwar notwendigerweise. Für ihn wird das gegenwärtig verfügbare Einkommen wertvoller im Vergleich zum künftig erzielbaren Einkommen.
Doch nicht nur das. Der Besteuerte will nun auch rascher an die gewünschten Güter gelangen, auch wenn er dazu auf weniger zeitintensive und damit weniger ergiebige Produktionswege zurückgreifen muss.
Die Produktionsleistung sinkt dadurch – und zwar notwendigerweise im Vergleich zu einer Situation, in der er nicht besteuert worden wäre, und in der er ergiebigere Produktionswege gewählt hätte.
Nun könnte man einwenden: Die Produktionsleistung des Besteuerten mag zwar sinken. Aber könnte das nicht aufgewogen werden von den positiven Effekten, die daraus rühren, dass die Steuerempfänger zusätzlich Geld bekommen und es ausgeben?
Es wurde bereits argumentiert, dass die Besteuerung die Produktionsleistung der Unternehmer herabsetzen muss (denn es erhöht deren Kosten, zu sparen und zu investieren und senkt die Kosten des Konsums/Freizeit).
Für Nichtproduzenten, die Netto-Steuerempfänger, wird es hingegen billiger, auf produktive Tätigkeiten zu verzichten. Es wird für sie billiger, auf unproduktive Tätigkeiten auszuweichen, um das Einkommen zu erhöhen.
Sie beauftragen die Regierung, ihnen ein Einkommen zuzuschanzen, das anderen abgenommen wird. Auf diese Weise können sie an Einkommen gelangen, ohne dass sie dafür eine produktive Marktleistung erstellen und bereitstellen müssen.[5]
Unter diesen Umständen muss es zu einem Ansteigen der Zeitpräferenz in der Volkswirtschaft insgesamt kommen. Produzenten und Nichtproduzenten sparen und investieren weniger und konsumieren mehr als im Falle der Nichtbesteuerung. Die materielle Ausstattung der Volkswirtschaft fällt geringer aus, als sie ohne Besteuerung und Umverteilung ausfallen würde.
Damit dürfte deutlich geworden sein, dass die Besteuerung wohlstandsmindernd wirkt, und auch, dass es eine neutrale Steuer nicht geben kann. Immer gewinnen die einen auf Kosten der anderen.
Eine Win-Win-Situation kann der Staat im Zuge einer Besteuerung nicht herbeiführen. Ändert sich das Bild vielleicht, wenn man die staatliche Konjunkturpolitik (die andere Seite der Fiskalpolitik) in die Betrachtung einbezieht?
Sind staatliche Konjunkturprogramme akzeptabel in Zeiten der Rezession-Depression?
Nehmen wir an, die Volkswirtschaft befindet sich in einer Rezession-Depression (einer Unterbeschäftigung). Ist es da hilfreich, wenn der Staat zu nachfragewirksamen Ausgabenprogrammen greift, um die Wirtschaft anzuschieben?
Keynesianer würden diese Frage mit ja beantworten. Der Grund: Aus ihrer Sicht ist die freie Marktwirtschaft störanfällig, sie verfügt nicht über ausreichende Selbstheilungskräfte, um aus einer Unterbeschäftigungskrise in die Vollbeschäftigung zurückzukehren.
Im 20. und auch 21. Jahrhundert hat es zweifelsohne mehr oder weniger große „Krisen“ gegeben. Zu nennen sind zum Beispiel die deutsche „Hyperinflation“ 1923, die „Große Depression“ 1929 – 1933, die „Große Inflation“ in den 1970er und 1980er Jahren in den USA und anderswo, die Asien- und Russland-Krise 1997/1998, das Platzen des „New Economy Booms“ 2000/2001 und die internationale Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009.
Doch reichen solche Verweise aus, um daraus auf eine Instabilität der freien marktwirtschaftlichen Ordnung schließen zu können?
Um diese Frage zu beantworten, muss man fragen: Was waren die Ursachen dieser Krisen? Nun, alle diese Krisen waren in der einen oder anderen Weise verursacht durch staatliche Eingriffe in den freien Markt. Sie bezeugen in keiner Weise das Versagen der freien Marktwirtschaft! Die vermeintliche Instabilität der freien Marktwirtschaft ist vielmehr ein von marktfeindlichen Kreisen gehegter Mythos.
Was aber auch immer die Ursache der Unterbeschäftigung im Einzelnen sein mag (ob sie Folge einer Naturkatastrophe oder eines geplatzten Spekulationsbooms ist), für unsere Überlegungen ist das Folgende wichtig:
Eine Unterbeschäftigung stellt sich nur dann ein, wenn die Preise der angebotenen Konsum- und/oder Produktionsgüter zu hoch sind, wenn die Löhne, die zur Erzeugung der Güter zu zahlen sind, zu hoch sind.
Produzenten werden ihre Waren nicht los, häufen Lagerbestände an, wenn sie nicht bereit sind, die Verkaufspreise so weit zu senken, bis die Ware Nachfrager findet.
Arbeitnehmer müssen bereit sein, für einen niedrigeren Lohn zu arbeiten, ansonsten bleiben sie arbeitslos.[6]
Nehmen wir an, die Wirtschaft befindet sich in einer Unterauslastung. Um die Wirtschaft zu beleben, erhöht der Staat die Nachfrage im Bausektor (in dem die Lage besonders trüb ist).
Die zusätzliche staatliche Nachfrage verhindert, dass die Preise der Güter, die die Bauindustrie anbietet, zurückgehen; die Preise werden auf ihrem (offensichtlich) überhöhten Niveau gehalten oder vielleicht noch weiter in die Höhe getrieben.
Die staatliche Nachfrage verhindert, dass die Bauunternehmen sich an die geänderten Nachfragebedingungen anpassen; möglicherweise wird der Bausektor sogar noch weiter aufgebläht.
Die Ressourcen, die die staatliche Nachfrage in die Bauindustrie lenkt, entgehen anderen Sektoren. Beispielsweise sinken Produktion und Beschäftigung in der Automobilindustrie, weil sie für ihre Inputgüter nunmehr höhere Preise bezahlen muss – im Vergleich zu einer Situation, in der der Staat die Güternachfrage zu Gunsten der Bauwirtschaft nicht ausgeweitet hätte.
Wir erkennen: Sollte es der Keynesianischen Fiskalpolitik gelingen, die Produktions- und Beschäftigungssituation vor dem Einbruch zu bewahren, so ist das nur möglich, wenn die einen (per Umverteilung) besser gestellt werden auf Kosten der anderen.
Die Sache mit dem „Multiplikator“
Aus keynesianischer Sicht sind alle Produktions- und Beschäftigungsprobleme Ausdruck der Tatsache, dass die effektive Nachfrage zu gering ist. Die keynesianische Theorie geht davon aus, dass alles, was nachgefragt wird, auch produziert werden kann. Im keynesianischen Theoriegebäude ist die Knappheit damit überwunden – das Knappheitsproblem ist eliminiert!
Wenn das nicht schon ausreicht, um die keynesianische Theorie beiseite zu legen, soll eine weitere Kritik an ihr vorgetragen werden. Sie richtet sich gegen den sogenannten Multiplikator.[7] Damit ist die Idee gemeint, dass eine zusätzliche staatliche Ausgabe die gesamtwirtschaftliche Nachfrage um ein Vielfaches der Ausgabe anwachsen lässt.
Der Multiplikator lässt sich wie folgt formalisieren:
Der linke Ausdruck der Gleichung zeigt den Zuwachs des Einkommens (dY) als Folge einer zusätzlichen Staatsausgabe (dG). Die rechte Seite zeigt den Multiplikator, wobei c die marginale Konsumneigung ist. Sie zeigt, dass von jedem Einkommen c Euro konsumiert werden.
Gibt der Staat beispielsweise 1 Euro zusätzlich aus, so steigt in der „ersten Runde“ die Nachfrage um 0,8 Euro, in der zweiten Runde um 0,64 Euro (also 0,8 x 0,8), in der dritten Runde 0,512 Euro und so weiter. Der Multiplikator beträgt also 5.
Das klingt verführerisch: Der Staat gibt 1 Euro aus, und daraus erwächst in wundersamer Weise ein Einkommen in Höhe von 5 Euro! Was ist davon zu halten? Auf was es bei dieser Betrachtung ankommt, ist den richtigen Vergleich zu ziehen.
Es ist nicht entscheidend, ob die zusätzliche Staatsausgabe eine Einkommensmehrung bewirkt. Entscheidend ist, wie sich diese Einkommensmehrung vergleicht mit einer Situation, in der keine solche Ausgabe getätigt wird.
Ein solcher Vergleich kommt zu einem eindeutigen Ergebnis. Wie bereits argumentiert, muss der Staat, wenn er etwas ausgeben will, es vorher jemandem wegnehmen. Wegnehmen kann er nur den Produktiven: den Unternehmern oder Arbeitnehmern.
Besteuert man Unternehmer oder Arbeitnehmer, steigt deren Zeitpräferenz. Sie sparen und investieren weniger und konsumieren mehr, und die Güterproduktion nimmt ab (im Vergleich zur Situation, in der nicht besteuert wird). Und gleichzeitig steigt auch die Zeitpräferenz der Steuerempfänger an.
Dass eine Staatsausgabe die Güterproduktion per Multiplikatoreffekt vermehrt (gegenüber einer Situation, in der die Staatsausgabe ausbleibt und die Menschen über ihr Einkommen selbstbestimmt verfügen können), ist daher ein theoretischer Fehlschluss.[8]
Sparen ist unverzichtbar
Ein weiteres Element der Keynesianischen Lehre soll der Kritik unterzogen werden: Das sogenannte Problem des Sparens.
Keynesianer meinen, wenn gespart wird, nehme die gesamtwirtschaftliche Nachfrage ab, und das schwäche die Wirtschaftsleistung. Die Menschen sollten daher vor allem in einer Phase schwachen Wirtschaftswachstums konsumieren. Was ist davon zu halten?
In modernen kapitalistischen Volkswirtschaften wird ein Teil des Einkommens gespart (nicht konsumiert), um es zu investieren (es in produktive Verwendungen zu lenken). Durch das Investieren wächst der Kapitalstock. Das wiederum erhöht die Produktivität, und dadurch steigen die Reallöhne.
Wenn mehr gespart wird, heißt das also nicht, dass die Nachfrage sinkt, sondern nur, dass weniger Güter zu Konsumzwecken und mehr Güter zu Investitionszwecken nachgefragt werden.
Das Sparen ist der Schlüssel für das Investieren. Letzteres erhöht die Ergiebigkeit der Arbeit. Nur durch Sparen und Investieren, nicht aber durch Konsumieren, lässt sich der Wohlstand der Volkswirtschaft mehren.
In Phasen der Rezession gibt es nun aber meist die keynesianische Politikempfehlung, der Staat solle die Konsum- oder auch die Investitionsnachfrage ausweiten. Was ist davon zu halten?
Wenn Maschinen stillstehen, Arbeitslosigkeit herrscht und angefangene Investitionsprojekte nicht vollendet werden, so liegt das an Fehlentscheidungen, die aus der Vergangenheit rühren.
Die Preise der Produktionsgüter, die fehlerhaft ausgerichtet wurden, müssen sich an die herrschenden Nachfragebedingungen anpassen. Kapital muss umgewidmet oder neu gebildet werden.
Das Um- und Neubilden von Produktionskapital erfordert Ersparnisse: Arbeitskraft und Vorleistungsgüter müssen eingesetzt werden, um die gewünschten Resultate zu erzielen. Man erkennt: In einer Rezession mangelt es der Volkswirtschaft an Ersparnissen, sie leidet nicht unter zu geringem Konsum!
Während also Keynesianer in einer Rezession eine expansive Fiskalpolitik befürworten, um eine Volkswirtschaft aus der Unterbeschäftigung zu führen, lehnen Austrians eine derartige Politik als unangemessen[9], als kontraproduktiv ab:
(1) Eine staatliche Ausgabenpolitik verhindert eine notwendige Anpassung der Produktions- und Beschäftigungsstruktur an die tatsächlichen Konsumwünsche; und
(2) sie verhindert, dass es zum Aufbau der erforderlichen Ersparnisse kommt, ohne die sich die Volkswirtschaft nicht aus der Unterbeschäftigung herausarbeiten kann.
Rechtfertigen öffentliche Güter die Fiskalpolitik?
Nun könnte man argumentieren, dass der Staat öffentliche Güter bereitstellen müsse. Wird der Begriff ‚öffentliche Güter‘ ins Spiel gebracht, ist Vorsicht geboten.[10]
Zunächst einmal ist es alles andere als eindeutig, was ein Gut ist. Für die einen ist zum Beispiel ein Feuerwerk ein Gut, für die anderen ist es ein Schlecht. Die einen erfreuen sich an den bunten Farben des Feuerwerks, die anderen fühlen sich durch das laute Knallen in ihrer Nachtruhe gestört. Die einen bejubeln den staatlichen Schulzwang (für sie ist er ein Gut), die anderen leiden unter ihm (für sie ist er ein Schlecht).
Auch kann sich der Charakter eines Gutes im Zeitablauf ändern: Für die einen ist heute ein CD-Spieler ein Gut (das den Wunsch nach Musik erfüllt), in einem Jahr ist er hingegen kein Gut mehr (weil die CD-Technik überholt ist).
Was ein Gut ist und was ein Schlecht ist, lässt sich folglich nur subjektiv bestimmen, und diese Einschätzung ist auch nicht notwendigerweise zeitinvariant.
Nicht weniger problematisch ist die Festlegung, was öffentliche Güter sind. In der Standardvolkswirtschaftslehre werden sie durch zwei Eigenschaften gekennzeichnet: (1) Es besteht keine Rivalität im Konsum des Gutes, und (2) man kann Dritte nicht von der Nutzung des Gutes ausschließen.[11]
Öffentliche Güter werden, so wird argumentiert, nicht in der gewünschten Menge und Qualität durch den freien Markt bereitgestellt. Denn es gibt Menschen, die die öffentlichen Güter zwar nutzen, nicht aber für die Nutzung zahlen wollen. Das sind die Trittbrettfahrer.
Daraus wird nun geschlussfolgert, der Staat müsse einspringen und die öffentlichen Güter bereitstellen. Das aber ist ein logischer Fehlschluss, ein non sequitur.[12]
Nur weil ein Gut wünschenswert ist, so heißt das noch nicht, dass der Staat es bereitstellen muss oder sollte. Denn das Erstellen öffentlicher Güter kann nur erfolgen, wenn andere private Güter nicht erzeugt werden.
Offensichtlich ist es aber so, dass die Menschen mit ihrem Geld etwas anderes machen wollen, als es für das öffentliche Gut auszugeben. Sonst würden sie ja das öffentliche Gut mit ihrem Geld nachfragen – und man müsste sie nicht zum Bezahlen per Steuer zwingen.
Genau diese doch wohl unbestreitbare Einsicht verdunkelt die Theorie der öffentlichen Güter. Sie will etwas legitimieren, was sich nicht legitimieren lässt, will aus einem Nein ein Ja machen.
Das heißt natürlich nicht, dass man ohne Fiskalpolitik (und den Staat, der sie durchführt) auf sogenannte ‚öffentliche Güter‘, die viele Menschen schätzen und nutzen wollen, verzichten müsste.
Vielmehr lässt sich das Angebot von Recht und Sicherheit, Straßen, Bildung etc. privat anbieten. Und zwar billiger und besser, als es der Staat kann. Diese Einsicht bringt uns zum Problem der Bürokratie.
Bürokratische Hindernisse
Selbst wenn man das bisher Gesagte verneint und meint, die Fiskalpolitik sei unverzichtbar für das Bereitstellen von öffentlichen Gütern, so wird man nicht umhinkommen, sich mit den Problemen der Bürokratie auseinanderzusetzen.
Eine öffentliche Bürokratie unterliegt nicht der Marktdisziplin, ihre Dienste haben keinen Marktpreis. Zu denken ist z. B. an das Erteilen von Baugenehmigungen oder den Einsatz der Polizei.
Eine Bürokratie kann folglich keine Wirtschaftlichkeitsrechnung durchführen, die die Unternehmer im freien Markt in die Lage versetzt (und zwingt), knappe Ressourcen in die wichtigsten Verwendungen zu lenken.[13]
Die Bürokratie ist daher notwendigerweise unwirtschaftlich. Verluste, die sie produziert, werden durch Steuererhöhungen (oder durch Schuldenaufnahme, also künftige Besteuerung) ausgeglichen. Dass das Anreize zur Verschwendung, Korruption und Minderleistung gibt, liegt auf der Hand.
Ein Bereitstellen von Gütern (und vor allem auch der Güter, die man üblicherweise als öffentliche Güter deklariert wie zum Beispiel Sicherheit, Verteidigung und Rechtsprechung) über den freien Markt ist daher in jedem Falle wirtschaftlicher, als wenn der Staat mit seiner Bürokratie sie erstellt.[14]
Fallstricke des Interventionismus
Wenn dennoch die Position vertreten wird, dass der Staat bestimmte Aufgaben übernehmen soll – wie zum Beispiel unerwünschte Zustände verbessern (wie eine Verteuerung von Wohnraum verhindern) –, so lautet die entscheidende Frage:
Kann der Staat die Ziele, die er vorgibt erreichen zu wollen, überhaupt erreichen? Diese Frage lenkt das Augenmerk auf die Probleme des Interventionismus.[15]
Der Begriff Interventionismus bedeutet, dass der Staat fallweise in das Geschehen des freien Marktes eingreift. Er erlässt beispielsweise Ge- und Verbote, gibt Anweisungen, erhebt Steuern, um bestimmte Ziele zu erreichen.
Unterzieht man den Interventionismus einer kritischen Analyse, so zeigt sich, dass er seine angestrebten Ziele nicht erreichen kann; dass er eine Situation schafft, die unvorteilhafter ist als die, die man mittels Interventionismus verbessern wollte.
Das lässt sich das anhand eines einfachen Beispiels illustrieren. Nehmen wir an, die Regierung erlässt einen Mindestlohn (der höher ist als der markträumende Lohn), um die Arbeitseinkommen der Geringqualifizierten zu erhöhen.
Daraufhin sinkt die Beschäftigung: Unternehmer fragen jetzt weniger Arbeit nach als bisher. Das ist natürlich ein ungewolltes Ergebnis. Die Interventionismus-Befürworter werden darauf reagieren.
Sie entscheiden sich beispielsweise dazu, den Unternehmen anderweitig Kostenerleichterungen zu verschaffen, damit sie den Mindestlohn zahlen können. Dazu erlässt die Regierung nun einen Höchstpreis für zum Beispiel Strom (der niedriger ist als der markträumende Preis).
Daraufhin schrumpft die Stromversorgung, denn nicht alle Stromanbieter können mit dem neuen Höchstpreis profitabel wirtschaften. Die bisherige Produktion und Beschäftigung können nicht mehr aufrechterhalten werden. Die Lage verschlechtert sich noch weiter.
Die Regierung wird, wenn sie am Interventionismus festhält, immer weiter in das Marktgeschehen eingreifen. Früher oder später wird sie alles festlegen müssen: Löhne, Güterpreise, Zinsen. Sie muss anordnen, wer was wann und wieviel zu produzieren hat, und wer was wann und in welcher Menge zugeteilt bekommt.
Und der Staat muss Verstöße gegen seine Vorgaben unter Strafe stellen und sie auch sanktionieren. Der Interventionismus endet in einer Zwangswirtschaft (in der das Eigentum nur noch formal aufrechterhalten bleibt) oder im Sozialismus (in dem die Produktionsmittel verstaatlicht sind).
Beide Formen des sozialistischen Wirtschaftens sind jedoch nicht dauerhaft durchführbar und müssen scheitern; denn der Sozialismus ist undurchführbar. Der Staat ist so gesehen nicht allmächtig. Es gibt ökonomische Gesetzmäßigkeiten, über er sich nicht hinwegsetzen kann, zumindest nicht dauerhaft.
Divide et impera
Vor dem Hintergrund des Gesagten stellt sich die Frage: Wenn die Fiskalpolitik unproduktiv und wohlfahrtsmindernd ist, wenn sie ihre Ziele nicht erreichen kann, warum wird dann an ihr festgehalten?
Ja, warum ist die Fiskalpolitik in den letzten Jahrzehnten immer stärker ausgeweitet worden? Die Steuern sind allerorten gestiegen, die Verschuldung ist angewachsen, die Regulierungsdichte hat zugenommen, etc.
Eine mögliche Antwort ist der Verweis auf ökonomische Unkenntnis über das Wesen und die Konsequenzen der Fiskalpolitik.
Eine andere Antwort ist, dass das staatliche Einnahme- und Ausgabegebaren von vielen Menschen (offen oder hinter vorgehaltener Hand) begrüßt wird.
Denn der Staat (wie wir ihn heute kennen) handelt nach dem Motto „Divide et impera“, also: „Teile und regiere“.[16]
Er schafft nicht nur Opfer, indem er besteuert. Der Staat schafft auch Begünstigte (zusätzlich zu sich selbst). Nach dem Motto: Paul etwas wegnehmen und etwas davon an Peter weiterreichen, nachdem man sich selbst bedient hat.
Der Staat stellt zum Beispiel vielen Menschen einen sicheren Arbeitsplatz zur Verfügung, und Unternehmer versorgt er mit lukrativen Aufträgen.
Vielen Intellektuellen verschafft er ein Einkommen und Prestige (das sie ohne ihn vermutlich nicht hätten). Auch hat der Staat die Hoheit über die Altersvorsorge der meisten Bürger. Er bestimmt, wer was im Alter ausbezahlt bekommt.
Der Staat bringt auf diese Weise immer mehr Menschen in seine Abhängigkeit – beziehungsweise immer mehr Menschen sind auch bereit, sich in staatliche Abhängigkeit zu begeben.
Und solange die Menschen der Meinung sind, dass sie vom Staat netto profitieren, werden sie ihm nicht untreu, ja sie werden sogar bereit sein, sich noch stärker in seine Abhängigkeit zu begeben.
Damit der Staat seine Machtstellung halten beziehungsweise ausbauen kann, muss er Sorge dafür tragen, dass die Mehrheit von ihm profitiert bzw. glaubt, von ihm zu profitieren. Dazu muss er vor allem seine Finanzkraft immer weiter stärken.
Geldpolitik wird Fiskalpolitik
Die offene Besteuerung stößt aber an Grenzen: Die Menschen merken (durch den Unterschied zwischen Brutto und Netto), dass ihnen etwas weggenommen wird, und werden die Steuern zu hoch, begehren sie irgendwann auf.
Der Staat hat einen attraktiveren Weg, um an das Geld der Bürger zu gelangen: das Verschulden. Wie einfach und gut das funktioniert, zeigen unmissverständlich die im Zeitablauf steigenden öffentlichen Verbindlichkeiten im Vergleich zur Wirtschaftsleistung in vielen Ländern.
Die meisten Menschen – wenn sie sich erst einmal an die Existenz eines sie besteuernden Staates gewöhnt haben – sind nämlich bereit, dem Staat ihre Ersparnisse freiwillig zu leihen.
Weil das Verschulden für den Staat (und die von ihm begünstigten Gruppen) so attraktiv ist (niemand scheint einen Nachteil zu haben!), hat der Staat ein großes Interesse, dass die Zinsen niedrig bleiben beziehungsweise abgesenkt werden.
Für den Staat ist es daher besonders vorteilhaft, wenn er die Kontrolle über die Geldproduktion hat und das Sachgeld (das er vorfindet) durch sein eigenes intrinsisch wertloses Geld ersetzt.
Das beliebig vermehrbare Papiergeld bringt der Staat beziehungsweise seine Zentralbank dann vorzugsweise per Kreditvergabe in Umlauf, weil sich auf diese Weise der Zins mehr oder weniger perfekt kontrollieren lässt.
Eine unablässige Geldmengenvermehrung und die damit einhergehende schleichende Inflation spielen dem Staat in die Hände. Beispielsweise im Zuge der „kalten Progression“.[17]
Natürlich ist der Staat bestrebt, seine unproduktive Wirkung so lange wie möglich zu verschleiern. Beispielsweise, indem er ökonomische Lehren fördert, die den Staat und seine Fiskalpolitik legitimieren.
Auch wird er bestrebt sein, die Besteuerung- und Umverteilung undurchsichtig zu machen – so dass der einzelne Bürger nicht mehr genau weiß, ob er nun zur Gruppe der Netto-Staatsprofiteure oder zur Gruppe der Netto-Staatsgeschädigten gehört.
Doch angesichts seiner unproduktiven Wirkung ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Staat seine Fiskalpolitik – die Besteuerung und Umverteilung – zusehends mittels Geldpolitik durchführt.
Denn mittels Geldpolitik lässt sich eine neue Stufe in der Verschleierung der Besteuerungs- und Umverteilungspolitik erreichen.[18]
Die staatliche Zentralbank manipuliert beispielsweise die Marktzinsen künstlich herunter und weitet die Geldmenge immer weiter aus, um strauchelnde Schuldner auf Kosten von Gläubigern besserzustellen.
Die künstlich gesenkten Zinsen reduzieren die Zinsrechnung der Schuldner (insbesondere der Staaten). Den Gläubigern entgehen Zinseinnahmen.
Die Ausgabe von neuem Geld führt zu höheren Güterpreisen (im Vergleich zu einer Situation, in der die Geldmenge nicht ausgeweitet worden wäre).
Begünstigt werden dadurch die Besitzer der Güter, deren Preise steigen (beziehungsweise deren Preise nicht fallen). Benachteiligt werden diejenigen, die die Güter nicht zu niedrigeren Preisen kaufen können.
Und nicht nur das: Die Erstempfänger des neuen Geldes werden begünstigt auf Kosten der Spätempfänger des neuen Geldes. Die Erstempfänger können nämlich die Güter zu noch unveränderten Preisen kaufen.
Wenn das neue Geld sich in der Wirtschaft verbreitet, steigen die Preise an (fallen höher aus als im Vergleich zu einer Situation, in der die Geldmenge nicht erhöht worden wäre). Die Spätempfänger des neuen Geldes können nur noch zu erhöhten Preisen kaufen. Sie werden ärmer im Vergleich zu den Erstempfängern.
Wenn die Einnahmequellen Besteuerung und Verschuldung erschöpft sind, verbleibt einer Politik, die die Folgen der unproduktiven Wirkung des Staates zu verschleiern sucht, nur noch die Finanzierung über die elektronische Notenpresse. Ludwig von Mises schrieb im Januar 1923:
„daß eine Regierung sich immer dann genötigt sieht, zu inflationistischen Maßnahmen zu greifen, wenn sie den Weg der Anleihebegebung nicht zu betreten vermag und den der Besteuerung nicht zu betreten wagt, weil sie fürchten muß, die Zustimmung zu dem von ihr befolgten System zu verlieren, wenn sich seine finanziellen und allgemein wirtschaftlichen Folgen allzu schnell klar enthüllen. So wird die Inflation zu dem wichtigsten psychologischen Hilfsmittel einer Wirtschaftspolitik, die ihre Folgen zu verschleiern sucht. Man kann sie in diesem Sinne als ein Werkzeug antidemokratischer Politik bezeichnen, da sie durch Irreführung der öffentlichen Meinung einem Regierungssystem, das bei offener Darlegung der Dinge keine Aussicht auf die Billigung durch das Volk hätte, den Fortbestand ermöglicht.“[19]
Katze aus dem Sack
Damit ist die Katze aus dem Sack – das Wesen der Fiskalpolitik dürfte spätestens jetzt deutlich geworden sein: Es handelt sich um eine sozialistische Politik.
Die Fiskalpolitik lässt sich als Trojanisches Pferd begreifen. Sie kommt verheißungsvoll daher, ist aber ein Instrument, durch das schrittweise, nach und nach, die freie Marktwirtschaft untergraben und transformiert wird in ein mehr oder weniger sozialistisches Gemeinwesen.
Angesichts eines solchen Gradualismus ist es angemessen, Friedrich August von Hayek (1899 – 1992) zu ziteren. In DIE VERFASSUNG DER FREIHEIT (1960) schrieb er:
„daß … der Sozialismus als bewußt anzustrebendes Ziel zwar allgemein aufgegeben worden ist, es aber keineswegs sicher ist, daß wir ihn nicht doch errichten werden, wenn auch unbeabsichtigt. Die Neuerer, die sich auf die Methoden beschränken, die ihnen jeweils für ihre besonderen Zwecke am wirksamsten scheinen, und nicht auf das achten, was zur Erhaltung eines wirksamen Marktmechanismus notwendig ist, werden leicht dazu geführt, immer mehr zentrale Lenkung der wirtschaftlichen Entscheidungen auszuüben (auch wenn Privateigentum dem Namen nach erhalten bleiben mag), bis wir gerade das System zentraler Planung bekommen, dessen Errichtung heute wenige bewußt wünschen.“[20]
Die Entwicklung, die Hayek in Aussicht stellt, ist zwar nicht unmöglich, aber sie folgt keiner geschichtlichen Notwendigkeit.
Denn in letzter Konsequenz sind es Ideen, die für das menschliche Handeln verantwortlich sind. In DIE GEMEINWIRTSCHAFT (1932), der vollumfänglichen theoretischen Widerlegung des Sozialismus, schrieb Ludwig von Mises dazu:
„Ideen können nur durch Ideen überwunden werden. Den Sozialismus können nur die Ideen des Kapitalismus und des Liberalismus überwinden. Nur im Kampfe der Geister kann die Entscheidung fallen.“[21]
****
Aus diesem Grund, sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, sind Konferenzen, auf denen grundsätzlich über den Staat, sein Handeln und die Folgen für das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben kritisch nachgedacht und diskutiert werden kann, von allergrößter Bedeutung.
Denn sie geben dem Wettbewerb der Ideen Raum. Durch ihn können wir hoffen, dass sich die besseren Ideen durchsetzen werden; dass der Keynesianismus entzaubert wird als inkonsistente, falsche Theorie, deren Anwendung in der Praxis wohlstandmindernde, ungerechte und unfreiheitliche Wirkungen entfaltet.
Umso größer sollte daher unser aller Dank ausfallen, den ich den Veranstaltern der Gottfried von Haberler Konferenz aussprechen möchte. Ein ganz besonderer Dank gilt dabei dem Akademischen Direktor der Konferenz, Herrn Professor Kurt Leube.
Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, ich hoffe, mein Referat war für Sie nicht nur anregend, sondern auch ein bisschen aufregend.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Literatur
– Boyes, W. J. (2014), The Keynesian Multiplier Concept Ignores Crucial Opportunity Costs, in: The Quarterly Journal of Austrian Economics, Vol. 17, No. 31, Fall, pp. 327 – 337.
– Fishback, P., Kachanovskaya, V. (2015), The Multiplier for Federal Spending in the States During the Great Depression, in: The Journal of Economic History, Volume 75, Issue 01, March, S. 125 – 162.
– Grossekettler, H. (2003), Öffentliche Finanzen, in: Vahlens Kompendium der Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, Band 1, 8., überarbeitete Auflage, Verlag Franz Vahlen, München, S. 561 – 717.
– Hoppe, H.-H. (2012), The Great Fiction. Property, Economy, Society and the Politics of Decline, in: The Private Production of Defense, Laissez Fair Books, S. 173 – 198.
– Hoppe, H.-H. (2010), A Theory of Socialism and Capitalism, Ludwig von Mises Institute, Auburn, US Alabama.
– Hoppe, H.-H. (2006), On Time Preference, Government, and the Process of Decivilization, in: Democracy – The God That Failed, Transaction Publisher, New Brunswick, New Jersey, S. 1 – 43.
– Hoppe, H.-H. (2006), The Economics and Sociology of Taxation, in: The Economics and Ethics of Private Property. Studies in Political Economy and Philosophy, 2nd ed., Ludwig von Mises Institute, Auburn, US Alabama. S. 33 – 75.
– Hoppe (2006), Socialism: A Property or Knowledge Problem?, in: The Economics and Ethics of Private Property. Studies in Political Economy and Philosophy, 2nd ed., Ludwig von Mises Institute, Auburn, US Alabama. S. 33 – 75.
– Hoppe, H.-H. (1987), Eigentum, Anarchie und Staat. Studien zur Theorie des Kapitalismus, Westdeutscher Verlag, Opladen.
– Mises, L. v. (2013), Kritik des Interventionismus. Untersuchungen zur Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsideologie der Gegenwart, H. Akston Verlags GmbH, München.
– Mises, L. v. (1940), Nationalökonomie. Theorie des Handelns und des Wirtschaftens, Editions Union Genf.
– Mises, L. v. (1933), Grundprobleme der Nationalökonomie, Verlag von Gustav Fischer, Jena.
– Mises, L. v. (1932), Die Gemeinwirtschaft. Untersuchungen über den Sozialismus, Lucius & Lucius, Stuttgart.
– Mises, L. v. (1919), Nation, Staat und Wirtschaft, Beiträge zur Politik und Geschichte der Zeit, Manzsche Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, Wien und Leipzig.
– Polleit (2016), Hayek’s ‘denationalization of money’ – a praxeological reassessment (forthcoming; paper held at the Mises Institute Canada Conference 6 – 7 November 2015, Toronto).
– Puster, R. W. (2015), Dualismen und Hintergründe, Vorwort zu Theorie und Geschichte, Ludwig von Mises, S. 7 – 50.
– Rothbard, M. N. (2011), Praxeology: The Methodology of Austrian Economics, in: Economic Controversies, Ludwig von Mises Institute, Auburn, US Alabama, S. 59 – 79.
– Rothbard, M. N. (2009), Man, Economy, and State, The Scholar’s Edition, Ludwig von Mises Institute, Auburn, US Alabama.
– Rothbard, M. N. (1973), For A New Liberty. The Libertarian Manifesto, Ludwig von Mises Institute, Auburn, US Alabama.
– Rothbard, M. N. (1957), In Defense of extreme apriorism, in: Southern Economic Journal, January 1957, pp. 314 – 320.
– Woll, A. (1996), Allgemeine Volkswirtschaftslehre, 12. Auflage, Verlag Franz Vahlen, München.
[1] Siehe hierzu z. B. Hoppe (2009), Economic Science and the Austrian Method; Mises (1933), Grundprobleme der Nationalökonomie; Mises (1940), Nationalökonomie. Theorie des Handelns und Wirtschaftens; Rothbard (2002), In Defense of Extreme Apriorism; Rothbard (2011), Praxeology: The Methodology of Austrian Economics, siehe auch Puster (2015), Dualismen und Hintergründe, insb. S. 14 – 28.
[2] Hoppe (2006), Socialism: A Property or Knowledge Problem?; Siehe hierzu auch Polleit (2016), Hayek’s ‘dena-tionalization of money’ – a praxeological reassessment (forthcoming).
[3] Siehe hierzu Hoppe (2006), The Economics and Sociology of Taxation.
[4] Den Satz „Der Mensch handelt“ lässt sich nicht bestreiten. Wer zum Beispiel sagt, der Mensch handle nicht, der handelt – und widerspricht damit dem Gesagten. Aus dem Satz „Der Mensch handelt“ folgen weiter logische und wahre Erkenntnisse: Zum Handeln muss der handelnde Mensch Mittel (Güter) einsetzen. Diese Mittel sind knapp – denn wären sie es nicht, wären sie keine Güter. Handeln bedarf der Zeit. Zeitloses Handeln ist denkunmöglich – ansonsten wäre die Ziele, die der Handelnde anstrebt, sofort und unmittelbar erreicht, und ein Handeln wäre nicht mehr möglich – das aber lässt sich nicht widerspruchsfrei denken. Weil Zeit stets als Mittel des menschlichen Handelns erforderlich ist (und daher Zeit knapp ist), wird der handelnde Mensch ein Mehr an Gütern einem We-niger vorziehen; und er wird eine frühere Erfüllung seiner Ziele einer späteren vorziehen. Genau das bezeichnet man als Zeitpräferenz. Zur Erläuterung der Zeitpräferenz siehe Mises (1998), Human Action, Chapter 18 und 19; auch Hoppe (2006), Democracy – The God That Failed, hier: On Time Preference, Government, and the Process of Decivilization, S. 1 – 43.
[5] Siehe hierzu Hoppe (2010), A Theory of Socialism and Capitalism, Chapter 8, S. 173 – 196.
[6] Warum aber kommt es vor, dass Preise und Löhne nicht im ausreichenden Maße fallen, um die Produktionsfak-toren an die Nachfragewünsche anzupassen? Unternehmen mögen zögern, die Preise nach unten anzupassen, weil sie hoffen, die Absatzschwäche werde nur von kurzer Dauer sein. Sie spekulieren dann auf eine künftige Verbesse-rung der Wirtschaftslage. Wenn sich ihre Einschätzung erfüllt, war ihr unternehmerisches Handeln erfolgreich. Stellt sich die erhoffte Lage nicht ein, werden sie sich schließlich doch anpassen müssen – und dabei vielleicht höhere Verluste zu verkraften haben gegenüber dem Fall, in dem sie sich früher angepasst hätten. Wenn Löhne sich nicht nach unten anpassen, kann das eine Reihe von Gründen haben. Meist sind es politische. Beispielsweise ziehen es Unternehmen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten vor, die Belegschaft anstelle von Löhnen zu kürzen. Der Grund: Lohnkürzungen stoßen auf Widerstand, vor allem von Seiten der Gewerkschaften. Da ist es attraktiver, Arbeitnehmer (meist die weniger produktiven) in die Arbeitslosigkeit zu schicken und sie der staatlichen Arbeits-losenunterstützung zu überlassen.
[7] Siehe hierzu zum Beispiel Woll (1996), Allgemeine Volkswirtschaftslehre, S. 362 – 365. Für eine weiterführende Kritik siehe Boyes (2014), The Keynesian Multiplier Concept Ignores Crucial Opportunity Costs.
[8] Zum Beispiel ermitteln Fishback und Kachanovska (2015) für die Zeit der Großen Depression Multiplikatoren zwischen 0,4 und 0,96. Das heißt, ein US-Dollar, den die US-Administration ausgab, verdrängte zwischen 4 und 60 Prozent der privaten Ausgaben. Mit anderen Worten: Der Multiplikatoreffekt war hier also negativ.
[9] Auf den ethischen Aspekt der Fiskalpolitik wird hier nicht weiter eingegangen.
[10] Für eine Darstellung der Hauptstrom-Argumentation siehe zum Beispiel Grossekettler (2003), Öffentliche Fi-nanzen, insb. 575 – 585. Für eine Kritik an der Theorie der öffentlichen Güter siehe Hoppe (2006), Fallacies oft he Public Goods Theory and the Production of Security.
[11] Ein Frühstücksbrötchen ist z. B. ein privates Gut. Die Landesverteidigung, so wird gesagt, ist z. B. ein öffentli-ches Gut. Doch eine eindeutige Trennschärfe zwischen privaten und öffentlichen Gütern gibt es nicht: Man denke nur an Straßen und Leuchttürme, die zuerst privat, danach als öffentliche Güter einstuft wurden.
[12] Es handelt sich hier um ein Non sequitur: Wenn man einen Affen auf dem Fahrrad fahren sieht, kann man daraus nicht folgerichtig schlussfolgern, dass nur Affen Fahrrad fahren können.
[13] Siehe hierzu Mises (1940), Nationalökonomie, S. 188 – 198.
[14] Hier soll auf die entsprechende Literatur verwiesen werden. Zum Beispiel auf Rothbard (1973), For A New Lib-erty, Part II., 12. “The Public Sector: Policy, Law, and the Courts”, S. 301 – 327; Hoppe (2006), On Government and the Private Production of Defense S. 239 – 265; Hoppe (2012), The Private Production of Defense, S. 173 – 198.
[15] Siehe hierzu Mises (2013), Kritik des Interventionismus. Untersuchungen zur Wirtschaftspolitik und Wirt-schaftsideologie der Gegenwart.
[16] Hoppe (2010), A Theory of Socialism and Capitalism, S. 182.
[17] Die Löhne steigen inflationsbedingt an. Gleichzeitig steigt auch die Grenzbesteuerung, obwohl die Realein-kommen nicht gestiegen sind. Es kommt zur „kalten Besteuerung“, wenn die Einkommenstarife nicht an die Infla-tion angepasst werden (was i. d. R. nicht der Fall ist).
[18] Der Staat sorgt auch für die Fiktion, dass Staatsangestellte Steuern zahlen. „Buchhalterisch“ tun sie das. De facto aber tun sie das nicht: Würden alle (die Produktiven und die Staatsangestellten) keine Steuern mehr zahlen, so würde das Einkommen der Staatsangestellten nicht etwa von „Brutto“ auf „Netto“ fallen. Sie würden vielmehr „Null“ statt Netto kassieren. Siehe Hoppe (1987), Eigentum, Anarchie und Staat, S. 24.
[19] Mises (1923), Die geldtheoretische Seite des Stabilisierungsproblems, S. 32.
[20] Hayek (1960), Die Verfassung der Freiheit, S. 327.
[21] Mises (1932), Die Gemeinwirtschaft, S. 471.
————————————————————————————————————————————————————————
Thorsten Polleit, 48, ist seit April 2012 Chefvolkswirt der Degussa Goldhandel GmbH. Er ist Honorarprofessor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth, Adjunct Scholar am Ludwig von Mises Institute, Auburn, US Alabama, Mitglied im Forschungsnetzwerk „Research On money In The Economy“ (ROME) und Präsident des Ludwig von Mises Institut Deutschland. Er ist zudem Gründungsmitglied und Partner von Polleit & Riechert Investment Management LLP. Die private Website von Thorsten Polleit ist: www.thorsten-polleit.com. Hier Thorsten Polleit auf Twitter folgen.
*****
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Institut Deutschland wieder.