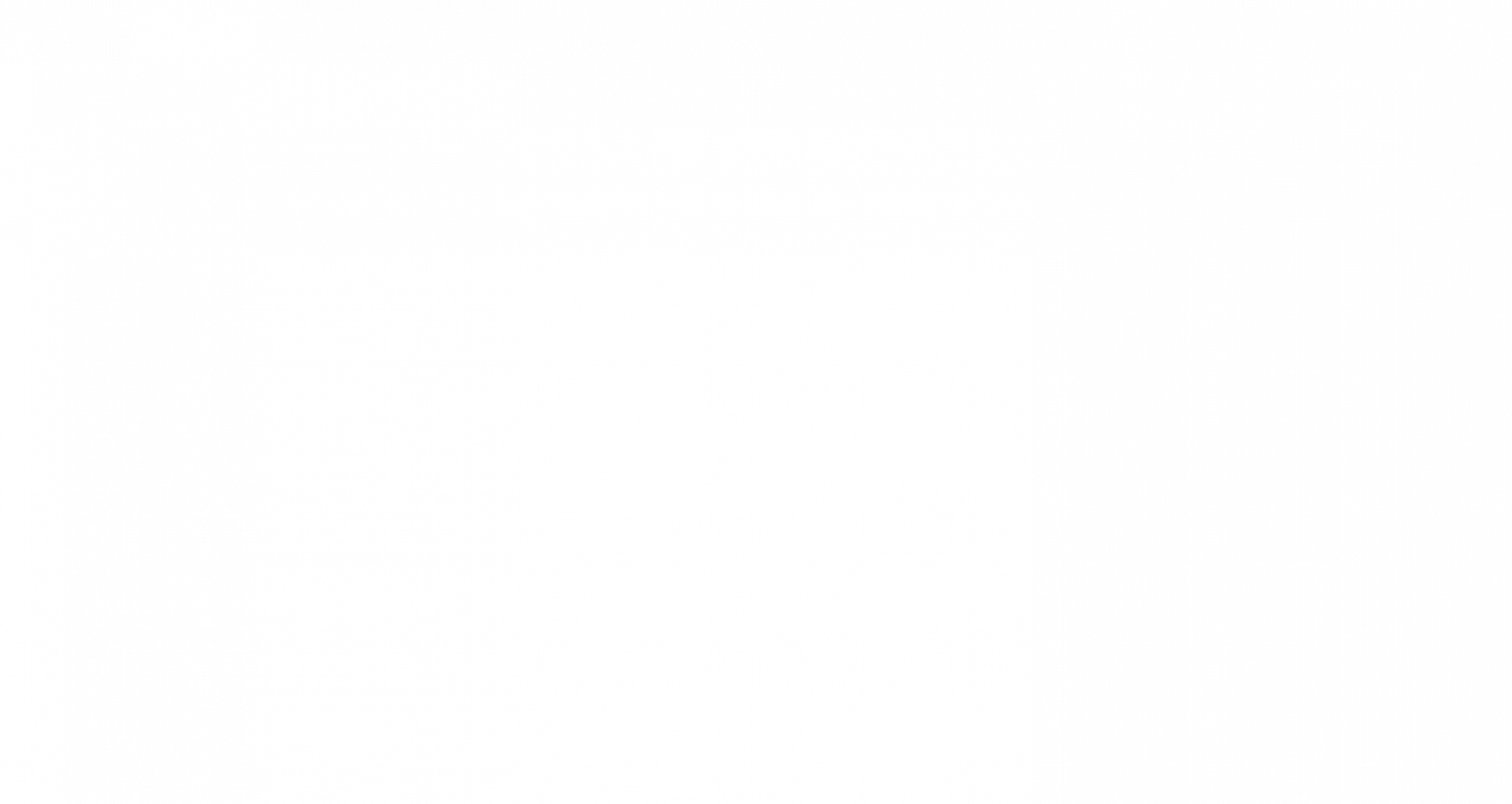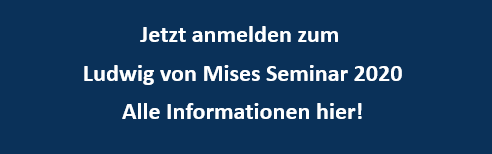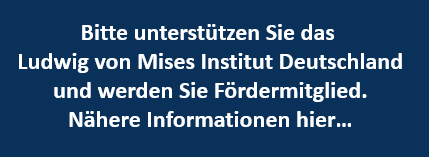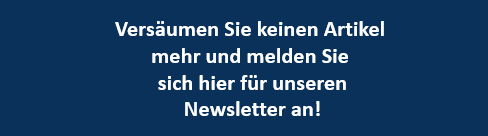Die Japanisierung der Europäischen Union
26. Februar 2020 – von Jesús Huerta de Soto
[Eröffnungsvortrag der Zwölften Konferenz über die Österreichische Schule der Nationalökonomie, organisiert vom Juan de Mariana Institut und der Universidad Rey Juan Carlos, 14. bis 15. Mai 2019]
Einleitung

Jesús Huerta de Soto
Das Thema meines heutigen Vortrags ist die Japanisierung der Europäischen Union. Ich möchte mit einer Feststellung beginnen, die Hayek in seinem Buch Die reine Theorie des Kapitals trifft.[1] Folgt man Hayek, dann ist der „beste Test für einen guten Ökonomen“ die Frage, ob er das Prinzip „Nachfrage nach Gütern ist nicht Nachfrage nach Arbeit“ versteht.[2] Demnach ist es ein Fehler, wenn man, wie es viele tun, denkt, dass allein eine Zunahme der Konsumgüternachfrage ein Beschäftigungswachstum auslösen würde. Wer diesem Glauben anhängt, verkennt das einfache Grundprinzip der Kapitaltheorie, das erklärt, warum dem nicht so ist: Ein Wachstum der Konsumgüternachfrage geht immer zu Lasten der Rücklagen und der Kapitalgüter. Und da die Beschäftigung größtenteils auf die Investitionsstufen verteilt ist, die der Konsumtion am weitesten vorgelagert sind, geht ein einfacher Anstieg sofortigen Konsums immer zu Lasten der Beschäftigung im Investitionsbereich und damit zu Lasten der Nettobeschäftigung.
Dem möchte ich meinen eigenen Test eines guten Ökonomen hinzufügen: der Professor Huerta de Soto Test. Folgt man meinen Kriterien, dann ist der beste Test zur Ermittlung eines guten Ökonomen (mit dem ich den hayekschen Test nicht schmälern will) die Frage, ob der Kandidat versteht, warum der Glaube, eine Geldspritze oder Geldmanipulation könne ökonomischen Wohlstand hervorbringen, ein schwerwiegender Irrtum ist. Mit anderen Worten: Folgt man Professor Huerta de Soto, dann erkennt man einen guten Ökonomen daran, dass er versteht, warum Geldflutung und Geldmanipulation niemals zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Prosperität führen können.
Logischerweise würde weder ein Keynesianer noch ein Monetarist meinen oder Hayeks Test bestehen. Mithin würden beide durchfallen und müssten das Semester wiederholen. Nehmen wir Keynes! Er hat nie verstanden, dass man auch dann Geld verdienen kann, wenn der Verkauf von Konsumgütern nicht steigt. Profit ist nämlich Einnahmen minus Kosten. Der Ertrag mag unverändert bleiben, aber wenn Sie die Kosten reduzieren, dann verdienen Sie dadurch Geld. Und wie kann man in einem Umfeld mit normalem Wirtschaftswachstum die Kosten weiter reduzieren? Nun, man ersetzt Arbeit (die in Relation zu Kapitalgütern teurer ist) durch Kapitalgüter. Und diese Investitionsgüter, welche die Beschäftigung in jenen Bereichen ersetzen, die den Konsumgütern am nächsten vorgelagert sind, müssen von irgendjemandem hergestellt werden, was wiederum viele Arbeitsplätze schafft. Maschinen schaden der Beschäftigung nie. Im Gegenteil, sie schaffen sie, und das im großen Stil.
Das ist etwas, das Keynes nie verstanden hat. Insofern hätte er weder Hayeks noch meinen Test bestanden. Das Gleiche würde jenem widerfahren, der, gemeinsam mit Keynes, nicht nur unserer Disziplin, der Wirtschaftswissenschaft, sondern auch der Gesellschaft extrem großen Schaden zugefügt hat. Der Schaden entstand vor allem, weil er in seinem Werk A Monetary History of the United States die Auffassung vertrat, die Weltwirtschaftskrise von 1929 sei auf das Versagen der Federal Reserve beim Versuch, genug Geld in den Kreislauf zu pumpen, zurückzuführen; soll heißen: ihre Eingriffe bzw. Geldmanipulationen waren unzureichend. Die Rede ist offenkundig von Milton Friedman (der derzeit von allen Zentralbankvertretern wegen seiner ultra-laxen Geldpolitik hochgelobt wird). Auch er wäre bei meiner Frage, warum Geldspritzen und Geldmanipulation niemals zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Prosperität führen können, durchgefallen.
Die Geschichte zeigt uns immer wieder, wie genau die Kernfrage, die Hayek und ich stellen, erkennen lässt, ob ein Ökonom wirklich versteht, worüber er bzw. sie spricht. Schauen wir z. B. auf die massenhafte Einfuhr wertvoller Metalle nach Spanien, die mit der Entdeckung Amerikas einsetzte. Dieser Zustrom führte ganz und gar nicht zu mehr Prosperität, sondern verwandelte Spanien in eine Öde, ja in eine wahrhaftige Wirtschaftswüste, die Jahrhunderte brauchte, um zu ihren Nachbarländern und deren ökonomischem Wohlstand aufzuschließen. Die Ankunft des Goldes trieb die Nominalpreise sogar nach oben. Das heißt, die Kaufkraft der Geldeinheit in Spanien sank. In der Folge waren die spanischen Produkte nicht länger wettbewerbsfähig und wurde es viel billiger, im Ausland einzukaufen. Kaum war das Gold im Land angekommen, verschwand es auch schon wieder über die Grenze, um die massenhaften Importe zu bezahlen. Was war die Folge dieses Prozesses? Die traditionellen Produkte der iberischen Halbinsel waren nicht länger konkurrenzfähig. Ihre Eigentümer gingen bankrott und mussten notgedrungen auswandern. Man muss bedenken, dass damals ein Spanier im Grunde drei verschiedene Berufswege einschlagen konnte: „in der Kirche, auf hoher See oder bei Hofe.“ Mit anderen Worten: Entweder wurde man Geistlicher bzw. trat einem Orden bei und lebte von kirchlichen Pfründen, oder man überquerte den Atlantik und suchte sein Glück in der neuen Welt, oder man diente dem König als Soldat in Flandern. All dies spricht für die traditionelle wirtschaftliche Rückständigkeit Spaniens und die dazu passende jahrhundertelange Lethargie und Unterentwicklung.
Die Geschichte kennt auch andere anschauliche Beispiele. Mit dem Auftreten des teilgedeckten Bankwesens gab es einen weiteren Versuch – zunächst ein privater, später dann einer, der in Kooperation mit Zentralbanken und staatlichen Stellen stattfand –, Geld in den Kreislauf zu pumpen, weil man dachte, dass die Wirtschaft von solchen Injektionen profitieren würde. Man hatte gewissermaßen die Idee, dass die Kreditschöpfung aus dem Nichts, die von keinerlei Ersparnissen getragen wird, etwas Positives und Vorteilhaftes sei. Zahllose Ökonomen haben diese Idee verfochten – unter ihnen auch renommierte Ökonomen wie Joseph Alois Schumpeter, der deshalb den Test auch nicht bestehen würde und bei mir im Examen durchfiele. Wir wollen hier allerdings nicht die destabilisierenden Auswirkungen des teilgedeckten Bankwesens auf das Wirtschaftssystem diskutieren. Sie sind ja bereits mit dem Inhalt meines Buches Geld, Bankkredit und Konjunkturzyklen und den darin ausgebreiteten Hauptargumenten vertraut.
Eine letzte, sehr deutliche Illustrierung der Bedeutung, die unserem Test zukommt, findet man in den wilden monetären Manipulationen und Geldspritzen, mit denen die Staaten überall auf der Welt auf die große Rezession von 2008 reagiert haben. Die Krönung dieser Reaktionen bildet das, was wir die „Japanische Wirtschaftskrankheit“ oder das „Leiden der ökonomischen Japanisierung“ nennen wollen. Was charakterisiert dieses Syndrom oder Gebrechen, diese „Japanische Wirtschaftskrankheit“? Wir schauen uns zunächst ihre Symptome an und analysieren sie dann anschließend nach den theoretischen Kriterien, die aus Sicht der Österreichischen Schule anzulegen sind. Danach erörtern wir, inwieweit diese Krankheit ansteckend ist und das Risiko besteht, dass sie andere Wirtschaftszonen, vor allem die Europäische Union, befällt. Doch bevor wir anfangen, die Symptome dieser Erkrankung zu analysieren, wollen wir den unmittelbaren historischen Hintergrund der japanischen Wirtschaft skizzieren.
Der Hintergrund der japanischen Wirtschaft von heute
Wir müssen bis in die 60er Jahre zurückgehen, aber vor allem in die 70er und frühen 80er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ich weiß nicht, inwieweit Ihnen bekannt ist (mir ist es ganz gewiss noch gegenwärtig, weil ich es damals während meines Masterstudiums der Betriebswirtschaftslehre an der Stanford Universität am eigenen Leibe gespürt habe), dass seinerzeit die japanische Wirtschaft, auch wenn dies uns heute verwundern mag, zu jenen Ökonomien in der Welt zählte, die man am meisten beneidet und bewundert hat. Das „Japanische Wirtschaftswunder“ wurde an jeder wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät eifrig erforscht. Die Menschen priesen und verehrten die Wirtschafts- und Unternehmenskultur der Japaner, die scheinbar irgendwie die Quadratur des Kreises hinbekommen hatten. Jede Firma behütete ihre Angestellten in einer quasi-familiären Atmosphäre und genoss im Gegenzug die vollkommene Loyalität ihrer Mitarbeiter. All dies stand im engen Zusammenhang mit konstanten Innovationen und kontinuierlichem Exportwachstum. Es stimmt, dass das Modell weitgehend darauf beruhte, zuvor in den USA und Europa entwickelte Innovationen und gemachte Entdeckungen zu kopieren und sie zu weitaus niedrigeren Preisen und mit einer anfangs qualitativ hinlänglichen und später sehr hohen Qualität auf den Markt zu bringen. Wie auch immer, dieses idealisierte Modell, dem jeder in jenen Dekaden nacheifern wollte, erwies sich weitgehend als ein Wunder. Es verschleierte die Tatsache, dass beide, die japanische Kultur und (vor allem) die japanische Ökonomie, extrem rigide und interventionistisch waren (und immer noch sind) und dass das, was damals eine sehr prosperierende und stabile Wirtschaft zu sein schien, eigentlich auf einer großen Blase aus künstlichen Wachstum, monetären Manipulationen und einer Kreditausweitung beruhte. Die Blase formierte sich hauptsächlich auf dem Grundstücksmarkt. Die Preise in den am meisten geschätzten Vierteln Tokios und anderer wichtiger Städte in Japan beliefen sich am Ende auf Tausende Yen; berechnet wurde nach Quadratzentimetern. In diesem Umfeld voller Euphorie und spekulativer Exzesse wurden die großen japanischen Industrieansiedlungen (zaibatsus) de facto zu spekulativen Finanzinstitutionen, die – gewissermaßen als zweites Standbein – auch Fahrzeuge, Elektrogeräte u. ä. herstellten. Dann, anfangs der 1990er Jahre, platzte die japanische Blase, ganz so, wie es die Österreichische Theorie der Konjunkturzyklen vorausgesagt hätte. Nur um Ihnen eine Vorstellung zu geben: der Nikkei Index fiel von 30.000 Yen zu Beginn der 90er Jahre auf 12.000 Yen am Ende der Dekade. Und auch heute noch, dreißig Jahr später, muss er sich nach wie vor erholen. Es gab einen katastrophalen Zusammenbruch des Aktienmarkts und zahlreiche der führenden Banken und Finanzinstitute gaben der Reihe nach auf.
Wir müssen unser Augenmerk nun darauf richten, wie die japanische Wirtschaft und die zuständigen Finanzbehörden auf das Platzen der Blase und das Einsetzen der Finanzkrise reagiert haben. Aber bevor wir dies tun, müssen wir uns die vier Szenarien in Erinnerung rufen, die auf das Zerspringen einer derart absurden und übergroßen Blase, wie jener in Japan, folgen können.
Die vier möglichen Szenarien, die im Anschluss an eine Finanzkrise eintreten können
Theoretisch gibt es vier Szenarien, die eintreten können, nachdem eine Blase zersprungen ist und die Krise und die Rezession, die unvermeidlich folgen, eingeschlagen haben. Erstens, die zuständigen wirtschaftlichen und monetären Behörden können darauf bestehen, weiterhin Geld in den Kreislauf zu pumpen, und die unendliche Flucht nach vorne antreten, um die Ankunft der Rezession zu verhindern. Wie die Geschichte immer wieder gezeigt hat, kommt es dann irgendwann zu einer Hyperinflation: z. B. nach dem 1. Weltkrieg, wo die Hyperinflation das deutsche Geldsystem nahezu zerstört und mit dafür gesorgt hat, dass Hitler an die Macht kam. Dieses Szenario ist möglich und hat sich bei verschiedenen Gelegenheiten in der Vergangenheit zugetragen, allerdings nicht während des jüngsten Konjunkturzyklus und auch nicht in Japan.
Das nächste Szenario ist das komplette Gegenteil. Es zeigt sich in einem absoluten und vollkommenen Zusammenbruch des Banken- und Finanzsystems. Wenn ein Geldsystem erst einmal verschwunden ist, dann muss es sich von neuem entwickeln und muss neues Geld eingeführt werden, das an die Stelle des zerstörten und funktionslosen Treuhandgeldes tritt. Auch dies ist ein mögliches Katastrophenszenario, das im letzten Konjunkturzyklus nicht eingetreten ist (auch nicht in früheren Zyklen, weil die Zentralbanken allein zu dem Zweck geschaffen wurden, die Privatbanken so weit wie möglich zu unterstützen, damit sie nicht der Reihe nach – wie bei einer Kettenreaktion – ihre Zahlungen einstellen müssen).
Das dritte Szenario ist das gebräuchlichste. Unter großen Schwierigkeiten und ungeachtet der rhetorischen oder tatsächlichen monetären Manipulationen, die mehr oder weniger zaghaft bzw. vereinzelt stattfinden können, wird die tatsächliche Ökonomie schließlich neu strukturiert und an die neue Situation angepasst. Anders gesagt, die Produktionsfaktoren werden im großen Stil den nicht nachhaltigen Investitionen entzogen und die Unternehmer gewinnen in dem neuen Umfeld einer relativ freien Marktwirtschaft ihr Vertrauen langsam wieder zurück. Sie beginnen, neue nachhaltige Geschäfts- und Investitionsprojekte zu entdecken, und auf diesem Wege kommt der Aufschwung nach und nach in Gang. Es stimmt, dass die Menschen nicht lernen. Sobald eine gesunde Erholung eingesetzt hat, werden politische und institutionelle Anreize früher oder später für eine neue künstliche Kreditausweitung sorgen und damit die Saat für den nächsten Zyklus ausstreuen, usw.
Das dritte Szenario ist dasjenige, das in der westlichen Welt immer dann eingetreten ist, wenn finanzielle Krisen und Rezessionen dort ihre verheerenden Folgen hinterlassen haben. Es hat sich z. B. in den USA abgespielt, und zwar im Anschluss an den Konjunkturzyklus, den man dort jüngst erlebte. Wir müssen bedenken, dass die Blase ihren Ursprung in der US-amerikanischen Wirtschaft hatte und die Federal Reserve nach der Krise eine riesige Geldmenge in den Kreislauf pumpte (mehr noch, zusammen mit Japan betrieb und steuerte die Federal Reserve die geldpolitische Lockerung). Wie auch immer, die amerikanische Wirtschaft ist eine der flexibelsten Ökonomien dieser Welt. Wenn etwas, relativ gesprochen, die amerikanische Wirtschaft charakterisiert, dann ist es ihre große Flexibilität und erstaunliche Fähigkeit, die Produktionsfaktoren rasch abzubauen und sie auf andere, nachhaltige Investitionen umzuschichten, die bis dahin dem ziemlich freien, rastlosen und kreativen Unternehmertum verborgen waren. Das ist der Grund, warum die amerikanische Wirtschaft trotz aller monetären Aggression und wachsendem Interventionismus sich immer wieder umstrukturiert und einen neuen Weg zu einem nachhaltigen Aufschwung findet. Es stimmt, dass die Erholung manchmal auf sich warten lässt. Ja auch derzeit hat sich die amerikanische Wirtschaft noch nicht neu geordnet und ihre Geldpolitik normalisiert. Wir wissen, dass die Zentralbanken sich sehr schwer damit tun, die Zinssätze zu erhöhen, und stets auf der Suche nach Ausflüchten sind, um sie zu senken. Wenn wir schon dabei sind: die langfristigen Zinssätze wurden auf 3 % angehoben (was nicht reicht, weil die Zinssätze bei 4 bis 5 % liegen sollten, wenn die Inflationsrate 2 % beträgt). Erst jüngst wurde aufgrund politischen Drucks und unter dem Vorwand wachsender Unsicherheit die monetäre Normalisierung ausgesetzt. Mehr noch, man ging sogar einen Schritt zurück und setzte die Zinssätze um einen Viertelpunkt herab. … Die amerikanische Wirtschaft ist jedenfalls sehr flexibel und somit ein typisches Beispiel dafür, dass eine Wirtschaft sich früher oder später wieder erholen wird.
Schließlich gibt es noch ein viertes Szenario, das dann eintritt, wenn das wirtschaftliche Umfeld, ganz anders als in den USA, sehr rigide und mit Steuern, Interventionismus und Regulierungen überfrachtet ist. Wenn in diesem sehr starren Milieu die zuständigen Währungshüter darauf bestehen, große Geldmengen in den Kreislauf zu pumpen, dann stellt sich das Syndrom, das ich die „Japanische Wirtschaftskrankheit“ oder „ökonomische Japanisierung“ nenne, unweigerlich ein. Und dieser Cocktail aus institutioneller Rigidität, hohen Steuern, stark regulierten Arbeitsmärkten sowie wachsendem Staatsinterventionismus in allen Wirtschaftsbereichen, intensiver Geldmanipulationen und unbegrenzter Geldspritzen ist genau das, was die japanische Wirtschaft auszeichnet und nun auf andere Wirtschaftsregionen in der Welt überzugreifen droht, an erster Stelle auf die Europäische Union.
Ja, die japanischen Währungshüter sind der platzenden Blase mit einer überaus laxen Geldpolitik entgegengetreten. Man hat sich auch dazu entschieden, die Kredite fortwährend zu verlängern. Mit anderen Worten, man hat den Unternehmen, die ihre Kredite nicht zurückzahlen können, neue Kredite angeboten, um mit ihnen die alten zu begleichen, usw. Die japanische Zentralbank hat dies alles mitgetragen und gefördert. In Japan ist es kulturell undenkbar, dass eine Firma scheitert. Es wird auch nicht kulturell akzeptiert, dass man Angestellte entlässt. Jede Firma ist wie die Mutter einer großen Familie. Sie muss allen Familienmitgliedern Sicherheit und Arbeit bieten. Obwohl die offiziellen Arbeitslosenzahlen sehr niedrig sein mögen und scheinbar jeder eine Arbeit hat, sollten wir nicht die Bilder aus den großen Abteilungen all der vielen japanischen Firmen vergessen, in denen die Angestellten schlafen oder nichts tun. Offiziell arbeiten sie, aber die versteckte Arbeitslosigkeit ist offenbar massiv, und der Rückgang an Produktivität und der zunehmende Verlust an Wettbewerbsfähigkeit sind enorm (vor allem im Vergleich zu China, Südkorea und den übrigen aufsteigenden Ökonomien in Asien). Zudem hat man die Zinssätze praktisch auf null gesenkt. Die Regierung hat noch eine aggressive Fiskalpolitik oben draufgesetzt und bläst damit die öffentlichen Ausgaben durch den Schornstein.
Nun, das ganze Paket dieser wirtschaftspolitischen Maßnahmen trägt die Verantwortung für den Ablauf des vierten Szenarios, das wir „Japanisierung“ genannt haben und dem mein heutiger Vortrag gilt. In einem Umfeld großer institutioneller und wirtschaftlicher Rigidität, wie es in Japan gegeben ist, ersticken massive Geldmanipulationen und ungezügelt wachsende Staatsausgaben jeden Anreiz für eine spontane Erholung der Wirtschaft im Keim. In der Folge werden die Produktionsfaktoren nicht von den Projekten, in die sie irrtümlich investiert wurden, auf nachhaltige Investitionsprojekte, die von Unternehmern nur in einem Umfeld der Freiheit, wirtschaftlichen Flexibilität und des Vertrauens entdeckt werden können, transferiert. Auf diese Weise ist Japan auf unbestimmte Dauer in eine Phase der Rezession und wirtschaftlichen Lethargie geraten, die nun schon Jahrzehnte anhält und von der Japan sich bis jetzt nicht befreien konnte.
Die sogenannten Abenomics und die derzeit wichtigsten Symptome des Syndroms der ökonomischen Japanisierung
Es wäre pointenlos und enervierend, alle Wechselfälle der japanischen Wirtschaft während der letzten Jahrzehnte zu analysieren. Stattdessen werden wir (was mein Anliegen vortrefflich veranschaulicht) unser Augenmerk auf die Abenomics richten und damit auf den jüngsten von zig Versuchen, die japanische Wirtschaft anzukurbeln. Abenomics ist eine Wirtschaftspolitik, die von allem ein bisschen mehr nimmt. Die Bezeichnung verdankt sie ihrem Namenspatron, dem japanischen Premierminister Shinzo Abe. Er hob Haruhiko Kuroda ins Amt, um als Chef der japanischen Zentralbank den inzwischen gescheiterten Versuch umzusetzen. Woraus setzt sich Abenomics zusammen? Wie bereits erwähnt, ist sie von allem ein bisschen mehr. Wenn etwas die japanische Wirtschaftspolitik charakterisiert, dann der Umstand, dass man – mit großer Begeisterung und Naivität – das komplette Arsenal an monetären und fiskalischen Interventionsrezepten, das sich in den Handbüchern des Monetarismus und Keynesianismus findet, eingesetzt und angewendet hat, allerdings ohne irgendetwas zu erreichen. Im letzten Kapitel der Abenomics ist die japanische Zentralbank eine (sofern dies überhaupt möglich war) noch aggressivere und gänzlich ultralaxe Geldpolitik eingegangen. Tatsächlich entsprang die „unkonventionelle Geldpolitik“ nicht der Federal Reserve, sondern der geldpolitischen Lockerung, welche die japanische Zentralbank wegweisend für andere genau im März 2011 zu implementieren begann. All dies wurde mit einer zusätzlichen Dosis an Staatsausgaben kombiniert, die noch größer und unverhältnismäßiger war und das fiskalische Defizit in die Höhe schnellen ließ. Genau auf dieses Rezept, von allem etwas mehr zu nehmen, setzte die japanische Staatsführung, um Japan aus seiner Lethargie zu reißen. Abgesehen von einer kurzlebigen wirtschaftlichen „Genesung“, die einer Abwertung des Yen folgte und die Exporte geringfügig ankurbelte, kam die Lethargie prompt zurück. Kurz gesagt, nichts wurde erreicht, außer dass man aus Japans Wirtschaft die höchstverschuldete in der Welt gemacht hatte.
Japans Staatsverschuldung beträgt sage und schreibe 250 % des Bruttoinlandsprodukts. Das ist leicht daher gesagt, denn hier in Europa kritisieren wir Portugal und Italien wegen ihrer Verschuldung von 110 bzw. 130 %, oder Griechenland wegen seiner 170 %. Erstere sind also gerade mal halb so stark verschuldet wie Japan mit seinen 250 % des Bruttoinlandsprodukts. Das jährliche Defizit in Japans öffentlichen Haushalten beträgt auch nicht jene 3 %, die in der Eurozone als Grenzwert festgelegt sind, auch nicht 4 oder 5 %. Nein, das jährliche Defizit des japanischen Staatshaushalts liegt bei 6 %, und das Wirtschaftswachstum bewegt sich fast auf einer Nulllinie. Mit anderen Worten, hier liegt ein klarer Fall ökonomischer Lethargie und sehr niedriger Inflation vor (den wir später noch erörtern werden): Zinssätze um die null oder gar negative Zinssätze, eine ein-prozentige Inflation und eine vermeintliche „Vollbeschäftigung“ (mit einer umfangreichen, versteckten Arbeitslosigkeit und anhaltenden Einbußen an Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit).
Um einen Begriff aus dem Militärwesen zu verwenden: Japan hat seine gesamte interventionistische Munition bereits verschossen. Nicht nur, dass das Land nichts erreicht hat, die Ergebnisse waren außerdem kontraproduktiv und enttäuschend. Alles, was man ausprobieren kann, wurde versucht, ohne die geringsten Anzeichen eines Erfolgs. Und die entscheidende Frage lautet nun: Warum wurde nichts erreicht? Die Antwort ist eindeutig: Es wurde deshalb nichts erreicht, weil es in all den Jahrzehnten keine strukturellen Reformen gab, die zu einer Liberalisierung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes geführt hätten, Deregulierungen inmitten des allgegenwärtigen und alles erdrückenden Interventionismus eingeführt und die Steuern im großen Stil gesenkt hätten oder den Haushalt umorganisiert bzw. ausgeglichen und die öffentlichen Ausgaben reduziert hätten.
Obwohl dies ein sehr trauriges Ergebnis ist, ist die Hauptbotschaft meines heutigen Vortrags eine andere, nämlich die, dass die Japanische Wirtschaftskrankheit bzw. ihr Krankheitsbild sehr leicht auf andere Ökonomien übergehen könnten und damit aufhören würden, eine exklusiv japanische Angelegenheit zu sein. Anders formuliert, das Japanisierungsszenario könnte sich in jeder anderen Ökonomie abspielen, sofern dort dieselben Bedingungen vorlägen und man ihnen auf dieselbe Weise begegnete – Bedingungen wie ein höchst rigides Umfeld ohne wirtschaftliche Flexibilität, in der die Unternehmer außerstande sind, das notwendige Vertrauen zurückzugewinnen, weil sie von Regulierungen, Steuern, Eingriffen und staatlichen Schikanen überfordert werden, ganz zu schweigen von den massiven monetären und fiskalischen Manipulationen. Bevor wir aber analysieren, inwiefern das Risiko besteht, dass dergleichen in der Europäischen Union eintritt, wollen wir zunächst einige analytische Reflexionen anstellen. Mit ihrer Hilfe können wir besser deuten, was geschehen könnte (sofern es nicht schon passiert ist). Was hat vor allem die Österreichische Wirtschaftstheorie zu dem Phänomen zu sagen, das mit der Japanischen Wirtschaftskrankheit bzw. dem Syndrom der ökonomischen Japanisierung einhergeht?
Die Österreichische Analyse des Syndroms der ökonomischen Japanisierung
Die Hauptbotschaft, die man mit den Analysemitteln der Österreichischen Schule aufzeigen kann, lässt sich in kurze Worte fassen: Der einzige Weg zur Wiederherstellung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Wohlstands im Anschluss an eine Spekulationsblase und Kreditausweitung führt über die Förderung der wirtschaftlichen Liberalisierung und des freien Unternehmertums auf allen Gebieten. Es gibt keinen anderen Weg.
Das bedeutet, dass in einer sehr rigiden Wirtschaft zahlreiche grundlegende Strukturreformen durchzuführen sind. Im Grunde sind sie alle mikroökonomischer Natur. Keine von ihnen hat mit makroökonomischen Manipulationen des Geldangebots oder der fiskalischen Ausgaben zu tun. Angesichts großer institutioneller Rigidität, finanzieller Krisen und wirtschaftlicher Rezessionen erliegen Politiker und Währungshüter zwangsläufig der Versuchung, sich auf derlei Manipulation einzulassen. Aber worin genau bestehen die notwendigen mikroökonomischen Reformen? Im Grunde bestehen sie in folgendem: der systematischen Deregulierung der Wirtschaft; der Liberalisierung der Märkte, vor allem des Arbeitsmarktes (die Schlüsselliberalisierung im Falle Japans und der Europäischen Union); der Reduzierung und Sanierung des öffentlichen Sektors und der Staatsausgaben; der Minimierung der Subventionen und der Reform des „Wohlfahrtsstaats“, die den Bürgern ihre Verantwortung zurückgibt; und der Senkung der Steuern, welche die Wirtschaftsakteure überfordern, vor allem der Steuern auf Unternehmensgewinne und Kapitalakkumulation.
Wir dürfen nicht vergessen, dass die Profite die Leitsignale der Unternehmer sind, die im Markt unablässig nach nachhaltigen Investitionsmöglichkeiten Ausschau halten. Ein Steuersystem, das sich vor allem auf die Gewinne stürzt, verstellt eigentlich nur die Verkehrssignale, die uns im Markt leiten. Dadurch werden die Wirtschaftsrechnungen unweigerlich chaotisch und kommt es zu Fehlallokationen knapper Ressourcen. Überdies haben Kapitalsteuern eine besonders widrige Auswirkung auf die Lohnempfänger; und damit auf jene, die am leichtesten verletzbar sind, weil ihr Lohn von ihrer Produktivität abhängt. Dieser wiederum hängt von der Menge des gut investierten Kapitals ab, das pro Arbeiter akkumuliert wurde. Was also braucht man zur Stimulierung der wirtschaftlichen Entwicklung und des Lohnwachstums? Eine Pro-Kopf-Akkumulation von Kapital für den kontinuierlich wachsenden Umfang wohlinvestierter Betriebsgüter. Wenn man aber die Kapitalisten schikaniert und das Kapital besteuert, dann blockiert man damit die Kapitalanhäufung, und zwar zu Lasten der Arbeitsproduktivität und, in letzter Instanz, der Löhne.
All die genannten Reformen sind darauf ausgerichtet, die dynamische Effizienz unserer Ökonomien anzuregen und ein Umfeld zu schaffen, in dem das unternehmerische Vertrauen sich schnell erholt und die Unternehmer die Investitionsfehler erkennen können, die in der Zeit der Blase begangen wurden, damit sie die Produktionsfaktoren von jenen Projekten, in die man sie irrtümlich investiert hat, im großen Stil auf nachhaltige Investitionsprojekte verlagern können. Diese neuen nachhaltigen Investitionsprojekte werden ganz gewiss nicht vom Staat oder von den Ministerien entdeckt, auch nicht von Staatsdienern oder -experten, sondern nur von einer Armee motivierter Unternehmer, die in einem Umfeld agieren, in dem sie ihr Vertrauen wiedergefunden haben.
Insofern brauchen wir ein Umfeld, das der Welt des Unternehmertums und der freien Wirtschaft freundlich gesonnen ist, ein Milieu, in dem die Steuern niedrig sind und den Steuerzahler nicht enteignen und in dem es für Unternehmer lohnt, die Unsicherheit auf sich zu nehmen, die in der kontinuierlichen Suche nach und Umsetzung von profitablen Investitionsprojekten liegt.
Aber was passiert, wenn diese strukturellen Reformen nicht angeregt werden, wenn keine umgesetzt wird, wenn stattdessen die Wirtschaft rigide bleibt und die einzigen Reaktionen die sind, die wir im Falle von Japan gesehen haben: eine Geldschwemme im großen Stil, Zinssätze, die auf null fallen, und wachsende Staatsausgaben? In dem Fall ergeben sich zwei wichtige Effekte. Erstens, eine ultralaxe Geldpolitik zerstört sich selbst. Anders ausgedrückt, sie hält sich selbst davon ab, ihr beabsichtigtes Ziel zu erreichen. Somit kann sie auch keines der erwarteten Ergebnisse hervorbringen (aus Gründen, auf die wir noch zurückkommen werden). Zweitens, eine ultralaxe Geldpolitik wirkt wie eine Droge. Sie hemmt jeden denkbaren politischen und institutionellen Anreiz, die notwendigen Strukturreformen zu lancieren, zu stärken und abzuschließen. Diese beiden Effekte sind die wichtigsten. Eine ultralaxe Geldpolitik ist selbstzerstörerisch und verfehlt ihre Ziele. Parallel dazu blockiert sie automatisch jeden Anreiz zur Durchführung struktureller Reformen in die richtige Richtung. Wie wir noch sehen werden, trifft dies auch uns in Europa, vor allem angesichts der Geldpolitik, die von der Europäischen Zentralbank verfolgt wird.
Es gibt verschiedene Gründe dafür, warum eine ultralaxe Geldpolitik selbstzerstörend ist. Ein Grund ist der, dass das gewaltsame Niedrighalten der Zinssätze nahe null die Möglichkeit, Barguthaben zu halten, praktisch eliminiert. Das heißt, in einer normalen Wirtschaft, in der die Zinsfüße zwischen 2 und 4% liegen, hat das Vorhalten von Bargeld Opportunitätskosten. Wenn Sie das Geld nicht investieren, dann bekommen sie auch nicht die Zinssätze. Wenn die Zentralbanken den Zinsfuß künstlich auf null senken, dann sind die Kosten für das Herumtragen des Bargelds in der Tasche gleich null, jedenfalls im Hinblick auf die Zinsen. Das erklärt auch, warum eine ultralaxe Geldpolitik pari passu mit einer steigenden Geldnachfrage einhergeht. Anders formuliert, die Menschen behalten viel von dem in den Kreislauf gepumpten Geld in ihren Taschen. Wenn obendrein, wie es in unseren Breiten geschieht, strukturelle Reformen ausbleiben, dann bleibt die Wirtschaft stark rigide und befeuert damit die Sorge um die Zukunft in erheblichem Maße. Einer der Hauptgründe für die Vorhaltung von Bargeldbeständen ist genau der, dass man unerwarteten Ereignissen, die eintreten könnten, vorbereitet begegnen will. Der Wunsch, die Unsicherheiten der Zukunft meistern zu können, ist einer der zentralen Gründe, die uns Geld nachfragen lassen. In Zeiten, in denen eine große Unsicherheit herrscht, eine rigide wie auch stark kontrollierte Wirtschaft mit Geldspritzen geflutet wird und die Opportunitätskosten der Bargeldvorhaltung gleich null sind, ist es zweifellos das Vernünftigste, wenn Sie an Ihrer Liquidität festhalten.
Wir müssen dem hinzufügen, dass die meisten Unternehmer immer noch argwöhnisch und ängstlich sind, und zwar aufgrund dessen, was während der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise geschah. Damals erlitten sie große Verluste, und sie erkennen, dass die Wirtschaft immer noch stark kontrolliert ist. Es ist fast unmöglich, auch nur einen Fuß vor die Tür zu setzen, ohne vorher die Behörden um Erlaubnis zu fragen. Es gibt viele bürokratische und arbeitsrechtliche Schwierigkeiten usw. Zudem ist den Unternehmern voll bewusst, dass der Staat ihnen dann, wenn sie trotz alledem ins Schwarze treffen und Erfolg haben, durch vielerlei Steuern (Körperschaftsteuer, Einkommensteuer und Vermögensteuer) mehr als die Hälfte ihres Gewinns wegnehmen wird. Unter solchen Bedingungen kann man verstehen, dass es für Unternehmer eine große Versuchung ist, das Handtuch zu werfen und dem Ärger aus dem Weg zu gehen. (Der Spruch „Que invierta su puta madre!” – „Lass einen anderen Idioten investieren!” – bringt dieses Gefühl zum Ausdruck. Er prangt auf den T-Shirts, die meine Studenten selbst entworfen und auf dem Universitätsgelände mit großem Erfolg unter die Leute gebracht haben.)
Wir müssen bedenken, dass alle wirtschaftlichen Handlungen inkrementell stattfinden und dass darüber hinaus tausende von einleitenden Schritten, die man in die richtige Richtung hätte unternehmen müssen, um nachhaltige Unternehmensprojekte ausfindig zu machen und umzusetzen, einfach ausbleiben. Genau das kennzeichnet den Unterschied zwischen einer Ökonomie, die einen Anlauf nimmt, um – wenn auch vielleicht mit großen Schwierigkeiten, wie im Falle der USA – wieder auf die Füße zu kommen, und einer Ökonomie, die – wie im Falle Japans – auf unbegrenzte Dauer in Lethargie und Rezession versinkt. Wie auch immer, die Zentralbanken reden uns ein, die Lösung liege in der massenhaften Flutung mit Geld und in der Senkung der Zinssätze auf null, damit die Banken (rentabel oder nicht) Kredite gewähren können und die Menschen dazu animiert werden, sie nachzufragen. Und damit die Banken ja keine Fehler machen und ihr Geld weise verleihen (nicht an die falschen Leute), werden alle möglichen Vorkehrungen, Überwachungen und Bankregularien (Basel I, II und III), die mit immer schärferen Anforderungen an das Kapital einhergehen, ins Leben gerufen, usw. Aber was passiert letzten Endes? Nun, die Banken können das Geld nicht mehr verleihen, sondern vergeben es kostenlos, weil die normalen Unternehmer als Gruppe in einem Umfeld, in dem große Unsicherheit und Misstrauen herrschen, sich bedeckt geben und ihre alten Darlehen schneller zurückgeben als sie neue nachfragen. Das löst eine zusätzliche Geldkontraktion aus, welche die erwarteten Effekte der Geldschwemme weitgehend blockiert bzw. kompensiert und lahmlegt.
Mithin sind Geldspritzen selbstzerstörend. Sie erreichen keines ihrer Ziele. Sie blockieren und lähmen die Markterholung, den Wohlstand aber erhöhen sie nie.
Damit wären wir beim größten Ärgernis angekommen: negative Zinssätze. In einer natürlichen und unregulierten Marktwirtschaft können die Zinssätze niemals negativ sein. Wenn die Zinsrate negativ ist – wenn man den Menschen z. B. 1.000 € mit der Auflage leiht, dass sie am Jahresende 990 € zurückzahlen –, dann ermuntert man sie offensichtlich dazu, nichts zu tun und Investitionen zu vermeiden. Und man motiviert die Menschen dazu, das Geld in ihren Taschen zu behalten und am Ende des Jahres genau 990 € zurückzuzahlen und 10 € Gewinn einzustreichen, ohne etwas tun oder ein unternehmerisches Risiko eingehen zu müssen, geschweige denn bürokratische Schikanen oder Begriffsstutzigkeit über sich ergehen lassen zu müssen. Wenn ich aber als Unternehmer Unannehmlichkeiten herausfordere, investiere und die Sache am Ende danebengeht, dann kann ich noch nicht einmal die 990 € zurückzahlen. Und dabei lerne ich noch, wie man mir die Hälfte wegnimmt, der Staat hinter mir her ist und die Gewerkschaften mir das Leben schwermachen. Anders sieht es im Falle negativer Zinssätze aus. Das Beste, was man machen kann, ist, dauernd Kredite nachzufragen, darauf sitzen zu bleiben und am Ende weniger zurückzuzahlen, als man geborgt hat. So kann man die Differenz als sicheren Profit behalten, ohne auch nur das geringste Risiko zu tragen. So, wie sie angedacht ist, führt die negative Zinsrate direkt zu Nichtstun, Lethargie und ökonomischer Japanisierung.
Die anomale Geldpolitik negativer Zinsfüße hat obendrein noch einen anderen sehr schädlichen Nebeneffekt. Man benutzt sie nämlich automatisch dazu, das Staatsdefizit kostenfrei und unbegrenzt zu finanzieren. Damit blockiert man die wenigen Anreize, die den Staaten noch verblieben sind, um irgendwelche Strukturreformen durchzusetzen. Stattdessen ermuntert eine solche Geldpolitik die entsprechenden Stellen dazu, die Subventionspolitik auszubauen und Stimmen zu kaufen. Dies führt unweigerlich dazu, dass unsere Gesellschaften in Demagogie und Populismus versinken. Eine kristallklare Illustration für das, was ich hier schildere, gibt es auch. Bei uns in Spanien, wie auch im übrigen Europa, hat die Europäische Zentralbank 2015 fast täglich die Geldpolitik gelockert. Damit waren alle Reformen wirkungslos. Die Länder, die sie am nötigsten hatten und drauf und dran waren, sie zu verabschieden, haben sie ad acta gelegt. Mithin erreicht man mit einer Politik monetärer Manipulation keines der gewollten Ziele. Derlei Politik ist selbstzerstörend und verhindert die einzigen Dinge, die unser Land aus seiner Lethargie reißen könnten, nämlich unverzichtbare Strukturreformen und ökonomische Liberalisierung.
Und nun der Todesstoß. Sprachlos und verdutzt erkennt man in den Zentralbanken, dass man keines der Ziele erreicht und die Ökonomien in Drogenabhängige verwandelt hat. Schon die geringste Andeutung, dass man die Stimulanzen absetzen will, lassen die Ökonomien in eine Rezession versinken. Und weil die zuständigen Behörden keinen Ausweg aus dem selbst erschaffenen Teufelskreis sehen, ist das einzige, was ihnen einfällt, die Empfehlung einer Fiskalpolitik, die mit einem kräftigen Anstieg der Staatsausgaben einhergeht. Das ist sogar noch schlimmer, weil es die wahre Wirtschaft noch mehr verzerrt, weil nun zahlreiche Produktionsfaktoren in Projekte verlagert werden, die vom Staat abhängen und genauso wenig Nachhaltigkeit besitzen wie die politische Entscheidung selbst. In Spanien z. B. ist die Beschäftigung hauptsächlich wegen des öffentlichen Sektors und Projekten in dessen Namen gewachsen (und im Falle Japans wegen Projekten, die mit den Olympischen Spielen 2020 verbunden sind). Die Beschäftigungszunahme im öffentlichen Sektor ist aber nicht nachhaltig. Ihr Bestand wird nicht von der Konsumentennachfrage getragen. Sie hängt allein von den künftigen Entscheidungen ab, welche die Politiker entweder zugunsten oder zuungunsten der Beschäftigung treffen. Noch einmal, derlei Fiskalpolitik ebnet einer noch stärkeren Ausbreitung der Japanischen Wirtschaftskrankheit (sofern diese überhaupt möglich ist) den Boden.
Wie wahrscheinlich die Japanische Krankheit andere Wirtschaftsregionen befällt: der Fall der Europäischen Union
Analysieren wir nun, welche Auswirkung die Japanische Krankheit auf andere Wirtschaftsregionen gehabt hat, vor allem seit der letzten Finanzkrise und der großen Rezession 2008.
Ich will mich nicht zu sehr über die USA auslassen. Ich erwähnte bereits, dass der grundlegende Unterschied zwischen der japanischen und US-amerikanischen Ökonomie der ist, dass letztere weitaus flinker und flexibler ist. Aus diesem Grund hat die amerikanische Wirtschaft trotz aller Fehler und monetären Aggression sich recht rasch wieder gefangen. Das heißt, sie hat ungeachtet der geldpolitischen Lockerung die Rezession recht schnell hinter sich gelassen, weil man sie erheblich umstrukturiert und viele der begangenen Fehler behoben hat. Vollkommen erfolgreich war man aber nicht. Es gibt immer noch sehr große Firmen in der amerikanischen Wirtschaft, die weitgehend vom billigen Geld abhängen. Jedenfalls haben die Amerikaner den Mut gehabt, die Zinssätze zu heben. Allerdings sind sie nur zaghaft vorgegangen und später wieder zurückgerudert. Das könnte auch bedeuten, dass sie in der Frühphase einer neuen Kreditausweitung stecken. Diese wäre dann ein Anzeichen für einen neuen Zyklus in ein paar Jahren. Trumps Protektionspolitik hat hier ein Hindernis errichtet, weil neue Tarife, wenn sie erst einmal etabliert sind, eine Fehlallokation der Produktionsfaktoren künstlich forcieren. Diese verteilen sich dann auf die stärker abgeschottete Wirtschafts- und Unternehmensstruktur, d. h. auf eine Struktur, die weniger produktiv und außenhandelsfreundlich ist. Genau diese neu hinzugefügte Unsicherheit hat die Federal Reserve zum Anlass genommen, um die Suspendierung bzw. Umkehrung ihrer Normalisierung anstrebenden Geldpolitik zu rechtfertigen. Schon der kleinste Vorwand genügt den Zentralbanken, um ihre Senkung der Zinssätze zu rechtfertigen. Sie aber wieder zu heben, fällt ihnen sehr schwer. Wie auch immer und obwohl die US-amerikanische Wirtschaft die größte der Welt ist, wollen wir nicht länger bei den USA und ihren Sonderproblemen verweilen. Stattdessen wollen wir unser Augenmerk auf die Wirtschaftsregion richten, die uns am nächsten liegt und derzeit am meisten interessiert.
Der Fall der Europäischen Union ist bei weitem interessanter. Beginnen wir mit der Politik der Europäischen Zentralbank (EZB). Sie hat zwei unterschiedliche Phasen durchlaufen. In einer ersten Phase ist die EZB eingeschritten – mehr oder weniger so wie die Federal Reserve, allerdings ohne den ersten Schritt zu einer aggressiven geldpolitischen Lockerung. In dieser ersten Phase, die bis 2015 anhielt, diente der Euro zur Disziplinierung der verschwenderischsten Regierungen in Europa, vor allem jener in der Peripherie der Union. Weil das Haushaltsdefizit gewissen Anforderungen genügen musste, gab es in einzelnen Ländern – auch in Spanien – eine Krise der Staatsverschuldung (aber keine Eurokrise). Die Europäische Zentralbank nutzte diese Krise, um jenen Ländern, auch Spanien, die Durchführung einer notwendigen Reform aufzuzwingen. Die EZB intervenierte auch in die Ökonomien einzelner Länder, darunter Irland, Griechenland und Portugal. In den Ländern, in denen die Reformen in Kraft traten, wurde die Wirtschaft umstrukturiert und die Krise überwinden. Das trifft z. B. auf unser Land, Spanien, zu. Die Regierung ging unter großen Schwierigkeiten halbherzig vor und beging den schweren Fehler, der Steuererhebung mehr Gewicht beizulegen als der Kürzung der Staatsausgaben. Aber sie unternahm auch einige Schritte in die richtige Richtung, darunter eine Strukturreform, die unsere Wirtschaft brauchte.
Das ernsthafteste Problem ergab sich in der zweiten Phase, als die EZB vollkommen unnötig (das M3-Wachstum hatte zum Jahresbeginn 2015 schon fast 4 % erreicht) durch Senkung der Zinssätze auf null eine ultralaxe Geldpolitik ergriff und obendrein selbst eine höchst aggressive geldpolitische Lockerung einführte. Die EZB erwarb tatsächlich Monat für Monat Staatsschulden und Gemeinschaftsschulden in Höhe von 80 Milliarden Euro. Das bedeutet, dass jedes Jahr eine Billion Euro neu geschaffen (bzw. mehr in der Bilanz der EZB verbucht) wurden. Das entsprach für vier lange Jahre – 2015, 2016, 2017 und 2018 – ca. 10 % des jährlichen Bruttoinlandsproduktes der Eurozone. Danach wurde das Programm zeitweilig gestoppt und dann im November 2019 – auf dem Höhepunkt einer scharfen Kontroverse und gegen den Widerstand von Deutschland, Frankreich, Holland und anderer Staaten – erneut eingeführt (mit monatlichen Schritten à 20 Milliarden Euro).
Die zweite Phase der EZB war verheerend. Sobald die ultralaxe Geldpolitik einsetzte, hingen – wie der Fall Spanien veranschaulicht – plötzlich sämtliche strukturpolitischen Reformen, Ausgabenreduzierungen und die für die rigide europäische Wirtschaft so dringend gebrauchten Liberalisierungen in der Luft. Gewiss, im Vergleich zu Japan setzt sich Europa aus einem Sortiment heterogener Ökonomien zusammen. Während Japan eine sehr einheitliche Wirtschaft und Gesellschaft darstellt, zeigt Europa eine weitaus größere ökonomische Vielfalt. Einige Wirtschaften in Europa stehen bereits auf einem recht gesunden Fundament, unter anderem aus historischen und politischen Gründen, wie z. B. für die deutsche Wirtschaft. Andere Ökonomien sind sehr rigide. Sie sind ungeachtet ihres Wohlstands gewissermaßen mehr japanisiert und in der Tat die „kranken Wirtschaften Europas“. Ich meine Frankreich und vor allem Italien. Die Liste der ausstehenden Wirtschaftsreformen in diesen Ländern ist sehr lang. Eingeführt haben diese Länder praktisch noch keine, vor allem weil die EZB damit angefangen hat, ihre Schulden aufzukaufen. Eine andere Gruppe von Ländern hingegen hat Strukturreformen in die richtige Richtung begonnen. Einige von ihnen – z. B. Irland und Portugal, ja sogar Griechenland – haben sie schon fast zu Ende gebracht. Andere indes – wie z. B. Spanien – sind auf halbem Weg. Jene Länder, die es geschafft haben, ihre Reformen abzuschließen, können sich glücklich wähnen. Aber in Spanien wurden alle Folgereformen – also jene, die geplant wurden, aber pendent sind – aufgeschoben. Wenn wir nicht aufpassen, dann wird das große gesellschaftliche und wirtschaftliche Kosten haben, vor allem wenn infolge der Steuererhöhungen und Ausgabensteigerungen, die von der sozialistischen Regierung angekündigt wurden, der Populismus erstarkt.
Die deutsche Ökonomie ist in mehrfacher Hinsicht beispielhaft. Zunächst einmal ist sie eine Exportmacht. Aber wie kam es dazu, dass sie so viel exportierte. Sie exportiert so viel, weil sie sehr hochwertige Produkte herstellt. Und warum stellt sie Produkte in herausragender Qualität her? Weil die deutsche Unternehmenskultur traditionellerweise in einem sehr schwierigen Handelsumfeld groß wurde. Ich meine die Währung, die deutsche Mark. Sie wurde stets aufgewertet. Das machte sie härter, aber auch das Exportieren härter. In einem solchen Umfeld gibt es nur einen Weg, Produkte zu exportieren: Man muss die besten Produkte der Welt herstellen. Anders ausgedrückt, die Deutschen hatten keine andere Wahl, als die besten Produkte zu entdecken, zu erfinden, herzustellen und in die Welt auszuführen – egal ob Fahrzeuge, feinmechanische Instrumente oder Maschinen u. ä. So wurde Deutschland trotz aller irreführender Logik, die dem von Keynesianern und Monetaristen befürworteten Wettbewerb der Währungsabwertung innewohnt, eine der größten Exportmächte weltweit. Für die Keynesianer und Monetaristen mit ihrer protektionistischen Denkweise ist dies ein Schlag ins Gesicht. Eine starke, nicht eine schwache Währung ist der Treibstoff für den Erfolg als Unternehmer und den Triumpf als Exporteur. Aber die meisten Analysten lassen sich von ihren mathematischen Modellen gedanklich verwirren. In ihnen erscheint der Abwertungswettbewerb das Idealrezept, weil er unmittelbar zu einem sichtbaren Wohlstand führt. Doch dieser ist kurzfristig und Folge eines flüchtigen Exportwachstums, das jede Abwertung auslösen kann. Solch ein Wohlstand ist das „Brot für heute und der Hunger für morgen“. Er ist ganz und gar trügerisch und kurzlebig. Und er führt unweigerlich zu Kosten, weil er den innovativen und kreativen Unternehmergeist lähmt, den Antrieb, die Dinge besser und besser zu machen. Warum sollten wir uns anstrengen, wenn unsere Produkte sich mit einer schwachen Währung von selbst verkaufen? Sie erinnern sich an meinen „besten Test für einen guten Ökonomen“? Monetäre und fiskalische Manipulationen werden nie einen nachhaltigen Wohlstand produzieren. Ganz im Gegenteil! Allein, die meisten meiner Kollegen würden bei mir im Examen durchfallen. Der beste Beweis dafür ist, dass sie unentwegt geldpolitische Lockerungen lobpreisen; und zwar jedes Mal, wenn man sie in Europa einsetzt. Diese Politik hat den Euro zweifellos abgewertet. Und der Wertverlust des Euro hat Deutschland gestattet, seine Produkte kurzfristig viel leichter zu exportieren. In der Folge hat es seinen traditionellen Wettbewerbsvorteil, der auf kontinuierlichen Qualitätsverbesserungen gründet, entsprechend vernachlässigt. Der abgewertete Euro wirkte wie eine Droge. Er hat der deutschen Wirtschaft Speck statt Muskeln beschert und ihr bis zu einem gewissen Grade erlaubt, sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen. Demzufolge muss Deutschland nun mindestens seine verkümmerten Muskeln wieder aufbauen, wenn das Land nicht in eine Rezession geraten will.
In Frankreich und Italien sieht es ganz anders aus. Ihre Ökonomien sind sehr rigide, und es ist dort praktisch unmöglich, auch nur eine einzige Reform durchzusetzen. Nehmen wir z. B. Macron und all seine Reformversprechen, von denen er praktisch keines eingelöst hat. Reformen in Frankreich einführen? Niemals! Das ist praktisch unmöglich, und so nähert Frankreich, ein sehr wohlhabendes Land, sich rasch der Japanisierung und der krankhaft maßlosen Lethargie.
Italiens Lage, obwohl weitaus pittoresker, ist noch schlimmer als die Frankreichs. Das gilt auch für die übrigen der bereits angesprochenen peripheren Länder, vor allem für unser Land, für Spanien. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass das Wirtschaftswachstum, dessen Spanien sich dank der zaghaften, zielführenden Reformen in der Vergangenheit und einem gelegentlichen, nun aber abflauenden Rückenwind erfreut hat, nachlässt. Diese Entwicklung verheißt sicherlich nichts Gutes, vor allem dann nicht, wenn, wie von der sozialistischen Regierung angekündigt, die Steuern und Staatsausgaben steigen und die Regulierungen strenger werden (Wachstum der Minimallöhne, Regulierung des Wohnungsmarktes, Stechuhrpflicht für Arbeiter usw.)
Einige unnachhaltige Wirtschaftsmythen
Ich möchte mit einigen kritischen Bemerkungen zu sehr wirkmächtigen und lästigen Wirtschaftsmythen enden, von denen wir immer und immer wieder aus den Zeitungen und dem Fernsehen erfahren.
Der erste Mythos besagt, dass die Anhebung des Mindestlohns in Spanien (von 600 auf 900 €, bald womöglich auf 1.000 oder 1.200 €) keine negative Auswirkung auf die Beschäftigung habe. Die Wirtschaftstheorie zeigt aber etwas ganz anderes, nämlich dass jede Anhebung des Mindestlohns die Arbeitslosigkeit, die Schattenwirtschaft und die Fehlallokation des Faktors Arbeit anheizt. In der Theorie gehen diese negativen Wirkungen nur in einem Fall nicht mit der Anhebung des Mindestlohns einher, nämlich dann, wenn die Regierung den neuen Lohn tiefer ansetzt als jenen, der bereits im freien Markt existiert. Aber warum sollte man in einem solchen Fall überhaupt einen Mindestlohn festsetzen? Wie immer man es dreht, es würde nichts bringen. Würde man es dennoch tun und gäbe es unter allen Berufen und Löhnen auch nur einen Arbeiter, dessen diskontiertes Grenzprodukt unterhalb des legalen Lohnminimums läge, dann wäre allein das ausreichend, dass er nicht eingestellt würde oder, sofern er schon einen Arbeitsplatz hätte, dass er entlassen würde. Als Maßnahme würden Mindestlöhne zweifellos – was sie ohnehin schon tun – Arbeitslosigkeit und Ressourcenfehlallokation verursachen (während es in der Wirtschaft stets zu graduellen Änderungen in den Grenzbereichen kommt). Die Bank von Spanien selbst hat eine Studie veröffentlicht, in der sie den Verlust von mindestens 150.000 Arbeitsplätzen prognostiziert, die allesamt von Personen eingenommen werden, die am leichtesten angreifbar sind (junge Menschen, die erst seit kurzem erwerbstätig sind, Frauen, Immigranten u. a.) Es ist z. B. klar, dass einem Immigrant, der nur unter großen Mühen in den Genuss ordentlicher Arbeitspapiere gekommen ist, schwere Zeiten bei der Arbeitssuche bevorstehen, bedenkt man, dass die Kosten, die ein einstellungswilliger Unternehmer zu tragen hat, einschließlich sozialer Absicherung über 16.000 € pro Jahr betragen (14 Monatsgehälter à 900 € plus 30% für die soziale Absicherung). Niemand wird ihn einstellen! (Und es können ganz gewiss nur sehr wenige Familien 16.000 € im Jahr für Angestellte aufbringen, die sich um ältere Familienmitglieder kümmern, oder um den Haushalt – ein Sektor, der bislang Hunderttausende beschäftigt hat.) Unser Immigrant wird also höchstwahrscheinlich dazu genötigt sein, von einer Schattenwirtschaft in die andere zu wandern. Die Heuchelei der Regierung raubt einem den Atem. Wir begrüßen jeden („Flüchtlinge willkommen!“), doch wohlgemerkt, keiner findet hier in der offiziellen Ökonomie einen Arbeitsplatz, weil der Mindestlohn 900 € beträgt und die Regierung plant, ihn auf 1.000 oder 1.200 € anzuheben. (Warum hebt man ihn nicht gleich auf 2.000 € oder mehr an, wenn die Beschäftigung von der Anhebung unberührt bleibt?)
Der zweite Mythos, zu dem ich mich schon oft geäußert habe, ist der, dass die Zentralbanken unsere Ökonomien während der großen Rezession gerettet hätten. Er ist der Mythos vom Feuermann alias Brandstifter, weil es keine geringeren als die Zentralbanken waren, die orchestral die Kreditexpansion betrieben und die Blase erzeugt haben, die später unweigerlich in die Krise und Rezession geführt hat. Und jetzt sehen sie aus wie die Retter in der Not, weil sie die Banken vor dem Niedergang gerettet haben. Nun ja, sie haben Bankia gerettet, aber Banco Popular ließen sie untergehen, weil sie kleiner war. Sie haben Fehler gemacht, so wie man damals den Zusammenbruch von Lehman Brothers zuließ, was beinahe alles andere hätte miteinstürzen lassen. Die Zentralbanken sind eindeutig unverantwortlich vorgegangen, als sie ad hoc einschritten und damit eine große Unsicherheit und eine dauerhafte finanzielle Instabilität auslösten.
Der dritte Mythos besagt, dass die geldpolitische Lockerung notwendig gewesen sei, um eine Deflationskrise zu vermeiden. Das stimmt nicht. Die europäische geldpolitische Lockerung war z. B. unnötig. Als sie im Januar 2015 in die Wege geleitet wurde, wuchs die europäische Geldmenge M3 schon aus sich heraus mit einer Rate von 4 % und lag damit sehr nahe an der avisierten Grenzmarke von 4,5 %. Eine geldpolitische Lockerung war also unnötig. Überdies hatte sie, wie ich bereits ausführte, einen sehr schädlichen und selbstzerstörerischen Effekt und blockierte die Reformen, welche die Eurozone gebraucht hätte. Nach der Lockerung war auch bald Mario Draghis altes Mantra, dass die Geldpolitik keinem Mitgliedsstaat die notwendigen Reformen zur Einhaltung der Maastrichtverpflichtungen ersparen könne, mehr oder weniger vergessen. An seine Stelle trat der verzweifelte Ruf nach mehr Staatsausgaben. Inzwischen dürfte klar sein, dass keiner an Strukturreformen arbeitet, weil die Europäische Zentralbank die Länder kostenlos finanziert. Es wäre somit heuchlerisch, weiterhin von solchen Reformen zu reden. Die EZB hat ihre Grundsätze offensichtlich verraten. Inzwischen finanziert sie die Haushaltsdefizite aller Länder. (Man darf nicht vergessen, dass ihr bereits 30 % aller ausstehenden Haushaltsschulden, auch die Spaniens, gehören.) Oberndrein versucht sie (wie die Federal Reserve), das Wirtschaftswachstum zu stimulieren, obwohl sie nur dazu autorisiert ist, die Geldstabilität zu wahren. Die EZB hat sich also zur Geisel ihrer eigenen Fehler gemacht, ihrer ultralaxen Geldpolitik. In dem Moment, in dem sie eine Abkehr von dieser Politik verkündet, wird eine Rezession einschlagen, mit der dann niemand sich befassen will. Und wenn die EZB weiterhin Geld in den Kreislauf pumpt, dann wird sie die Eurozone japanisieren und mit einer unbegrenzten Lethargie bestrafen; all das in einem Umfeld anhaltender Zwietracht unter den Mitgliedern eines mittlerweile vollkommen politisierten Europarats.
Der vierte Mythos (oder vielmehr Lehr- bzw. Glaubenssatz) besagt, dass die Inflation unter, aber nahe bei 2 % liegen müsse. Aber warum? Woher stammt diese magische Zahl? Sie ist das Kind mathematischer Modelle. Alle “Experten” haben sich einmal in ein Konferenzzimmer eingeschlossen – das Präsidium der EZB, der japanischen Zentralbank, der Federal Reserve, der Bank von England usw. Und Bingo! Sie entschieden einfach, die Rate sollte 2 % betragen. Aber warum 2 %? Die Marke ist ein bizzares und vollkommen willkürliches Ziel und außerdem sehr schwer zu erreichen, vor allem in einer Umgebung, in der die Produktivität so sehr gestiegen ist wie zu Beginn dieses Jahrhunderts, und zwar infolge technologischer Revolutionen und der Einführung zahlreicher Innovationen. Vor diesem Hintergrund sind 2 % ein unrealistisches Ziel, und dessen Beibehaltung erfordert eine extrem laxe Geldpolitik, die all die Effekte verursacht, die wir bereits erörtert haben. Derlei Effekte destabilisieren die Wirtschaft und Finanzwelt und führen, wie wir gesehen haben, in rigiden Ökonomien wie der unseren zum Prozess der Japanisierung. Vor ein paar Jahren war ich zu einer Tagung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft eingeladen. An ihr nahm neben anderen Experten auch ein früherer Chefökonom der EZB teil. Nun, wir einigten uns darauf, dass unter den gegebenen Umständen das Inflationsziel nicht bei 2 %, sondern bei 0 % liegen sollte, und das Referenzziel für das M3-Wachstum zwischen 2 und 2,5 %. Wenn dies das Ziel gewesen wäre, dann wären uns die ultralaxe Geldpolitik und der Japanisierungsprozess erspart geblieben. Und – ein Paradox der Paradoxe – erst kürzlich gab es Gespräche über die Flexibilisierung der Zielvorgabe, nicht aber, um die ultralaxe Geldpolitik (die unnötig ist, wenn das Inflationsziel auf einen Wert zwischen 0 und 1 gesenkt wird) aufzuheben, sondern um höhere Inflationsraten während des gesamten Konjunkturzyklus zu rechtfertigen (welche die rückläufigen Disparitäten „wettmachten“). Welche Logik!
Der fünfte Mythos, von dem Sie schon gehört haben werden, besagt, dass die natürliche Zinsrate falle. Welche Scheinheiligkeit! Man senkt den Zinsfuß künstlich auf null (oder gestaltet ihn negativ) und argumentiert dann, dass die natürliche Rate falle. Niemand kann die natürliche Zinsrate beobachten. Alles, was man beobachten kann, ist der Bruttozinsfuß im Kreditmarkt. In Abwesenheit von Zwangseingriffen sind darin der natürliche Zinsfuß, Aufschläge für die erwartete Inflation bzw. Deflation sowie Aufschläge für Risiken enthalten (gelegentlich auch Aufschläge für eine kurzfristige negative Liquidität). Aber – so viel ist klar – beobachten kann man den natürlichen Zinsfuß nicht. Manche Leute sagen: „Nun, stattdessen kann man stellvertretend den natürlichen Zinssatz für „risikofreie“ Anleihen nehmen.“ Aber Vorsicht! Es sind nämlich die risikofreien Staatsanleihen, die sie kaufen müssen und die in ihren Märkten eine Blase erzeugen, die ihresgleichen sucht. Welche Dreistigkeit und Scheinheiligkeit!
Der sechste und letzte Mythos, den wir erörtern wollen, ist das Mantra, dem zufolge der Zinsfuß deshalb so niedrig ist, weil die Menschen sehr viel sparen und die Bevölkerung altert! Man sagt, die Japanisierung gehe darauf zurück, dass die japanische Bevölkerung mehr und mehre altere und eine Menge anspare. Dieses Argument ist falsch und verwechselt Sparen mit Inflation (Inflation im traditionellen Österreichischen Sinne als Geldwachstum). Benjamin Anderson pflegte zu sagen, dass gemäß der Logik dieses Argumentes das Sparen mit der Geldflutung wächst. Gewiss, Geld fließt in den Kreislauf, und die Menschen bewahren es in ihren Taschen, wie wir gesehen haben. Und dann argumentiert man, dass die Menschen sehr viel sparten. Aber nein! Es passiert etwas ganz anderes. Dass die Nachfrage nach Bargeldguthaben (Bestand) wächst, ist nicht mit einem Anstieg beim Sparen (Bewegung) zu verwechseln. Und was die Alterung der Bevölkerung angeht, dieses Argument ist ebenfalls schwach. Wenn Menschen das Rentenalter erreichen, dann konsumieren sie, was sie zuvor angespart haben. Wir müssen bedenken, dass die Geldnachfrage in Japan enorm angestiegen ist und diese Nachfragezunahme weitgehend in Staatsanleihen kanalisiert wurde, die wie Bargeld behandelt werden. Welche Zeitbombe für Japan, sollte der Anleihenmarkt zusammenbrechen!
Vergessen wir nicht, was wir zu diesen unermüdlich wiederholten Mythen gesagt haben. Auf diese Weise kann man sie immer widerlegen, wenn man sie hört, auch von den angesehenen Größen unseres Fachs.
Schlussfolgerung
Ich beginne die Zusammenfassung mit meinem alternativen Test, den ich zu Beginn als Komplementär zu Hayeks Test vorgestellt habe, und meiner Schlussfolgerung, dass monetäre und fiskalische Stimuli scheitern, weil sie das grundlegende Problem nicht beheben. Das Grundproblem ist die Rigidität der Wirtschaft; d. h. exzessive Regulierung, hohe Steuern, ungezügelte Staatsausgaben und die daraus resultierende Demoralisierung der Unternehmer. Eine Wirtschaft kann sich nur dann von einer Krise bzw. Rezession erholen, wenn die Unternehmer als Klasse motiviert sind. Ich meine damit nicht Keynes‘ „Lebensgeister“, die uns manisch depressiv stimmen. Wir Unternehmer wurden gewaltsam schikaniert und demoralisiert. Solange die staatlichen Behörden Regulierungen in Kraft setzen, Steuern anheben und Geld ausgeben, ist es am einfachsten, sein Geld zu behalten und andere investieren zu lassen, die das wollen (von denen es aber – wenn überhaupt – nur wenige gibt). Obendrein blockiert leichtes Geld die Implementierung marktwirtschaftlicher Reformen, die so politisch unmöglich werden. Der einzige Weg, auf dem unsere Ökonomien die Japanisierung – strukturelle Stagnation und niedrige Inflation – umgehen können, ist somit versperrt. Und wie können wir nun diesem Problem, das sich gefährlich der Eurozone nähert, entkommen? Unser Entkommen ist die große Herausforderung der kommenden Jahre. Diese Herausforderung stellt sich Frankreich (das keinen Ausweg zu haben scheint), Italien, aber auch Spanien. Es stimmt, dass Frankreich eine sehr wohlhabende Wirtschaft hat und – wie auch Japan – über eine große Ansammlung von Kapital verfügt. Aber dies verschleiert die Probleme nur. Die hartnäckigen Fakten und Folgen sind eindeutig: Lethargie und das Scheitern jeglicher reformorientierter Politik. Was ist der einzige Ausweg aus dem Teufelskreis, dem wir uns gefährlich nähern? Nun, klar ist so viel: Wir müssen die Geldpolitik so schnell wie möglich normalisieren und einen Rahmen schaffen, der die Regierungen dazu zwingt, die schmerzhaften strukturellen Reformmaßnahmen, die unsere Ökonomien brauchen, durchzuführen. Die gegenwärtige ultralaxe Geldpolitik begünstigt nur wenige: verschwenderische Regierungen, Halter festverzinslicher Wertpapiere, Hedge Fonds und Spekulanten; und das alles zum großen Nachteil der meisten Bürger, vor allem der Sparer. Zudem hat diese Politik eine Blase in den Rentenmärkten erzeugt, welche die Wohnungsmarktblase, die während der letzten großen Rezession entstand, weit in den Schatten stellt.
Sobald wir wieder eine normale Geldpolitik haben, werden die Regierungen dazu verpflichtet sein, ihre Ausgaben zu kontrollieren, Sparpolitik zu betreiben und die notwendigen Reformen anzustoßen, die zur falschen Zeit aufgehoben und aufgeschoben wurden und die wir heute so nötig haben, um unseren nachhaltigen Wohlstand wiederherzustellen.
*****
Aus dem Englischen übersetzt von Hardy Bouillon.
[1] Friedrich A. von Hayek: Die reine Theorie des Kapitals, Tübingen: Mohr Siebeck 2006 (Band 6, Abt. B der Gesammelten Schriften in deutscher Sprache von F. A. Hayek, herausgegeben von Erich W. Streissler und übersetzt von Monika Streissler). Wie der Zufall es will, haben wir vor kurzem eine vorzügliche spanische Ausgabe bei Union Editorial herausgebracht, die ich Ihnen allen nur wärmstens empfehlen kann.
[2] Ibid., S. 386.
[Nachdruck mit Zustimmung des Autors]
Jesús Huerta de Soto, Ökonomieprofessor an der König Juan Carlos Universität in Madrid, ist Spaniens führender Vertreter der Österreichischen Schule der Nationalökonomie und Senior Fellow am amerikanischen Mises Institute. Als Autor, Übersetzer, Herausgeber und akademischer Lehrer zählt er weltweit zu den aktivsten Botschaftern des Klassischen Liberalismus. Er ist Autor von Die Österreichische Schule der Nationalökonomie (2007), Geld, Bankkredit und Konjunkturzyklen (2011), Sozialismus, Wirtschaftsrechnung und unternehmerische Funktion (2013) und Die Theorie der dynamischen Effizienz (2020).
*****
Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Institut Deutschland wieder.
Foto: Adobe Stock